

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
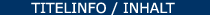
TEILDOKUMENT:
3. Privatisierungsprobleme in der Landwirtschaft
Tiefgreifende institutionelle und betriebliche Anpassungsprozesse bilden die Voraussetzung, daß die MOE-Länder ihre Effizienz im Agrar- und Nahrungsmittelsektor erhöhen und ihre Wettbewerbsposition auch gegenüber den anderen EU-Ländern verbessern. Im Mittelpunkt stehen dabei die Privatisierung und Dekollektivierung der großflächigen Staats- und Kollektivbetriebe: In Staatsbetrieben gehört der Boden dem Staat, in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (in Rußland die Kolchose) gehört der Boden dem Kollektiv und damit zumindest formal den Genossenschaftsmitgliedern. Diese Eigentums- und Betriebsstruktur bildete - sieht man von Polen und Jugoslawien ab - die vorherrschende Organisationsform der Landwirtschaft. Dabei geht es um zwei miteinander verbundene Aufgaben: Die Änderung der Eigentumsrechte (Privatisierung) und die Reform der Betriebsstrukturen (Übergang vom überdimensionierten Großbetrieb zu kleineren Produktionseinheiten). Beide Aufgaben sind miteinander verbunden, müssen jedoch nicht gleichzeitig durchgeführt werden.
Die Eigentumsrechte zu ändern (der erste Schritt) ist deshalb unumgänglich, weil marktsozialistische Systeme (Jugoslawien, teilweise Ungarn) gezeigt haben, daß mit Abschaffung bzw. Schwächung der zentralen Planung die Anreiz- und Motivationsstrukturen für eine effizientere Produktion nur bedingt verbessert werden können. Deshalb sind die Eigentumstitel der Genossenschaftsbauern an ihrem Land wiederherzustellen und für die Staatsgüter (abgesehen von Versuchsgütern) neue Eigentümer zu finden. Auch zeigt die Erfahrung westlicher Demokratien, daß nur in Ausnahmefällen, d.h., wenn religiöse oder ideologische Gründe eine wesentliche Rolle spielen, sich Produktionsgenossenschaften in der Landwirtschaft freiwillig gebildet haben (siehe Kibbuz in Israel).
Die für eine Änderung der Betriebsgrößenstruktur notwendige Neuverteilung des Bodens sowie die Neugruppierung des Anlagevermögens und der Ausrüstungsgüter (Maschinen, Gebäude, Ausrüstungen) erzeugen jedoch zum Teil erhebliche technische und soziale Probleme. Eigentumsrechte für einzelne Landparzellen und Inventar lassen sich oftmals nicht mehr klären bzw. sind schwer zu bestimmen. Flächenbegradigungen, fehlende Grundbucheintragungen bzw. Grundbuchämter, Probleme bei der Bewertung des Kapitalstocks, Restitutionsansprüche von Nicht-Genossenschaftsmitgliedern und, wie im Falle der ehemaligen Sowjetunion, eine gänzlich ausgelöschte bäuerliche Tradition behindern die Neuregelung der Eigentumsrechte und das Entstehen privater Landwirtschaftsbetriebe. Sie forcieren auch zunehmende soziale Konflikte auf dem Lande zwischen Genossenschaftsmitgliedern und jenen, die das Kollektiv verlassen wollen.
Entsprechend den agrarstrukturellen, institutionellen und eigentumsrechtlichen Voraussetzungen haben die einzelnen Länder bei der Neugestaltung des Bodeneigentums unterschiedliche Wege beschritten. Waren die Alteigentümer bzw. ihre Nachfahren identifizierbar, wurden die Flächen meist zurückgegeben oder entschädigt (Restitution). In anderen Fällen wurden die Eigentumstitel an die Beschäftigten der Agrarbetriebe kostenlos verteilt (Distribution). Im zweiten Falle können Alteigentümer entschädigt werden. Dabei blieben die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführten Agrarreformen, die zu einer Enteignung des Großgrundbesitzes und zu einer Neuverteilung des Bodens an die Privatbauern führten (bis zur Kollektivierung 1947/48), weitgehend unangetastet.
Direkte Restitution und Entschädigung sind in jenen Fällen vergleichsweise einfach, in denen es sich um Land ehemaliger Genossenschaften handelt, das formal Eigentum der einzelnen Genossenschaftsbauern blieb (in Bulgarien und CSSR fast die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche, in Ungarn etwa ein Drittel). Dementsprechend haben Bulgarien, Tschechische Republik, Slowakei und die baltischen Staaten die Eigentumstitel an Grund und Boden sowie an Immobilien fast ausschließlich den ehemaligen Besitzern zurückgegeben (Restitution). Allerdings ist die Aufteilung des gesamten genossenschaftlichen Eigentums insofern schwierig, als der gesamte Vermögensanteil, d.h. auch der während des Bestehens der Genossenschaft entstandene Wert an Gebäuden und Maschinen berechnet und zugeordnet werden muß, um den Beitrag des einzelnen Genossenschaftsmitglieds zur Vermögensbildung festzustellen. Als Bemessungsgrundlage für die Vermögensaufteilung dienen meist Arbeitsleistung, Inventarbeitrag und der anfangs eingebrachte Boden.
Albanien und die meisten Staaten der ehemaligen Sowjetunion (ausgenommen das erst während des Zweiten Weltkrieges annektierte Baltikum) haben dagegen das staatliche bzw. genossenschaftliche Eigentum vorrangig über Anteilsscheine an Grund und Boden, Gebäuden sowie Maschinen an Mitglieder und Arbeitnehmer der Agrarbetriebe entsprechend ihrer Arbeitsleistung bzw. Gesamteinnahmen umsonst übertragen (Distribution). In Albanien wurden die Alteigentümer von staatlicher Seite entschädigt. Ungarn und Rumänien verfolgten dagegen eine gemischte Strategie von Restitution und Distribution der Eigentumstitel.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | April 1999