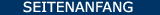![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
-
2. Die „gedichtete" Welt
- Lieder und Gedichte als Schlüssel zur Weltsicht von Arbeitern und Bürgern zwischen 1848 und 1875
[Seite der Druckausg.: 72 (Fortsetzung]
2. Die „gedichtete" Welt - Lieder und Gedichte als Schlüssel zur Weltsicht von Arbeitern und Bürgern zwischen 1848 und 1875
Jedes Lied „hat eine konformierende Wirkung, es kann Gesinnungen prägen, soziale Kontakte stiften, Überzeugungen festigen, Wertbewußtsein bilden und Opferbewußtsein fördern", so hält eine Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung über „Das Politische im Lied" fest.
[Fn-223: Das Politische im Lied . Politische Momente in Liedpflege und Musikerziehung (= Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, 76), Bonn 1967, 40.]
Diese Wirkungsmöglichkeiten des Liedes haben dazu geführt, dass sich verschiedene Gruppen bzw. politische Strömungen im Verlauf der Geschichte des Mediums Lied bedient haben. Im vorhergehenden Kapitel wurde dargestellt, wie Sozialdemokraten der sechziger und siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts mit Liedern, Gedichten und Musik in der Öffentlichkeit umgingen, wo sie die „alten Wege" der bürgerlichen Kultur verließen oder wo sie diese einfach mit neuen „Schildern" versahen. Es wurde bereits angedeutet , dass es Gemeinsamkeiten, aber auch gravierende Unterschiede im Liedrepertoire der Arbeiterbewegung und des „Bürgertums" gab. Diese Unterschiede sind nicht allein aus dem Wunsch nach einer eigenen Kultur zu erklären, sondern sie spiegeln verschiedenartige Identifikationsmuster und Selbstverortungen, Forderungen und Visionen wider. Dies erklärt sich zum einen aus der Tatsache, dass sie für politische Zwecke instrumentalisiert wurden. Im Gegensatz zur „propagandistischen" Nutzung von Liedern und Gedichten in den totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts entstanden die politischen Lieder und Gedichte des 19. Jahrhunderts jedoch nicht im Auftrag einer Partei oder Gruppe. Sie waren zunächst einmal ein Mittel für den Verfasser, sei es nun ein „wirklicher" Dichter oder ein laienhafter Verseschmied, ihn bewegende Ereignisse oder Konstellationen auszudrücken und damit die eigene emotionale Erregung zu verarbeiten. Dies wird besonders deutlich, wenn man einen Blick auf Schreibanlässe
[Seite der Druckausg.: 73]
und Entstehungsbedingungen der Lieder und Gedichte wirft. Immer dann, wenn Ereignisse bzw. die Erinnerung an bestimmte Ereignisse die Menschen in ihrer Existenz oder in ihrem Selbstverständnis berühren und sie auf Veränderung hoffen, greifen sie zu Feder und Papier. Das war 1848 / 49 so, als die Lyrikproduktion sprunghaft anstieg und (fast) alle - vom Gesellen über den Meister bis zum liberal gesinnten Bürger - ihre Klagen und Forderungen in Reime kleideten. Das blieb auch in den bewegten sechziger bzw. frühen siebziger Jahren so: Jeder der sogenannten Einigungskriege wirft in den bürgerlichen Zeitungen seine lyrischen Schatten voraus, das Kampfgetümmel findet seinen Widerhall in einer Flut von Gedichten, die mit den Siegesfeierlichkeiten jedoch recht bald verebbt.
[Fn-224: Eine regelrechte lyrische Sturmflut entfesselte dann viele Jahre später der Erste Weltkrieg, der allein im August 1914 in eineinhalb Millionen Gedichten besungen wurde, vgl. Peter Schleuning , „Die Wacht am Rhein": Deutsche Soldatenlieder; Typen, Traditionen und Inhalte an Einzelbeispielen, in: Der Geist von 1914: Zerstörung des universalen Humanismus?, Rehburg-Loccum 1990, 77-117, hier: 81.]
Anders die poetischen „Gezeiten" der Sozialdemokratie: Hier finden die „großen" politischen Ereignisse mit Ausnahme des Krieges gegen Frankreich bzw. der Niederschlagung der Kommune weniger Beachtung. Eine Vielzahl an Gedichten bezog sich dagegen auf Ereignisse, die für die übrige Gesellschaft eine geringe Bedeutung gehabt haben dürften; sie sollten auf den Stiftungsfesten und Lassallefeiern vorgetragen werden. Auffällig ist auch die hohe Zahl von Gedichten, die ohne besonderen Anlass verfasst zu sein scheinen und allgemein die Ziele der Arbeiterbewegung bzw. die Gemeinschaft der Sozialdemokraten beschwören. Diese Art von „allgemeinpolitischen" Gedichten fehlt in den bürgerlichen Zeitungen fast völlig, ein Indiz dafür, dass (Innen-) Politik zu diesem Zeitpunkt dort einen anderen emotionalen Stellenwert hatte.
Trotz dieser unterschiedlichen Gewichtungen geben Gedichte und Lieder aller Gruppen darüber Auskunft, wie man die gegenwärtige politische und soziale Verfasstheit der Gesellschaft wahrnahm und welche Visionen man - wenn man überhaupt welche hatte - für die Zukunft hegte. Eine große Bedeutung wird auch der „nationalen Frage" zugemessen: Verschiedene Bilder der deutschen und anderer Nationen werden entworfen; dementsprechend unterscheiden sich auch die Einstellungen zu Krieg und Frieden. Ob nun der Soldat oder der Arbeiter auf der Bühne des Reimgeschehens auftritt - immer kommen dabei auch bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit zur Sprache. Weiblichkeit ist häufig die andere, unsichtbare Seite der männlichen Medaille, „Weibischheit" dient oft zur Denunzierung des jeweiligen Gegners. Diesen Bildern von Gesellschaft und Nation, aber auch von Geschlechtscharakteren sowie deren Konstruktion in den Liedern und Gedichten von 1848 bzw. von 1863-1875 soll in den folgenden zwei Kapiteln nachgegangen werden.
[Seite der Druckausg.: 74]
2.1.„Und endlich wird ein Lied uns singen, dass nun die Welt erlöset sei!" - Bilder und Visionen von Gesellschaft
Sowohl in der Revolution von 1848 als auch im Verlauf des preußischen Verfassungskonfliktes, der sich 1861 an der Frage des auch für den Militäretat zuständigen Budgetrechts des preußischen Landtages entzündet hatte und bis zur Annahme der Indemnitätsvorlage im Jahre 1866 schwelte, war die politische Verfassung Preußens bzw. eines zukünftigen deutschen Reiches eine heftig umstrittene Angelegenheit. Die Proklamation des deutschen Reiches am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles machte dieser Diskussion ein vorläufiges Ende, wenngleich das Verhältnis von (katholischer) Kirche und Staat sowie die Haltung zu den angeblichen sozialdemokratischen „Reichsfeinden" weiterhin im Brennpunkt der Auseinandersetzung standen. Daneben war es vor allem die sogenannte „soziale Frage", die die Gemüter erhitzte. Obwohl 1849 beispielsweise in Preußen erst 4,9 % der Erwerbstätigen in der großgewerblichen Produktion tätig waren
[Fn-225: Hans-Ulrich Wehler , Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3: 1849-1914, München 1995, 141.],
spürte man die Auswirkungen der Industriellen Revolution mit ihrer Tendenz zur Auflösung der alten handwerklichen Strukturen und der Zerstörung der Produktionsweise des „ganzen Hauses" bereits sehr deutlich.
[Fn-226: Hans-Jörg Zerwas , Arbeit als Besitz. Das ehrbare Handwerk zwischen Bruderliebe und Klassen kampf 1848, Reinbek bei Hamburg 1988, 228.]
In der Revolution von 1848 war es vor allem die im August 1848 in Berlin gegründete „Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung" unter Leitung des Schriftsetzers Stefan Born, die sich dieses Problems offensiv annahm, während der zur gleichen Zeit tagende Frankfurter Meisterkongress, der den Handwerksgesellen kein Stimmrecht gewährte, auf einer weitgehenden Restitution der alten Verhältnisse beharrte.
[Fn-227: Hans-Jörg Zerwas, 1988, 231.]
In den sechziger Jahren nahmen die Sozialdemokraten und die liberale Fortschrittspartei den Diskussionsfaden wieder auf und entwickelten neue Konzepte der Organisation der Arbeiter. Setzten die Liberalen weitgehend auf die Idee der Selbsthilfe und propagierten Konsumgenossenschaften und Sparvereine für die Arbeiter, so übernahmen Teile der Sozialdemokratie in den sechziger und siebziger Jahren die Ideen Lassalles, die dieser in den Grundzügen bereits in seinem „Offenen Antwortschreiben" an das Leipziger Zentralkomitee zur Berufung eines allgemeinen deutschen Arbeiterkongresses vom 1. März 1863 formuliert hatte.
[Fn-228: Vgl. Dieter Dowe / Kurt Klotzbach (Hg.), Programmatische Dokumente der deutschen Sozialdemokratie, 2. Auflage, Berlin / Bonn 1984, 111-144.]
Die soziale Lage der Arbeiter sieht Lassalle darin hauptsächlich durch das von ihm entdeckte „eherne Lohnge-
[Seite der Druckausg.: 75]
setz" bestimmt; unter den Bedingungen der Lohnarbeit werde den Arbeitern niemals ein weit über das Existenzminimum hinausgehender Lohn zugebilligt werden. Abhilfe - und hier greift Lassalle ein bereits von der „Arbeiterverbrüderung" entwickeltes Konzept auf - könne nur in Form von Produktivassoziationen mit Unterstützung des Staates geschaffen werden. Das allgemeine, direkte und gleiche (Männer-)Wahlrecht sei das einzige Mittel, um die Wahrung der legitimen Interessen der Arbeiter zu gewährleisten. So schafft Lassalle eine enge Verbindung zwischen politischen und sozialen Forderungen der Arbeiter, die in dieser Weise in der Revolution von 1848 noch nicht ausgeprägt war.
Für die Legitimation bzw. Abwehr der politischen und sozialen Forderungen der verschiedenen Gruppen war es entscheidend, mit welchen Formulierungen und Metaphern die bestehende Gesellschaft beschrieben wurde, wie man zentrale Begriffe wie etwa „Volk", „Arbeiter", „Fürst", „Bürger" definierte und mit welchen emotional wirksamen Konnotationen man sie versah. Den Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser Konstruktionen soll im folgenden nachgespürt werden.
2.1.1 1848 - Der Kampf um die Ehre der Arbeit und die „heil'gen Rechte" des Volkes
„Und daß wir Männer sind, das kannst du sagen, / Und daß wir Einer für den Andern steh'n; / Denn unser Bund vereinet alle Stände, / Und im Panier steh'n die verschlung'nen Hände." So wird einem in die Ferne ziehenden „Bruder" 1849 in einem vom Hamburger Bildungs-Verein für Arbeiter herausgegebenen Liederbuch nachgerufen.
[Fn-229: E. Brachvogel, Auf's Neue geht ein Bruder in die Ferne, in: Deutsche Lieder, hrsg. vom Bildungs-Verein für Arbeiter in Hamburg, Hamburg 1849, Nr. 91, 137/8 (künftig zitiert als: Deutsche Lieder, 1849).]
In diesem kurzen Abschiedsgruß klingen bereits die wichtigsten Elemente der Selbstdefinition von Handwerkern aus dem Umkreis der Arbeiterverbrüderung an, zu deren Gründungsmitgliedern der Hamburger Bildungs-Verein für Arbeiter zählte: Brüderlichkeit, Männlichkeit, gegenseitige Hilfe. Als Fundament von Freiheit und Gleichheit, ja der menschlichen Beziehungen überhaupt wurde die Brüderlichkeit angesehen
[Fn-230: Hans-Jörg Zerwas, 1988, 242.],
als deren Symbol die „Verbrüderungshände" gewählt wurden, die von dieser Zeit an fester Bestandteil der sozialdemokratischen Ikonographie bis zum Ende des Ersten Weltkrieges blieben.
[Fn-231: Gottfried Korff , Rote Fahnen und geballte Faust. Zur Symbolik der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik, in: Dietmar Petzina (Hg.), Fahnen, Fäuste, Körper. Symbolik und Kultur der Arbeiterbewegung, Essen 1986, 27-60, hier: 28. Die Verbrüderungshände waren bereits vorher ein Symbol der Freimaurer. Nach 1945 bemühte die SED dieses Symbol für die (z.T. unter Zwang erfolgte) Vereinigung von KPD und SPD zur SED.]
Diese 1848 so häufig besungene
[Seite der Druckausg.: 76]
Brüderlichkeit oder auch Bruderliebe sollte alle äußeren Schranken überwinden helfen, darum auch sollten alle Stände im „traulichen Verein" willkommen sein
[Fn-232: L. Klopstech, Heil dem schönen Handwerksbunde, in: Liederbuch für Handwerker-Vereine, 2. vermehrte Auflage, hrsg. v. Berliner Handwerker-Verein, Berlin 1848, Nr. 2, 7/8 (künftig zitiert als: Liederbuch für Handwerker-Vereine, 1848).],
und doch schloss das Konzept der Brüderlichkeit so manche(n) aus. Natürlich war dort, wo die Bruderliebe hochgehalten wurde, kein Platz für Frauen. Aber auch die Brüder mussten bestimmte Eigenschaften mitbringen, um als solche anerkannt zu werden. So heißt es in einem Lied von 1848, dass nur der „unser Mann" sei, der „denken, fühlen, schweigen kann / Und sich zu freuen weiß", wohingegen man den nicht achte, den „Kratzfuß, Titel, Rang und Geld / Zum großen Manne macht."
[Fn-233: Bonterweck, Wer nie im Freundeskreis sich freu'n, in: Liederbuch für Handwerker-Vereine, 1848, Nr. 17, 26/7.]
Damit wird deutlich, dass hinter der scheinbar ständeverbindenden Idee der Brüderlichkeit das Konzept einer Gesellschaft steckt, in der die Abgrenzung durch Stand bzw. berufliche Stellung oder Geld ihre Geltung verliert. Demjenigen, der sich durch „Zierrat" und „Dünkel" von den anderen zu unterscheiden sucht, wird infolgedessen die Tür gewiesen.
[Fn-234: Vgl. z.B. R. Linderer, Ein festes Haus ist unser Haus!, in: Liederbuch für Handwerker-Vereine, 1848, Nr. 7, 13-5 oder L. Klopstech, Erklinget, ihr Lieder, in: Liederbuch für Handwerker-Vereine, 1848, Nr. 8, 15/6.]
An die Stelle der äußeren Auszeichnung tritt der innere Wert, die „wahre" Menschlichkeit, die sich in der Fähigkeit zu eigenem Denken, im Mitgefühl und in der Bereitschaft zur Freude im geselligen Kreis erweist. Die Wertschätzung des Schweigens drückt sicherlich keine Missachtung der Gemeinschaft aus, sondern sie deutet bereits auf das Misstrauen gegenüber der Beredtheit der gebildeten „Advokaten" und „Diplomaten" im Frankfurter Parlament voraus. Die Tugenden, die hier hervorgehoben werden, sind somit im wesentlichen auf die Gemeinschaft bezogen. Damit einher geht das stete Lob des Vereins und der Einigkeit, die auch und vor allem als Bollwerk gegen eine eher feindlich gedachte äußere Welt wirken können. Im Verein mit den Bundesgesellen kann man „Pein und Noth" verlachen
[Fn-235: Simon Dach, Der Mensch hat nichts so eigen, in: Liederbuch für Handwerker-Vereine, 1848, Nr. 13, 21/2.],
man kann die Tagessorgen vergessen, da man sich in einem Raum bewegt, den man selbst bestimmen und gestalten kann, denn: „Wir sind Kön'-
[Seite der Druckausg.: 77]
ge unsrer Welt."
[Fn-236: L. Klopstech, Heil dem schönen Handwerksbunde, in: Liederbuch für Handwerker-Vereine, 1848, Nr. 2, 7/8.]
Dieser Freiraum ist neben der brüderlichen Gemeinschaftlichkeit durch die Suche nach bzw. Bewahrung von Wahrheit und Recht bestimmt. In fast allen Liedern, die die Handwerkervereine besingen, tauchen diese beiden Begriffe auf, ohne dass sie genauer bestimmt werden oder deutlich gemacht würde, gegen wen um Wahrheit und Recht gestritten werden müsste. Eine besondere politische Brisanz gewinnt die Betonung dieser scheinbar universalen Werte erst dann, als in den Liedern, die wenig später entstehen, Lüge und Willkür zu Hauptkennzeichen des politischen Gegners avancieren. Man kann also vermuten, dass bereits zu diesem früheren Zeitpunkt die Anklage von Lüge und Willkür vernehmbar mitschwang, wenn das Eintreten für Wahrheit und Recht als ein Spezifikum des Handwerksbundes gedeutet wurde.
Ein letztes, wesentliches Kriterium für die Gemeinschaft der „Brüder" ist die Arbeit. Die „Arbeit […] zeigt des Mannes Werth", heißt es in einem von einem Mitglied des Berliner Handwerkervereins gedichteten Lied
[Fn-237: E. Röder, Rüstig und munter, in: Liederbuch für Handwerker-Vereine, 1848, Nr. 25, 35/6.],
sie ist die „freie Mannesthat", die es dem Mann erlaubt, voller Verachtung auf die „Laffen", „Stutzer" und „reichen Schlemmer" herabzusehen.
[Fn-238: Nur durch die Arbeit wird man frei! in: Republikanische Lieder und Gedichte, zweiter Theil, hrsg. v. J.C.J. Raabé, Kassel 1851, Nr. 56, 133/4 (künftig zitiert als: Republikanische Lieder, 1851 a) bzw. W. Steinhäuser, Zur Arbeit, zur Arbeit mit frischem Muth!, in: Liederbuch für Handwerker-Vereine, 1848, Nr. 24, 34/5 und E. Röder, Rüstig und munter, in: a.a.O., Nr. 25, 35/6.]
Hinter der Verbindung von Arbeit und Freiheit bzw. der Gegenüberstellung des eigentlichen, da arbeitenden Mannes und des unnützen reichen Schlemmers verbirgt sich der Anspruch auf den vollberechtigten Bürger-Status. Die Verbindung von Besitz und Bürgerstatus war in der Aufklärung mit dem Argument gerechtfertigt worden, dass nur der besitzende Bürger frei, da ökonomisch unabhängig sei und dass darum nur er ein Interesse für die Gesellschaft als ganzes hegen könne. Ohne dass dieses Konzept in den Liedern, die sich 1848 mit den sozialen Verhältnissen beschäftigen, schon explizit angegriffen würde, bereitet sich in ihnen doch ein Argumentationsmuster vor, das in der Folgezeit in sozialdemokratischen Kreisen zunehmend an Bedeutung gewinnen sollte, der Rückgriff auf die soziale „Arbeiter"-Identität zur Rechtfertigung der politischen Partizipationsforderungen.
[Fn-239: Vgl. Thomas Welskopp , 2000, 63f.]
Sehr deutlich kommt dies in einem Lied Ferdinand Freiligraths zum Ausdruck, das jedoch in dieser Zuspitzung für die Lieder von 1848 singulär ist. Dort überlegt der Heizer eines
[Seite der Druckausg.: 78]
Dampfers, der das preußische Königspaar auf dem Rhein nach Bieberach bringt:
„Wie mahnt dies Boot mich an den Staat! Licht auf den Höhen wandelst Du!
Tief unten, in der Nacht und in der Arbeit dunklem Schooß
[…]
da schür' und schmied' ich mir mein Loos!
Nicht meines nur, auch Deines, Herr! Wer hält die Räder Dir im Tact,
Wenn nicht mit schwielenharter Faust der Heizer seine Eisen packt!
Du bist viel weniger ein Zeus, als ich, o König, ein Titan!
Es liegt an mir: - Ein Ruck von mir, ein Schlag von mir zu dieser Frist
Und siehe, das Gebäude stürzt, von welchem Du die Spitze bist! […]
Wir sind die Kraft! Wir hämmern jung, das alte morsche Ding, den Staat, Die wir von Gottes Zorne sind bis jetzt das Proletariat!"
[Fn-240: Ferdinand Freiligrath, Von unten auf, in: Socialistisches Liederbuch, 2. Auflage, Kassel 1851, Nr. 19, 105-109 (künftig zitiert als: Socialistisches Liederbuch, 1851).]
Sowohl von der Begrifflichkeit als auch von der Argumentation vermeint man in diesem Lied schon Herweghs berühmt gewordene Verse von 1863 zu vernehmen: „Mann der Arbeit, aufgewacht! / Und erkenne Deine Macht! / Alle Räder stehen still, / Wenn Dein starker Arm es will." [Fn-241: Georg Herwegh, Arbeiterlied, in: VS 26.3.1870, Nr. 25.] Im Unterschied zu Herweghs kämpferischem Aufruf der Schlußstrophe: „Brecht das Doppeljoch entzwei! / Brecht die Noth der Sklaverei! / Brecht die Sklaverei der Noth! / Brod ist Freiheit, Freiheit Brod!" begnügt sich Freiligraths Heizer jedoch noch mit der Erkenntnis seiner Macht und der vagen Drohung: „Heut, zornig Element, noch nicht!"
Auffällig ist, dass sich die Lieder äußerst selten an die „Arbeiter" richten, sondern zumeist die weitaus unspezifischere Anrede als „Brüder" oder „Männer" gewählt wird. Dies kann als Indiz dafür gelten, dass die zünftige Deutungswelt noch weitgehend in Kraft war, nach der der Begriff „Arbeiter" den „unterständische[n], tendenziell unqualifizierte[n] Gelegenheitsarbeiter […] und [den] Beschäftigten in zentralisierten Großbetrieben" bezeichnete. [Fn-242: Vgl. Thomas Welskopp , 2000, 66.] Dass aber auch die Selbstbezeichnung als Handwerker bzw. Geselle und
[Seite der Druckausg.: 79]
Meister nicht gewählt wird, deutet an, dass man nach Überwindung der alten Hierarchien innerhalb der Zünfte, aber auch der Beschränkungen nach außen strebte. Die Verwendung der Begriffe „Männer" bzw. „Brüder" zeigt also in diesem Zusammenhang, dass die Lieder in einer Zeit des Umbruchs entstanden sind, in der die Vorstellungen und Begriffe noch stark vom „alten Handwerk" geprägt sind, während gleichzeitig bereits antizünftige Tendenzen um sich greifen.
Neben diesen „Vereinsliedern", in denen Arbeit weitgehend positiv konnotiert ist, finden sich in den Liederbüchern von 1848 eine Reihe von Balladen, die anhand eines Einzelschicksals bzw. des Loses einer kleinen Gruppe anklagend auf die bedrückten Lebensverhältnisse der „Armen" hinweisen. Diese Lieder gruppieren sich um den Dualismus „arm" versus „reich". Das „arme Volk", das hier zumeist aus der mitleidigen Distanz eines Erzählers besungen wird, begegnet uns im allgemeinen in der Figur von Frauen und Kindern, manchmal auch in der Person des ungelernten Arbeiters. Diese Veilchenverkäuferinnen, Weberinnen oder Perlentaucher unterscheiden sich sehr deutlich vom eben skizzierten Bild des arbeitenden Mannes, der sich seines Wertes für die Gesellschaft überaus bewusst ist. Das „arme Volk" ist ganz eindeutig unschuldiges und wehrloses Opfer der Reichen, die abwechselnd als hartherzig, dekadent oder auch nur als gedankenlos gezeichnet werden. Damit reihen sich diese Lieder in die jahrhundertealte Tradition der Sozialklage ein, als deren Hauptthemen Grausamkeit, Rücksichtslosigkeit und Hartherzigkeit gelten und die häufig durch den Vorwurf der Lüge und des Wankelmutes bzw. das Motiv der Feigheit und Ausschweifung ergänzt werden.
[Fn-243: Vgl. Ernst Klusen , Das sozialkritische Lied, in: Rolf-Wilhelm Brednich u.a. (Hg.), Handbuch des Volksliedes, Bd. 1, München 1973, 737-760, hier: 748/9.]
Das Motiv der Feigheit fehlt in den sozialkritischen Liedern von 1848. Vermutlich hätte die Darstellung des Reichen als feige den Eindruck der Wehrlosigkeit der zumeist weiblichen Opfer gestört und ist darum unterblieben.
In diesen Balladen wird sehr deutlich der Luxus der Reichen als unmittelbare Folge der Ausbeutung der Armen dargestellt. So stellt Anastasius Grün eine in Seide gewandete, perlengeschmückte Ballschönheit vor, der unsichtbar „ein wüst Gefolg unheimlicher Gestalten" hinterherschwebt - die Schar jener, die für ihren Schmuck gelitten haben und gestorben sind. Und so wendet sich der Sänger zum Schluss an die ahnungslos grausame junge Frau: „Zerstört, geknickt, entweiht so viele Leben, / Daß du ein Stündchen magst im Reigen schweben, / O, Jungfrau, unschuldsvoll und seelenrein!"
[Fn-244: Anastasius Grün, Ungebetene Gäste, in: Socialistisches Liederbuch, 1851, Nr. 22, 119-122.]
Das Motiv des zerstörten oder ungelebten Lebens taucht auch sehr häufig in Verbindung mit
[Seite der Druckausg.: 80]
dem Schicksal der Weberin auf. Damit wurde zum einen auf die Tradition der im Zusammenhang mit dem schlesischen Weberaufstand von 1844 entstandenen Weberlieder zurückgegriffen, zum anderen war den Zeitgenossen das Bild der Textilarbeiterin vertraut, da die Textilindustrie zu den klassischen Frauenbranchen zählte.
[Fn-245: Jürgen Kocka , Arbeitsverhältnisse und Arbeiterexistenzen. Grundlagen der Klassenbildung im 19. Jahrhundert, Bonn 1990, 466.]
Darüber hinaus war die Textilfabrik ein bevorzugter Gegenstand der zeitgenössischen Fabrikkritik, da sie als „Inbegriff einer erbarmungswürdigen Beschäftigung" galt.
[Fn-246: Jürgen Kocka, 1990, 448.]
Die folgende Klage einer englischen Arbeiterin legt davon eindrucksvoll Zeugnis ab:
„Schaffen, daß die Sinne schwinden,
Daß die Augen schier erblinden,
Daß in Nebelbildern hin
Planlos die Gedanken zieh'n. […]
Seht, die stolze Jugendkraft,
Seht des Lebens Mark und Saft,
Stahlen Diebe. […]
Räuber, deren Gott, das Geld,
Uns im Elend niederhält –
Wuchrer, die den Lohn verkümmert,
Die uns unser Loos verschlimmert,
Zittert nun! Der Armen Fluch
Webet Euch das Leichentuch."
[Fn-247: Miß Speridan Carrey, Lied einer englischen Arbeiterin, in: Socialistisches Liederbuch, 1851, Nr. 10, 51/2. Der von den Webern ins Tuch hineingewebte Fluch bzw. das gewebte Leichentuch ist seit Heines im Juni 1844 verfasstem „Lied der schlesischen Weber", das noch im selben Jahr ins Englische übersetzt wurde, zum Topos der Weberlieder geworden.]
Im Unterschied zum zuvor zitierten Lied ist hier keine unschuldige Jungfrau ahnungslos schuldig geworden, sondern die englische Weberin verdankt ihr hartes Los einem „Wucherer", der sie aus Selbstsucht um den gerechten Ertrag ihrer Arbeit bringt. Hinter dieser Anklage des „Wucherers", für den das Geld zum Gott wurde, steht die Kritik an den allein durch den Faktor Geld bestimmten Arbeitsverhältnissen und damit der Wunsch nach Verfügung über das eigene Arbeitsvermögen, so wie Zerwas es als Forderung der Arbeiterverbrüderung in die prägnante Formel „Arbeit als Besitz" gefaßt hat. [Fn-248: Hans-Jörg Zerwas, 1988, 225/6.] Damit reiht sich die Autorin in die Reihe derjenigen ein, die die menschlichen Be-
[Seite der Druckausg.: 81]
ziehungen durch das Verlangen nach Geld bestimmt sehen und den Verlust an Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit bitter beklagen. Besonders deutlich wird dies im Bild des Armen, der ohne die Hilfe und den Zuspruch von Arzt und Priester sterben muss, denn: „Hilfe bringt man nur um Geld, / Also wollen's die Gesetze der civilisirten Welt."
[Fn-249: Nachtwache, in: Republikanische Lieder und Gedichte, hrsg. v. J.C.J. Raabé, 2., sehr vermehrte Auflage, Kassel 1851, Nr. 33, 56-58 (künftig zitiert als: Republikanischse Lieder, 1851 b).]
Es kann also nicht darum gehen, dem „schwachen Armen" mit „milder Hand" ein wenig Geld zu geben, so wie es nur noch in einem einzigen Lied von 1848 empfohlen wird
[Fn-250: G.W.Ch. Starke, Wir die Könige der Welt, in: Liederbuch für Handwerker-Vereine, 1848, Nr. 65, 83/4.],
sondern das Geld als Wurzel des Eigennutzes muss seiner zentralen Funktion im menschlichen Miteinander beraubt werden. Diese antikapitalistische Stoßrichtung wird in einem Lied Wilhelm Weitlings, der 1836 zu den Gründungsmitgliedern des „Bundes der Gerechten" gehörte und mit seinen Schriften zu den hervorragendsten Gestalten der vormärzlichen Arbeiterbewegung zählte, besonders deutlich; dieses Lied endet mit der Frage:
„Hört ihr, wie sie Geld schreien von einem Winkel der Erde bis zum andern?
Der Fürst und der Räuber, der Kaufmann und der Dieb, der Advokat und der Betrüger, der Priester und der Charlatan,
Alles schreit Geld.
Und auch du, Bettler, schreist Geld?"
[Fn-251: Wilhelm Weitling, Alles Blut und alle Thränen, in: Socialistisches Liederbuch, 1851, Nr. 18, 99-102.]
Die meisten der Lieder, die sich dem Missverhältnis von Arm und Reich widmen, belassen es bei der Schilderung der Ungerechtigkeit und fordern nicht direkt dazu auf, die Situation zu ändern. Einige wenige Lieder enden mit verhüllten Drohungen an die Adresse der Reichen oder rufen mehr oder weniger deutlich dazu auf, die passive Haltung gegenüber dem eigenen Unglück aufzugeben. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist Karl Becks „Warum sind wir arm?", das sich in vielen Liederbüchern um 1848 findet und auch in den sechziger und siebziger Jahren noch populär gewesen zu sein scheint. Dort heißt es, nachdem in mehreren Strophen der Gegensatz von reichem Müßiggang und der täglichen Qual des Armen dargestellt wurde:
[Seite der Druckausg.: 82]
„Denn - warum sind wir arm?
Wir sind's; dafür ein Fluch den Alten,
Die uns gelehrt die Hände falten:
‚Wer nur den lieben Gott läßt walten,‘
‚Der ist erlöst von Harm,‘
‚Der ist erlöst von Harm.‘
Wir borgen und sorgen, Ihr häufet die Gulden,
Wir füllen die Kirchen und beten und dulden.
Dies Dulden ist unser unendlich Verschulden,
Und - darum sind wir arm.
Und - darum sind wir arm."
[Fn-252: Karl Beck, Warum sind wir arm?, in: Republikanisches Lieder-Buch, hrsg. v. Hermann Rollett, 2. Auflage, Leipzig 1848, Nr. 46, 103-105 (künftig zitiert als: Republikanisches Lieder-Buch, 1848) sowie in: Republikanische Lieder und Gedichte, hrsg. v. J.C.J. Raabé, Kassel 1849, in: Heidrun Kämper-Jensen, Lieder von 1848, Tübingen 1989, 225-256, hier: 244 (künftig zitiert als: Republikanische Lieder, 1849); Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 77, 127/8 und in: Socialistisches Liederbuch, 1851, Nr. 15, 70-72.]
Konkreter oder kämpferischer wird der Aufruf zu einer Änderung der sozialen Verhältnisse in den Liedern von 1848 nicht. Wesentlich revolutionärer klingen hingegen die Töne, die in den Liedern über die politische Ordnung angestimmt werden.
„Mit blut'gem Banner zieht hernieder
Die Tyrannei zur letzten Schlacht.
Hört ihr der Söldner wilde Horden,
Weithin toben durch's ganze Land?
[…]
Tyrannen, bebt vor unsrem Grimme!
Erzittre, blut'ge Würgerbrut!
Hört ihr des Unterdrückten Stimme?
Bald zahlen sie euch Blut mit Blut."
[Fn-253: Freiheitsgesang, in: Republikanische Lieder und Gedichte, 1849, 232.]
Einen Kampf der Kräfte der Finsternis gegen das Gute scheinen die Sänger von 1848 ihren Zuhörern zu schildern, wenn sie das Volk auf der Bühne des historischen Geschehens gegen den „Tyrannen" und seine „Schergen" antreten lassen. Es sind zwei sehr ungleiche Gegner, die dort gegeneinander kämpfen. Das „Volk", wie es meist umstandslos heißt, ist „stolz" und „kühn", es bevorzugt die „offene That" und zeichnet sich durch sein „redliches Herz"
[Seite der Druckausg.: 83]
aus. Der „Tyrann" hingegen erscheint als Inbegriff des Lasters und der Willkür, darum wird die neutrale Bezeichnung „Fürst" auch selten gewählt. Eine friedliche Verständigung der beiden Parteien scheint von vorneherein ausgeschlossen. Diese manichäische Darstellung der politischen Welt nimmt jedoch nicht nur auf die universell gültigen Muster von Gut und Böse Bezug, sondern versucht, die Legitimität der Fürsten historisch und moralisch zu hinterfragen.
Als historischer Bezugspunkt dienen der Verweis auf den Einsatz des „Volkes" für den König in den Befreiungskriegen und das uneingelöste Versprechen des preußischen Königs, seinem Volk eine Verfassung zu geben. In den Liedern wird allerdings weniger auf das verbreitete Argumentationsmuster zurückgegriffen, nach dem die allgemeine Wehrpflicht die politische Partizipation der für das Gemeinwohl kämpfenden Bürger zur Folge haben müsste.
[Fn-254: Vgl. Ute Frevert , Soldaten, Staatsbürger. Überlegungen zur historischen Konstruktion von Männlichkeit, in: Thomas Kühne (Hg.), Männergeschichte - Geschlechtergeschichte. Männlichkeit im Wandel der Moderne, Frankfurt a.M. 1996, 69-87, hier: 77ff.]
Wesentlich häufiger ist das einfachere und damit eindrucksvollere Motiv der Wortbrüchigkeit des Königs. So wendet sich Moritz Hartmann an „mein großes Volk":
„Ein Sockel war's, den du anfingst zu bauen
Mit Männerblut und dem Schmuck der Frauen,
Das achtzehnhundert und dreizehnte Jahr –
Wo bleibt der Gott, den du blutig gerochen,
Und den sie hinan zu stellen versprochen?! –
Sie haben wie Scherben ihr Wort gebrochen,
Weil's nur ein Kaiser- und Fürstenwort war."
[Fn-255: Moritz Hartmann, Deutsche Monumente, in: Republikanische Lieder, 1851 a, Nr. 37, 62-65.]
Hier wird das Opfer der Männer und Frauen des Volkes, die ihr Wertvollstes - ihr Leben bzw. ihr Haar - für die Freiheit und die Ehre - das deutsche Monument - gaben, dem Wortbruch der Fürsten gegenübergestellt. Damit wird deutlich, dass das Volk mit seiner Existenz für sein Wort einzustehen bereit war, während das Wort der Fürsten sich als völlig wertlos herausgestellt hat. Dies führt zu einer generellen Entwertung des „Kaiser- und Fürstenwort[es]", wie es im „nur" der letzten Zeile zum Ausdruck kommt. Das Vertrauen zwischen Volk und Fürsten - und damit in den rechtlichen Charakter der Herrschaft - ist zerstört, dies ist aber eine der wesentlichen Voraussetzungen der freiwilligen Unterwerfung des Volkes dem Souverän gegenüber. Von da an
[Seite der Druckausg.: 84]
kann Herrschaft nur noch Gewalt-Herrschaft sein; der Fürst wird folgerichtig zum Tyrannen.
Auf moralischer Ebene diskreditierte sich der König dadurch, dass er das 1813 gegebene Verfassungsversprechen nicht einlöste und sich damit nicht dem allgemeinmenschlichen Gebot der Treue und Dankbarkeit entsprechend verhielt. Dieses Motiv wird in einer Tierfabel mit dem Titel „Der Lohn des Helden" ausgeführt. Es wird eine Dogge gezeigt, die den Löwen um den Preis ihres Lebens aus dem Rachen von zwei Tigern rettet. Die Undankbarkeit des Löwen gipfelt in dem Satz: „Weg mit dem Aas! es braucht kein Grab! / Nur zieh' mir ja die Haut ihm ab - / Es läßt sich gut d'rauf schlafen." Diese menschenverachtende Arroganz veranlaßt den anwesenden Bären zu dem bitteren Fazit: „Stirb für dein Weib, für deinen Freund - / Für's Vaterland, für deinen Feind - / Nur stirb für keinen Fürsten!"
[Fn-256: Gottfried Konrad Pfessel, Der Lohn des Helden, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 89, 141/2.]
Hier wird nun nicht nur der Kampf aus Loyalität gegenüber dem Fürsten in Frage gestellt, sondern es werden bereits andere Instanzen angeboten, für die es sich zu kämpfen lohnt: zunächst das nähere Umfeld - Weib und Freund, dann der 1848 so oft gewählte Rahmen - Vaterland bzw. Feind, der in dieser Sicht ehrenhafter erscheint als der Fürst. Die Rolle des Mannes als Beschützer von Haus und Hof wird in den Liedern von 1848 eher selten thematisiert, dies mag daran liegen, dass meist nicht der Mann als Individuum, sondern das (männliche) Volk angesprochen wird. Die nationalen Implikationen dieses Gedankens sollen in einem späteren Kapitel genauer ausgeführt werden, an dieser Stelle ist jedoch die gelegentlich zu findende Gegenüberstellung des „Fürstenbundes" und des „Bundes der Völker" interessant. Die heilige Allianz von 1815 zwischen Preußen, Österreich und Russland wird als unheilige Koalition zwischen „Preußens Soldatesken-Ruthe", „Oestreichs Stock" und „der Kosacken Knute" dargestellt, die nur ein gemeinsamer Aufstand der Völker enden kann:
„Doch auf, ihr Völker! schüttelt eure Ketten!
[…] Steht auf mit Macht und fordert eure Rechte!
Dringt bis zum Thron; durchbrecht den Troß der Knechte!
Und weis't man euch zurück, reicht euch die Hände,
Daß Völkerbund den Bund der Fürsten ende!
Das ist der heil'ge Bund, der einzig ächt',
Gestützt auf Freiheit und das ew'ge Recht."
[Fn-257: R. Gottschall, Der heil'ge Bund, in: Republikanische Lieder, 1851 a, Nr. 1, 172.]
Die hier formulierte leise Hoffnung auf den „guten" König inmitten der „bösen" Berater ist in den der Untersuchung zugrundeliegenden Liedern von
[Seite der Druckausg.: 85]
1848 eher selten zu finden. Diese Feststellung ist jedoch nicht weiter überraschend, da die ausgewählten Liederbücher dem demokratisch-republikaischen Spektrum zuzurechnen sind. [Fn-258: Vgl. die Einleitung dieser Arbeit.]
Freiheit und Recht gehen in der Argumentation der Lieder zumeist eine enge Verbindung ein. Dies läßt sich nicht nur durch den Rückbezug auf die historische Konstellation von 1813 erklären, wo der Kampf um Freiheit und die getäuschte Hoffnung auf eine Verfassung miteinander verknüpft waren. Das Begriffspaar „Freiheit" und „Recht" zielt häufig auch auf eine Infragestellung der göttlichen Legitimation der Fürsten. So beschloss die preußische Nationalversammlung bereits im Hochsommer 1848, den monarchischen Titel „von Gottes Gnaden" abzuschaffen.
[Fn-259: Rüdiger Hachtmann , Revolution von 1848 in Berlin, in: Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hg.), 1848/49. Revolution der deutschen Demokraten in Baden, Baden-Baden 1998, 291/292.]
In den Liedern heißt es dann ironisch: „Doch wenn jene ‚Macht von Gottes Gnaden‘ / Wieder mit Kartätschen uns umsprüht, / Singen wir ein stolzes Freiheitslied, / Und das Lied schützt unsre Barrikaden."
[Fn-260: A. Stobbe, Mit Gesange eilt der Mann zum Werke, in: Deutsche Lieder, 1849, Nr. 10.]
Die Freiheit ist aber das, was den Menschen als von Gott geschaffenes Wesen auszeichnet. Hoffmann von Fallersleben dichtet: „Das Ebenbild des Schöpfers kann nur der Freie sein" und folgert daraus: „Fluch sing' ich allen Zwingherrn, Fluch aller Dienstbarkeit!"
[Fn-261: Hoffmann von Fallersleben, Das Lied von der Freiheit, in: Demokratische Lieder, ges. v. Julius Schanz, Leipzig 1849, Nr. 16, 21/2 (künftig zitiert als: Demokratische Lieder, 1849).]
Der Herrscher, der seinem Volk die Freiheit raubt, vergeht sich gegen göttliches Gesetz und verhält sich, „[als] stünd' ein Mensch er zwischen wilden Thieren, / Nach denen seine Flinte zielt!"
[Fn-262: A. Platen, Es führt die Freiheit ihren gold'nen Morgen. 1831, in: Republikanische Lieder, 1851 b, 49, 86/7.]
Und so gelangt der nordfriesische „Odysseus der Freiheit"
[Fn-263: Walter Grab , Harro Harring. Ein revolutionärer Odysseus der Freiheit, in: Demokratische Geschichte 5 (1990), 53-67.]
Harro Harring schließlich zu dem Schluss: „Der Fürsten Göttlichkeit ist Lüge, / Im Bettler auch flammt Göttlichkeit!"
[Fn-264: Harro Harring, Auf, auf! ihr Deutschen lös'st die Bande, in: Deutsche Lieder, 1849, Nr. 14.]
Die fehlende göttliche Sendung des Fürsten erweist sich auch darin, dass die Herrschaft des Fürsten im Gegensatz zur Herrschaft Gottes den Menschen nicht zum Guten gereicht. So zerstört der Fürst beispielsweise auf der Jagd rücksichtslos den Ernteertrag des Bauern, der so sinnfällig Gottes Segen verkörpert. Dies verleitet den Bauern zu dem empörten Ausruf: „Ha, du wärst ‚Obrigkeit von Gott‘? / Er
[Seite der Druckausg.: 86]
spendet Segen aus, du raubst, / Du nicht von Gott, Tyrann!"
[Fn-265: G.A. Bürger, Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 83, 133/4.]
So bleibt von der jahrhundertealten göttlichen Legitimation des Fürsten in den Augen vieler Sänger besonders nach der blutigen Niederschlagung der Revolution nichts weiter mehr übrig als die Macht „von des Schaffottes Gnaden".
[Fn-266: Karl Scriba, Winter 1850, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 131, 212-214.]
Von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis aus dem von Gott eingesetzten Fürsten in der völligen Umkehrung der herrschenden Legitimation der Herrscher der Finsternis wird, so wie es in dem schon zuvor zitierten „Freiheitsgesang"
[Fn-267: Vgl. Anmerkung 253.]
aufscheint. Typische Kennzeichen dieses „dunklen" Herrschers sind das Laster und die Lust an der Grausamkeit als Gegenkräfte der göttlichen Ordnung. Er ist der babylonische Herrscher
[Fn-268: Deutsche Jugend an die Menge, in: Republikanische Lieder, 1851 a, Nr. 4, 7.]
, nur vergleichbar mit Nero, dessen Name Synonym für Grausamkeit und Perversität geworden ist.
[Fn-269: Alfred Meißner, An Friedrich Wilhelm IV., von Gottes Gnaden König von Preußen, in: Republikanisches Lieder-Buch, 1848, Nr. 58, 134/5.]
August von Platen stilisiert den Fürsten schließlich zum „Satan", den ein unterirdischer Chor nach vollbrachtem Völkermord besingt:
„Er schlürft begierig,
Ihm ist von Blut
Die Lippe schmierig,
Und als Begleiter,
Als Schmeichler stottern
Ihm Molch und Ottern
Loblieder vor:
Gesetzbefreiter
Monarchen Chor.
Er soll regieren,
Er soll den Thron
Der Hölle zieren!
Sein Reich in kalter
Beeister Sphäre,
Wie groß er wäre,
Ist viel zu klein;
Er soll Verwalter
Der Hölle sein."
[Fn-270: August von Platen-Hallermünde, Unterirdischer Chor, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 126, 204-207.]
[Seite der Druckausg.: 87]
Die Helfershelfer dieses teuflischen Herrschers sind seine „Knechte" und „Sklaven", d.h. diejenigen, die sich ihrer göttlichen Freiheit berauben ließen und damit selber das Menschenrecht beugten und sich gegen den Gott Natur vergingen.
[Fn-271: Frei sei das Wort, in: Republikanische Lieder, 1851 a, Nr. 53, 129/30.]
Daneben steht häufig die Anklage der „Pfaffen", die den Fürsten „hudeln"
[Fn-272: Z.B. Deutsche Jugend an die Menge, in: Republikanische Lieder, 1851 a, Nr. 4, 7.]
, seltener des Adels bzw. der „Junker".
[Fn-273: 1849, in: Demokratische Lieder, Nr. 9, 13/4.]
Voller Erbitterung wird auch immer wieder auf die „Söldnerrotten" verwiesen, die den Fürsten als „Schergen" bei ihrer blutigen Unterdrückung dienen.
[Fn-274: Alfred Meißner, An Friedrich Wilhelm IV., von Gottes Gnaden König von Preußen, in: Republikanisches Lieder-Buch, 1848, Nr. 58, 134/5 und Ed. Schulte, Erlösung, in: Republikanische Lieder, 1851 a, Nr. 54, 130-132.]
Diese Ablehnung der Söldner als willfährige Instrumente der Fürsten korrespondiert mit dem Ruf nach allgemeiner Volksbewaffnung, wie er 1848 laut erhoben wurde.
[Fn-275: Hans-Jörg Zerwas , 1988, 222.]
Es verbindet sich damit die Hoffnung, dass die Bürger-Soldaten erkennen: „Bürgerrechte sind zur Zeit / Auch der Unsern Rechte, / Und Gott will, daß der Soldat / Wacker sie verfechte."
[Fn-276: Soldatensinn der neuesten Zeit, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 26, 45/6. Vgl. dazu auch Rüdiger Hachtmann , 1998, 292.]
In den meisten Liedern erscheint das Volk demgegenüber als homogene und nicht näher bestimmte Masse, die für ihre „heil'gen Rechte" streitet. Politische Unterscheidungen werden nicht getroffen. Ein besonderes Kennzeichen dieses Volkes ist in vielen Liedern die Jugendlichkeit, da in der Jugend die Kraft zum Kampf vermutet wird.
[Fn-277: Ludwig Pfau, Aufruf an die Jugend 1848, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 11, 176/7.]
Darüber hinaus eignet sich die Vorstellung der Jugendlichkeit des Volkes auch, um sie als das Neue dem morschen, alten Bau der Monarchien gegenüberzustellen.
[Fn-278: Heinrich Zeise, Der deutsche Freizug, in: Republikanische Lieder, 1851 a, Nr. 12, 16-18.]
Dieses Selbstverständnis als „Jugendbewegung" ist im übrigen von den in der Tat meist jugendlichen Kämpfern und Sängern der Befreiungskriege übernommen worden, deren Lieder auch in die Liederbücher von 1848 zum Teil aufgenommen wurden.
[Fn-279: Karen Hagemann , „Heran, heran, zu Sieg oder Tod!" Entwürfe patriotisch-wehrhafter Männlich keit in der Zeit der Befreiungskriege, in: Thomas Kühne (Hg.), Männergeschichte - Geschlechter geschichte, Frankfurt a.M. / New York 1996, 51-68, hier: 58. Das eben genannte Lied von Heinrich Zeise ist zum Beispiel im Verlauf der Befreiungskriege gedichtet worden.]
In den Ende 1848 bzw. 1849 entstandenen Liedern zeigen sich bereits Brüche im Bild des einigen Volkes. Nicht alle, die die Freiheitshelden „bei vollem
[Seite der Druckausg.: 88]
Humpen" ehrten, standen später im Kampf „ihren Mann".
[Fn-280: Sulzer, Das Heckerlied, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 12, 23/4.]
Das Volk sieht sich treulos verraten von der Schar der „Zungendrescher" und Professoren, von „Deutschlands Schriftgelehrten", die sich nur zu schnell wieder in ihre Rolle als „Hofdemagogen" fanden.
[Fn-281: Stürmt ihr Glocken, ernste Mahner, in: Deutsche Lieder, 1849, Nr. 80, 121-123 und Hoffmann von Fallersleben, Das Lied von den Schriftgelehrten, in: Demokratische Lieder, 1849, Nr. 41, 51-53.]
Hier findet sich das bereits beschriebene Misstrauen gegenüber den Viel- und Schönrednern, den „Philistern", wieder, die im „Ernstfall" denken: „Was soll's, daß man sein Blut verspritzt? / Gott wird uns schon im Schlafe schenken, / Was uns zum Besten dient und nützt!"
[Fn-282: H.J. Frauenstein, Gott will's, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 4, 6-8.]
Die Enttäuschung über die langen, scheinbar nutzlosen Debatten im Parlament wird in einem Lied über „
Die alten Deutschen" noch einmal sehr deutlich ausgedrückt. Dort heißt es:
„Doch Schwatzen ohne Sinn und End'
War ihnen [den ‚alten‘ Deutschen]
unbekannt, fürwahr,
Dieweil das deutsche Parlament
Noch nicht in Frankfurt war."
[Fn-283: Lirpa, Die alten Deutschen, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 141, 226-228.]
Dieses Misstrauen gegenüber der Frankfurter Nationalversammlung griff in den Reihen der Arbeiterverbrüderung bereits im Spätherbst 1848 um sich und führte dazu, dass man nicht mehr nur - wie zuvor - die sozialen Forderungen, sondern nun auch die politischen Forderungen selbst vertrat. [Fn-284: Walter Schmidt , Arbeiterverbrüderung, soziale Emanzipation und nationale Identität 1848/49, in: BZG 36 (1994), 2, 20-36, hier: 29.]
Was aber die Liedersänger erreichen wollten, bleibt in den meisten Liedern unbestimmt. Neben dem hehren Eintreten für Freiheit und Recht stand die Republik bei vielen auf dem „Panier". Manchmal scheint die „Jagd auf das Kronengethier"
[Fn-285: Kölner der Saure, Hallo! zum wilden Jagen, in: Deutsche Lieder, 1849, Nr. 75, 114-116.]
bereits Ziel und Zweck des Liedes zu sein; die Abschaffung der Krone wird zum Garanten einer glücklicheren Zukunft so wie in einer Ballade Uhlands, in der eine ländliche Idylle beschrieben wird und dann der Blick auf die in einem Teich versunkene Krone mit den Worten gelenkt wird: „Sie liegt seit grauen Jahren, / Und niemand sucht nach ihr."
[Fn-286: Ludwig Uhland, Die versunkene Krone, in Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 55, 92/3.]
Konkre-
[Seite der Druckausg.: 89]
tere Vorstellungen kommen nur in oft erst nach dem Scheitern der Revolution gedichteten Visionen eines zukünftigen Staates zur Sprache. Dieser Staat sollte entsprechend den Vorstellungen, die vornehmlich von der liberal-demokratischen Bürgerbewegung artikuliert wurden, von der Freiheit des Einzelnen geprägt sein. [Fn-287: Vgl. Jürgen Kocka , 1998, 24-26.] So malt sich ein fröhlicher Zecher im Kreis seiner Freunde aus, wie die Welt aussehen könnte, wenn „ich sollte tragen der Herrschaft Last", und erzählt:
„Die Presse zuerst und die Wahlen frei,
Die Presse, sie dient mir als Polizei;
Wir schaffen uns bald vor den Mönchen Ruh',
Wir schicken die frömmsten dem Chaves zu;
Es mögen die Städte verwalten sodann - trink aus!
Die eig'nen Geschäfte, es geht die nur an, Trink aus!
Regieren nur wenig, das Wenige gut;
Die Liebe der Völker, da lieget die Kraft;
Die Freiheit hoch und ihr Haus."
[Fn-288: Und sitz' ich am Tische, in: Deutsche Lieder, 1849, Nr. 104, 157-159.]
Mit der Forderung nach Pressefreiheit und allgemeinem Wahlrecht, Selbstverwaltung und Wirtschaftsliberalismus sind einige der wichtigsten Ansprüche der Liberalen genannt. Der Dichter ironisiert den Enthusiasmus des vom Wein beseelten Träumers jedoch sehr offen, indem er zeigt, dass der „mutige" Freiheitskämpfer bereits vor der Hausmacht seiner eigenen Ehefrau kapituliert. So endet der Traum von der Freiheit hier auf privater Ebene ähnlich beschämend, wie er in der Sicht vieler Zeitgenossen auf politischer Ebene scheiterte und in der Person des verschlafenen Michel karikiert wurde.
[Fn-289: Karl Riha , Der deutsche Michel. Zur Ausprägung einer nationalen Allegorie im 19. Jahrhundert, in: Jürgen Link / Wulf Wülfing (Hg.), Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1991, 146-171, hier: 147.]
Der Zecher erwacht aus seinem Rausch und ruft angstvoll aus:
„Mein Weib wird mich schelten, mein Herrschen ist aus,
Ich schleiche mich leise, ganz leise nach Haus,
Zu Bett, zu Bett, zu Bett!
Daß sie den Pantoffel nicht hätt'!"
[Fn-290: Und sitz' ich am Tische, in: Deutsche Lieder, 1849, Nr. 104, 157-159.]
[Seite der Druckausg.: 90]
Auch der demokratisch gesinnte Literat Robert Prutz vermag 1849 seine Wunschvorstellung eines Staates nur noch in einem „Lügenmärchen" zu verbreiten. Dort heißt es:
„Jüngst stieg ich einen Berg hinan,
Was sah ich da!
Ich sah ein allerliebstes Land,
Der Wein wuchs an der Mauer,
Da gab's kein Thron, am Ruder stand
Der Bürgersmann und Bauer.
[…]
Und weiter stieg ich frisch hinan,
Was sah ich da!
Kein Lieutenant war, kein Fähnrich dort
Und kein Rekrut zu sehen,
Man wußte nicht das kleinste Wort
Von stehenden Armeen.
[…]
Und weiter frisch den Berg hinan,
Was sah ich da!
Das ganze liebe Land entlang,
In's Bad und auf die Messe,
Man reis'te frei und reis'te frank
Und brauchte keine Pässe.
[…]
Und wiederum ein Stück hinan,
Was sah ich da!
Ein Jeder durfte laut und frei,
Von Herzen räsonniren,
Man wußte nichts von Polizei
Und nichts von Denunziren.
[…]
Und noch ein Mal den Berg hinan,
Was sah ich da!
Die Volksvertreter, Mann für Mann,
Da ging's um Kopf und Kragen!
Da dachte kein Minister d'ran,
Den Urlaub zu versagen.
[…]
Und immer höher ging's hinan,
Was sah ich da!
[Seite der Druckausg.: 91]
Sah Poesie und Wissenschaft
Mit Lust die Schwingen breiten,
Und die Censur war abgeschafft
In alle Ewigkeiten.
[…]
Und weiter, weiter, frisch hinan,
Was sah ich da!
Ich sah die Weisen, Hand in Hand,
Wie sie der Lüge wehrten,
Und wie für Recht und Vaterland,
Mitkämpften die Gelehrten.
[…]
Und immer wieder ging's hinan,
Was sah ich da!
Im ganzen Lande keine Spur
Von Muckern und von Frommen,
Und Niemand kann durch Beten nur
In's Ministerium kommen.
[…]
Und nun zum letzten Mal hinan,
Was sah ich da!
Ein Jeder durft' auf eig'nem Bein
Die ew'ge Wahrheit suchen,
Kein Pfaffe durfte ‚kreuz'ge!‘ schrei'n
Und von der Kanzel fluchen.
[…]
Das ist gelogen!
Unterdessen nimmt mich's Wunder."
[Fn-291: Robert E. Prutz, Lügenmärchen, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 39, 65-71.]
Hier sind noch einmal die Hauptforderungen, die sowohl von der liberal-demokratischen Bürgerbewegung als auch von der Arbeiterverbrüderung erhoben wurden, zusammengefaßt. Dieser erträumte Staat ist noch Utopie, aber die Vision erscheint dem lyrischen Ich schließlich doch so überzeugend, dass es ihn „Wunder nimmt", dass dies „gelogen" sein sollte. So bleibt eine kleine Hoffnung auf die Zukunft.
Auf der metaphorischen Ebene finden sich viele der dargestellten Elemente wieder. Mit Vorliebe greifen die Sänger und Dichter von 1848 auf Naturme-
[Seite der Druckausg.: 92]
taphern zurück. Historische Figuren werden dagegen selten zum Vergleich herangezogen. Das Symbol der roten Fahne wird noch kaum benutzt.
Die Gegenüberstellung des „Frühlings der Freiheit" und des „Winters der Tyrannei" bietet sich aus verschiedenen Gründen an. Zum einen gibt es eine realhistorische Verbindung von Freiheit und Frühling, da die Freiheitsbestrebungen im Frühling 1848 artikuliert und in die Tat umgesetzt wurden. Es besteht also eine sogenannte metonymische Relation, die nach Ute Gerhard und Jürgen Link Voraussetzung für die „stabile[] Festlegung" eines Symbols ist.
[Fn-292: Ute Gerhard / Jürgen Link , Zum Anteil der Kollektivsymbolik an den Nationalstereotypen, in: Jürgen Link / Wulf Wülfing (Hg.), Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1991, 16-42, hier: 31.]
Tatsächlich bleibt der Frühling viele Jahre lang das Symbol der Freiheit. Der Frühling als Zeit der Saat und des Neubeginns weckt Assoziationen von Jugend und Licht, die in den Liedern häufig im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1848 genannt werden. Der Frühling ist aber auch gewalttätig, er kündet sich oft mit Sturm und Blitz an und bringt die gefürchteten Frühjahrshochwasser mit sich. Diese Fluten reißen unaufhaltsam das Eis des Winters mit sich fort; es ist sinnlos, das Eis gegen die Sonnenstrahlen des Frühlings schützen zu wollen. Dieses ganze, auf dem Dualismus von Frühling und Winter, Kälte und Wärme aufbauende Symbolsystem wird geradezu paradigmatisch in Freiligraths Gedicht über den „Eispalast" ausgeführt, das im ersten Teil auf der metaphorischen Ebene bleibt und das unaufhaltsame Schmelzen eines Eispalastes auf der Newa schildert, um im zweiten Teil die symbolische Bedeutung zu erhellen und festzustellen, das Ende des „Eispalastes der Despotie" stehe unmittelbar bevor: „Ihr sprecht den Lenz zum Winter nicht, / Und hat das Eis einmal gekracht, / So glaubt mir! daß es bald auch bricht!"
[Fn-293: Ferdinand Freiligrath, Der Eispalast, in: Republikanische Lieder, 1851 a, Nr. 61, 141-143. In diesem Gedicht wird noch eine zweite metonymische Relation deutlich: Das russische Zarenreich gilt als das Land der Despotie, die langen kalten Winter Russlands begünstigen die Verknüpfung von Kälte und Despotie.]
Hier wird deutlich, dass das Symbol des Frühlings auch Zukunftsgewissheit verkörpert, da der Frühling mit naturgesetzlicher Unausweichlichkeit den Winter überwinden wird. An das Bild der gewalttätigen und befreienden Fluten schließt sich die Vorstellung vom „ewig freien Meer" an, in das diese Fluten münden werden. So wird der Aufbruch von 1848 auch manches Mal als ein „in See stechen" imaginiert und mit dem realen und fiktiven Aufbruch in die „Neue Welt", nach Amerika, verbunden. Auch hier schuf Freiligrath mit seinem zur Melodie der Marseillaise gedichteten „Jenseits der grauen Wasserwüste" das weitverbreitete Vorbild.
[Fn-294: Ferdinand Freiligrath, Jenseits der grauen Wasserwüste, in: Deutsche Lieder, 1849, Nr. 7, 11-14 sowie Republikanische Lieder, 1851 a, Nr. 3, 4/5.]
[Seite der Druckausg.: 93]
Wärme und Kälte stehen natürlich auch für menschliche Wärme auf der einen und „Frostigkeit" bzw. Hartherzigkeit auf der anderen Seite. Auf den vorhergehenden Seiten wurde bereits beschrieben, wie diese menschlichen Eigenschaften im Kampf für die Freiheit instrumentalisiert wurden. Sonne und Licht im Gegensatz zu Nacht und Dunkelheit verweisen zum einen auf die religiöse Dimension, wie sie besonders im Streit um die göttliche Legitimation des Herrschers zum Tragen kam. Darum werden dem Herrscher auch gerne Tiere wie Molch, Otter, Krokodil und Schlange zugeordnet [Fn-295: August von Platen-Hallermünde, Klagelied der Verbannten, in: Republikanische Lieder, 1851 a, Nr. 43, 73-75; H.J. Frauenstein, Neujahrsgedanken, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 115, 182-185 und August von Platen-Hallermünde, Unterirdischer Chor, in: Republikanische Lieder, 1851 b, Nr. 126, 204-207.] , die in allegorischen Darstellungen als Geschöpfe der Hölle gelten. Licht ist aber seit der Aufklärung auch das Symbol des Geistes und der Vernunft, der in den Liedern von 1848 viel beschworenen Wahrheit.
2.1.2 „Brecht das Doppeljoch entzwei!" - Die Sozialdemokratie zwischen Kampf und Gesetz
Der Begriff des „Bruderbundes" steht auch in den zwischen 1863 und 1875 verfassten Gedichten und Liedern der Sozialdemokratie an zentraler Stelle. Der Charakter dieser Bruderliebe hat sich jedoch über die Jahre verändert. In den Liedern der sechziger und siebziger Jahre wird die Brüderlichkeit nicht mehr aus der in trauter Runde gelebten frohen Geselligkeit hergeleitet, sie hat viel von ihrer menschheitsverbindenden Anlage verloren, die 1848 noch in Grundzügen zu finden war. Die Gemeinschaft der sozialdemokratischen „Brüder" schließt nicht mehr nur jene aus, die sich voll Dünkel abheben wollen, sondern sie umfasst nunmehr nur noch jene, die sich ihr aus Überzeugung anschließen und dies mit einem Schwur bekräftigen. Dieser Gedanke ist besonders in den Liedern des ADAV präsent, in denen „im Geist des großen Gründers [Lassalle]" der bereits erwähnte Ronsdorfer Schwur immer wieder aktualisiert werden konnte.
[Fn-296: Prolog zur Stiftungsfeier des ADAV in Wüste-Waltersdorf, in: SD 30.6.1865, Nr. 78.]
Im Unterschied zu den Liedern von 1848 soll auch kein „Freiraum" außerhalb des Einflusses des Fürsten mehr geschaffen werden, in dem die Arbeiter als Könige selbst bestimmen können, sondern die Gesellschaft als ganzes soll verändert werden, man will zu Königen der Welt werden. Dies zeigt sich bereits im Aufbau der sozialdemokratischen Lieder und Gedichte. Die allermeisten tragen Aufforderungscharakter. Oft richten sie sich zunächst aus der Position des außerhalb der Gesellschaft stehenden, quasi-auktorialen Erzählers an ein „Ihr", die Brüder, um dann in der letzten
[Seite der Druckausg.: 94]
Strophe bzw. im Refrain voller Kampfes- und Siegesgewißheit zu einem kollektiven „Wir" zu wechseln. Beispielhaft läßt sich dies in folgender Strophe nachvollziehen: „Lassalle will's! Ihr habt geschworen! / Gesetzlich zwar, - doch fest zu stehn, / Drum Vorwärts, zu der Freiheit Thoren, / Sie öffnen, oder untergehn! / Und mag die Welt auch um Euch keifen, / Laßt schrei'n die Erstgeburt, das Geld, / Sind einig wir, soll'n sie begreifen, / Daß wir die Könige der Welt."
[Fn-297: Goßmann, Das preußische Siegesfest als Mahnruf an die Arbeiter, in: SD 5.10.1866, Nr. 156.]
Häufig sind auch Gedichte und Lieder, die ganz in der „Wir"- oder „Ihr"-Form geschrieben sind, sehr selten jedoch solche, die nur vom „Ich" oder vom distanzierten „Sie" berichten. Mit der Erzählung aus der Sicht des „Wir" befinden sich diese Lieder im Gegensatz zum eigentlichen Volkslied, in dem „seit dem mittelalterlichen Minnesang immer mehr ‚Ich-Lieder‘ kultiviert wurden, so daß schließlich ein Ich-Erlebnis zur typischen thematischen Grundlage des Volksliedes wurde."
[Fn-298: Vladimir Karbusicky , Ideologie im Lied, Lied in der Ideologie, Köln 1973, 10; zur Frage nach dem Volksliedcharakter der Arbeiterlieder vgl. auch Wolfgang Steinitz , Arbeiterlied und Arbeiterkultur, in: BZM VI (1964), 279-288, der als das eigentliche Kennzeichen des Volksliedes die „Aneignung, schöpferische [...] Umformung und Tradierung durch die Gemeinschaft" (284) erkennt.]
Sucht man nach inhaltlichen Bestimmungen dieses Bruderbundes, so finden sich vor allem fünf Begriffe: Arbeiter, Arme, Proletar / Proletariat, vierter Stand und Volk.
[Fn-299: In den Gedichten und Liedern der Bebel-Liebknecht-Richtung wird der Begriff „Proletar" allerdings selten, die Bezeichnung „vierter Stand" dagegen nie gebraucht, vgl. dazu auch Axel Körner , 1997, 191/2.]
In vielen Gedichten werden alle Begriffe als Synonyme gebraucht, so z.B.:
„Es tönt durch alle deutschen Gau'n
Des Volke's Ruf voll Selbstvertrau'n
O Sohn der Arbeit werde frei,
Stürz' die moderne Sclaverei! [...]
In jeder Stadt, in jedem Land
Erhebt sich schon der vierte Stand,
Sein Recht vertritt mit kühner That
Das deutsche Proletariat."
[Fn-300: Lied zur Fahnenweihe, in: NSD 27.8.1873, Nr. 98.]
oder :
[Seite der Druckausg.: 95]
„‚Zur Klasse, die den Fluch der Armuth trägt,
Zur vierten Klasse, die, enterbt, verstoßen,
Mit Sorgen aufsteht und zu Bett sich legt?‘ [...]
‚Uns, die die Last der sauren Arbeit tragen‘ [...]
Es werden furchtbar rächen sich die Sünden,
Die man begeht am göttlichen Geschlecht,
Am Volk [...]".
[Fn-301: E. Dehnke, An die deutschen Arbeiter als Wähler zum Parlament, in: SD 20.1.1867, Nr. 9.]
Im Vergleich mit den Liedern von 1848 ergeben sich vor allem zwei Schlussfolgerungen: Zum einen ist auffällig, dass die Selbstbezeichnung als „Arbeiter" sich weitgehend durchgesetzt hat, obwohl die Mitgliedschaft der Sozialdemokratie sich auch in den sechziger und siebziger Jahren noch hauptsächlich aus qualifizierten Handwerkern zusammensetzte.
[Fn-302: Thomas Welskopp , 2000, 69.]
Die zünftige Interpretation des Arbeiterbegriffs hat offensichtlich ihre Geltung verloren. Welskopp arbeitet in seiner Untersuchung des zeitgenössischen Arbeiterbegriffs heraus, dass die Übernahme dieses Konzeptes die „Arbeiter" ‚sozial und politisch bündnisfähig’ machte, da sie mit der Aufgabe traditionaler Zunftrivalitäten verbunden war und eine „kritische Vermittlung von Interessen zwischen Zunftangehörigen und Handwerkern, die außerhalb der Zunft standen", und auch zwischen ansässigen und „fremden" Gesellen ermöglichte.
[Fn-303: Thomas Welskopp , 2000, 151.]
Diese Interpretation wird durch den zweiten Unterschied gestützt: Wurde 1848 der Begriff „Volk" nur im Zusammenhang mit eindeutig politischen Forderungen gebraucht und die arbeitenden Männer in den allermeisten Fällen als eine Gruppe innerhalb der Gesellschaft beschrieben, scheinen die Begriffe „Arbeiter" und „Volk" in den späteren sozialdemokratischen Liedern immer stärker austauschbar zu werden. Es setzt sich also gemäß Lassalles „Offenem Antwortschreiben" unter den Sozialdemokraten immer mehr die Ansicht durch, dass die Arbeiter als eigentliches Volk zu gelten haben. Es wächst in diesen Jahren demzufolge unter den Sozialdemokraten gerade nicht die Erkenntnis, eine Klasse mit spezifischen Klasseninteressen innerhalb der Gesellschaft darzustellen, sondern die Überzeugung, die Interessen des ganzen Volkes zu repräsentieren.
[Fn-304: Vgl. dazu auch Cora Stephan, „Genossen, wir dürfen uns nicht von der Geduld hinreißen lassen!" Aus der Urgeschichte der Sozialdemokratie 1862-1878, Frankfurt a.M. 1977, 127, die aufzeigt, dass Lassalle den Begriff des „vierten Standes" in diesem Sinn gebraucht. Dies widerspricht der Auffassung Körners, dass die „Lieder […] ein Proletariat beschreiben, das sich von der Marktklasse zur sozialen Klasse entwickelt, sich organisiert und seine wirtschaftliche, politische und soziale Befreiung in der Gesellschaft erkämpft.", vgl. Axel Körner , 1997, 197. Möglicherweise trifft diese Interpretation eher für die nach 1878 entstandenen Lieder zu, da in diesen Jahren eine breitere Marx-Rezeption langsam einsetzt.]
Darum auch findet sich die politische Selbstbezeichnung als
[Seite der Druckausg.: 96]
Sozialisten oder Sozialdemokraten nur äußerst selten wie etwa in dem folgenden Lied: „Socialisten aller Landen, / O, reichet Euch die Bruderhand; [...] Drum auf Ihr Social-Demokraten, / Bringt Lassalle's Lehr' ein dreifach Hoch." [Fn-305: C. Ehmann, Verbrüderungslied, in: NSD 11.8.1871, Nr. 18.] Die Verwendung dieses Begriffes läßt sich hier sehr einfach erklären: Im Angesicht der blutigen Niederschlagung der Kommune kam es darauf an, die Solidarität mit den französischen Arbeitern zu beteuern; es ging also nicht um die politische Selbstverortung innerhalb des eigenen Volkes.
Die nähere Definition der Begriffe „Arbeiter", „Proletar", „vierter Stand" und „Volk" zeigt, wie die Gleichsetzung von „Volk" und „Arbeiter" begründet wurde. „Die Arbeit ist's, die diesem Bunde / Verleiht sonst nie geahnte Kraft, / Sie, die auf unserem Erdenrunde / Allein nur alle Werthe schafft." So heißt es 1873 in einem im Volksstaat abgedruckten Lied.
[Fn-306: G..., Lied der Internationalen, in: VS 9.7.1873, Nr. 56.]
1848 wurde die Arbeit in den Liedern zwar auch bereits positiv bewertet, der daraus abgeleitete Anspruch auf den vollberechtigten Bürger-Status wurde jedoch nur in einem einzigen Lied tatsächlich formuliert. Das Motiv der Arbeit als Produzentin aller Werte durchzieht dagegen einen Großteil der späteren sozialdemokratischen Lieder. Die Tätigkeit für das Gemeinwohl rechtfertigt so den Anspruch auf politische Mitwirkung. Neben dieser positiven Bewertung der Arbeit an sich steht die Darstellung der Arbeiter in ihrer Abhängigkeit. Sie werden als die Unterdrückten, die Sklaven und Knechte geschildert, die im Joch oder in den Fesseln der Arbeit gefangen sind. Damit wird auf ein auch in anderen westeuropäischen Ländern verbreitetes republikanisches Vokabular zurückgegriffen. Ihre Lebensverhältnisse widersprechen - so heißt es in den Liedern - damit ihrer ursprünglichen Bestimmung, frei zu sein; man hat sie ihres ureigenen Rechtes enterbt.
[Fn-307: Zum neuen Jahre, in: SD 10.1.1868, Nr. 5; Volksgesang, in: SD 12.7.1867, Nr. 81; G.D., Für Deutschland herbei!, in: SD 4.4.1866, Nr. 77; G. Kießling, Zur Todesfeier Lassalle's, in: NSD 13.9.1872, Nr. 106.]
Gleichzeitig drängt sich der Eindruck einer in Ketten gelegten Kraft auf. So werden die „kräft'gen Arbeitsmannen" zum Appell gerufen und die Feststellung getroffen: „In Ketten Mannesmark verdirbt, / Ummodert stets vom Fluche."
[Fn-308: G..., Zur Erinnerung an die Pariser Commune, in:VS 12.4.1873, Nr. 30 bzw. Reinhardt, Strike-Lied, in: VS 30.4.1870, Nr. 35.]
Die Arbeit in ihrer damals verbreiteten Form bedeutet nur Ausbeutung, denn: „Alle Kräfte und des Fleißes Stre-
[Seite der Druckausg.: 97]
ben / Hat des Reichen Kisten angefüllt."
[Fn-309: Zum neuen Jahre, in: SD 10.1.1868, Nr. 5; ähnlich z.B. Volksgesang, in: SD 12.7.1867, Nr. 81.]
Wie schon 1848 zielt die Kritik hauptsächlich auf die Arbeitsorganisation, doch wird dies nun zum Problem der gesamten Gesellschaft und nicht mehr nur einer Gruppe innerhalb der Gesellschaft.
So ergibt sich als „Hauptfeind" der „Enterbten"
[Fn-310: G. Kießling, Zur Todesfeier Lassalle's, in: NSD 13.9.1872, Nr. 106.]
nicht mehr der „Tyrann", sondern die „Bourgeoisie". Ihr werden die Eigenschaften zugeschrieben, die ehemals als Kennzeichen des Fürsten galten. Sie erscheint als betrügerisch und dekadent, sie schindet das „Volk der Arbeit" „bis auf's Blut".
[Fn-311: Reinhardt, Strike-Lied, in: VS 30.4.1870, Nr. 35; ähnlich auch z.B. G.D., Für Deutschland herbei!, in: SD 4.4.1866, Nr. 77 und J.B.v.H., Bonn, in: SD 12.8.1865, Nr. 115.]
Das Kapital tritt ausschließlich als „destruktive, antiproduktive Kraft" auf; kaufmännische Tätigkeit oder Managementverantwortlichkeiten werden den „Bourgeois" nicht als Arbeit zugestanden.
[Fn-312: Vgl. dazu Thomas Welskopp , 2000, 84f.]
Der „Geldsack" wird zum Symbol der Herrschaft der Bourgeoisie, die die Fürsten bzw. dann den Kaiser manches Mal vom Thron zu verdrängen scheinen - so etwa in folgendem Lied von A. Schults: „Einer sitzet auf dem Thron / Und hernieder voller Hohn / Blickt er, dieser Eine - / Der Geldsack, der Geldsack."
[Fn-313: A. Schults, Der Geldsack, in: VS 19.6.1872, Nr. 49.]
Zwar taucht auch in den Liedern der sechziger und siebziger Jahre der „Tyrann" oder „Despot" als Feindbild auf, verglichen mit den Liedern von 1848 wird er jedoch nicht mehr in der Weise als „Herrscher der Finsternis" gezeichnet. Sein Bild wird nicht mehr in vielen Facetten beschworen, sondern gerinnt fast zum formelhaften Begriff. Im Gegensatz zu den Forderungen von 1848 steht nun nicht mehr die Frage der Staatsordnung an oberster Stelle, sondern die Durchsetzung des Gleichheitsprinzips.
[Fn-314: Vgl. dazu auch Cora Stephan , 1977, 156/7.]
Nur in den Jahren 1870/71 tritt der Antagonismus Volk versus Herrscher stärker hervor, ein Gedicht namens „Soldatenlied" ruft den Arbeitern zu: „Auf, laßt uns zur Heimath zurückmarschieren, / Von den Tyrannen unser Volk befrei'n."
[Fn-315: Soldatenlied, in: VS 30.3.1870, Nr. 26.]
Und Georg Herwegh wendet sich ironisch an den König: „Du frommer Fürst auf Babels Thron, / So glaubensstark, so bibelfest, / Der, trotzend einer Nation, / Nach Gottes Wort uns köpfen läßt."
[Fn-316: Georg Herwegh, Schaffot - Zuchthaus, in: VS 1.6.1870, Nr. 44.]
Hier findet sich das vertraute Bild des verderbten Fürsten wieder, doch scheint es dabei weniger um die Auseinandersetzung über die göttliche Legitimation des Herrschers als vielmehr um eine moralische Entlarvung des Souveräns zu gehen. Als Prototyp des betrügerischen Herrschers erscheint in
[Seite der Druckausg.: 98]
diesen Jahren Napoleon III. [Fn-317: Vgl. z.B. G. Struve, Frankreichs Erlkönig, in: VS 7.9.1870, Nr. 72; Fr. Stoltze, Wilhelmshöhe, in: VS 8.10.1870, Nr. 81.] Wie schon 1848 tritt das „Pfaffentum" als Helfershelfer der Fürsten auf; es wird geradezu zum geflügelten Wort für Ausbeutung, Wohlleben und Heuchelei. [Fn-318: Vgl. z.B. Freiheitslied, in: VS 26.11.1870, Nr. 95.] „Adel" und „Junkertum" werden hingegen nur selten an den Pranger gestellt. [Fn-319: G.D., Für Deutschland herbei!, in: SD 4.4.1866, Nr. 77; W. Hasenclever, Unterschied, in: SD 22.4.1866, Nr. 85; G.A. Köttgen, Morgengruß, in: SD 19.12.1866, Nr. 188.] Im Vergleich zu 1848, wo die Gesellschaft in den Liedern entweder aus sozialer oder aus politischer Sicht beschrieben wurde, ergibt sich in den Liedern der sechziger und siebziger Jahre ein anderes Bild: Das Soziale wird immer mehr zum Politischen, und so überlagern sich beide Bereiche zunehmend. Nur in der Extremsituation des Krieges tritt die ausschließlich politische Perspektive kurzzeitig wieder hervor.
Die Tradition der Weberlieder wird auch in den sechziger und siebziger Jahren fortgeführt.
[Fn-320: H. Koller, Die schlesischen Weber, in: SD 19.3.1865, Nr. 36; A. Blaser, Gedanken eines schlesischen Lohnwebers in den Tagen seines Alters, in: SD 5.5.1865, Nr. 56; L. Petersen, An unsere Brüder, die schlesischen Weber, in: SD 7.4.1867, Nr. 43; vgl. dazu auch: Reinhard Dithmar , Arbeiterlieder. 1844 bis 1945, Neuwied u.a. 1993, 213-217.]
Diese meist in Balladenform gehaltenen Lieder zeichnen sich dadurch aus, dass in der sonst ungewöhnlichen Ich-Form die Vereinzelung und Entfremdung des Webers von der Natur, die Gleichförmigkeit seiner Tätigkeit und die unmenschliche Last der Arbeit, die ihn vom frühen Morgen bis zum späten Abend in der Stube fesselt, beschrieben werden. Dahinter steht - wie schon 1848 - das Motiv des ausgebeuteten und damit ungelebten Lebens, das in seiner Individualität gezeichnet wird, weil das somit provozierte Miterleben die Wirkung der Anklage verstärkt. Diese Lieder aus der Frühzeit der Industrialisierung finden im Social-Democrat und im Neuen Social-Democrat in den Balladen über die Fabrikkinder ihre Fortsetzung. Tatsächlich ist das zugrundeliegende Motiv das gleiche, nur die Kulisse hat sich verändert: Der Erzähler stellt uns im allgemeinen das Bild eines jungen Mädchens vor Augen, das der Maschinenwelt ausgeliefert ist. Dieses „Fabrikkind" kann sich nicht wehren, seine Ausbeutung erscheint darum auf der einen Seite umso grausamer, auf der anderen Seite wird der unausgesprochene Appell an die, die sich wehren können und den Kampf an seiner Stelle führen könnten, umso dringlicher. Die Titel deuten an, dass sich der Akzent seit 1848 von der Kritik an den Lebensverhältnissen der unqualifizierten, meist weiblichen
[Seite der Druckausg.: 99]
Arbeiter hin zur Anklage der Kinder-Fabrikarbeit verschoben hat. [Fn-321: Vgl. z.B. J.H. Vogl, Kinderleben, in: NSD 20.10.1871, Nr. 48 und Pützmann, Fabrikskind, in: NSD 19.8.1874, Nr. 95.] Dies könnte vor dem Hintergrund, dass die Kinderarbeit bis zur Mitte der siebziger Jahre drastisch zurückgegangen ist [Fn-322: Vgl. Jürgen Kocka , 1990, 470.] , erstaunen. Vermutlich erschien die noch verbleibende Beschäftigung von Kindern in den Fabriken aber gerade in dem Augenblick, als die gesetzlichen Bestimmungen zu ihrer Beschränkung zu greifen beginnen und sie demzufolge immer mehr zu einer Ausnahmeerscheinung wird, umso skandalöser.
Mit den Balladen über die Fabrikskinder betritt die Maschine die Bühne des Geschehens. Ihre Welt wird gleich einem die Sinne betäubenden Inferno von geradezu mythischer Dimension beschrieben: „Räder brausen, Spindeln sausen, / Schrauben knarren, Schaufeln scharren"; „Die Spindeln schwirren, sausen, / Des Dampfes Mächte brausen"; „Die Walzen rollen, die Räder rasseln, / Welch' dumpf Getös'! hochlodernd prasseln / Die wilden Flammen - knirschend reiben / Sich hundert Schrauben, und zischend treiben / Im Schlot die Dämpfe." [Fn-323: J.H. Vogl, Kinderleben, in: NSD 20.10.1871, Nr. 48; F. Teich, Die Maschinenspinnerin, in: NSD 5.7.1872, Nr. 76; Pützmann, Fabrikskind, in: NSD 19.8.1874, Nr. 95.] Diese Welt führt ein gefährliches Eigenleben, sie zwingt den Menschen, „eine lebende Maschine bis in seinen Tod zu sein." [Fn-324: J.H. Vogl, Kinderleben, in: NSD 20.10.1871, Nr. 48.] Jede Menschlichkeit - meist symbolisiert durch den Traum von Natur und Liebe - muss in den Tod führen, da sie dem Gesetz der Maschine nicht gehorcht. Interessanterweise trifft man in dieser Kulisse nie auf einen erwachsenen männlichen Arbeiter. Diese Beobachtung entspricht der Einschätzung Bogdals, dass in diesen Liedern und Gedichten bewusst die „‚Nichtigkeit‘ des proletarischen Alltags" negiert werde, um die Arbeiter umso besser als „kollektive[n] Heros" der Geschichte darstellen zu können. [Fn-325: Klaus-Michael Bogdal , 1996, 152.]
Die Fabrik als Zeichen des technischen Fortschritts, als mögliche Lebens-Welt, in deren Rahmen man sich organisieren und für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen kann, fehlt konsequenterweise fast völlig. Ein lustiges „Cigarrenlied" aus Berlin scheint hier einen ersten Ansatz zu wagen:
„Als Sclaven woll'n den Dreher wie
Den Wickler sie [die Fabrikherren, d. V.] verlachen.
Drum striken wir. [...]
So striken wir mit frohem Muth,
Gebeugt in keinem Falle: [...]
[Seite der Druckausg.: 100]
Ihr glaubt, daß Ihr mit Lug und List
Die Arbeitskraft zerstückelt?
Ihr Herrn, wenn Ihr nichts Beßres wißt,
Dann seid Ihr schief gewickelt!"
[Fn-326: Cigarrenlied, in: SD 26.2.1868, Nr. 25.]
In merkwürdigem Kontrast zu dieser überwiegenden Maschinenfeindlichkeit steht der unerschütterliche Glaube an Fortschritt und Zukunft durch Wissenschaft und Bildung. Voller Siegesgewißheit wird verkündet, dass dem Menschen alle Mittel zur Verfügung ständen, „der Schöpfung Meister zu werden", dass der Fortschritt unaufhaltsam „wie ein festes Gesetz des Weltenraumes" sei und dass des Menschen „wundervoller Geist" immer voranschreite und sich neue Welten erschließe. [Fn-327: W.H., Das goldene Kalb, in: NSD 30.9.1874, Nr. 113; Der Fortschritt, in: NSD 17.2.1875, Nr. 21; G. Weerth, Die Industrie, in: NSD 7.4.1875, Nr. 41.] Offensichtlich war dieser aus der Tradition der Aufklärung sich herleitende Fortschrittsglaube hier nicht verbunden mit der Idee, er könne durch technische oder organisatorische Neuerungen den Fabrikalltag menschlich gestalten. Der Fortschrittsgedanke konnte seine positive Kraft im Rahmen dieser Gedichte augenscheinlich gerade dadurch bewahren, dass der Fabrik- und Maschinenalltag nicht als Signum des Fortschritts gekennzeichnet, sondern vielmehr mit den „alten" Bildern der Hölle verknüpft und zum „Schreckensbild" schlechthin wurde. [Fn-328: Thomas Welskopp , 2000, 81.]
Neu ist im Vergleich zu 1848, dass die Sozialdemokraten der sechziger und siebziger Jahre ihre Lieder auch zur parteipolitischen Auseinandersetzung benutzten. Besonders im Neuen Social-Demokrat erscheinen Gedichte, die sich gegen die sozialdemokratische Schwesterpartei, die sogenannten Eisenacher „Ehrlichen" [Fn-329: E. Klingenberg, An die Eisenacher „Ehrlichen", in: NSD 5.9.1873, Nr. 102.] , wenden und deren Parteiorgan, den Volksstaat, zu diskreditieren suchen. In einem „Avis für den ‚Volksstaat‘„ heißt es so beispielsweise: „Werft mir in die heiße Pfütze / Ein paar faule ‚Volksstaat‘-Witze; / Bringt mir für den Blauen Dunst / Eine Unze ‚Volksstaat‘-Gunst. / Und daß der Gestank nicht fehle, / Eine Denunciantenseele." [Fn-330: K. Frohme, Avis für den „Volksstaat", in: NSD 14.5.1873, Nr. 56; auch: SD 22.9.1869, Nr. 111.] Die weitaus meisten Gedichte dieser Art richten sich jedoch gegen die Fortschrittspartei und ihren Hauptexponenten Hermann Schulze-Delitzsch. Die Konzepte der „Fortschrittler" werden im allgemeinen mit den Begriffen „Konsumverein" und „Sparverein" umrissen und mit dem Ziel ironisiert, ihre „Verlogenheit"
[Seite der Druckausg.: 101]
zu entlarven. So heißt es in dem bereits erwähnten, weit verbreiteten Lied „Sand in die Augen":
„Zu unserem Wohl, zu unserem Nutz und Frommen
Ist Schulze-Delitzsch in die Welt gekommen.
Der gute Mann beweist uns ganz geschwind,
Daß wir ja alle Kapitalisten sind. […]
Um Geld zu sparen und auch flott zu leben,
Muss man in den Consumverein sich geben.
Kaum daß man ein Jährchen darinnen ist,
So ist man schon ein kleiner Kapitalist."
[Fn-331: Sand in die Augen, in: SD 15.1.1865, Nr. 9.]
Den mit den Mitteln der Ironie und Satire lächerlich gemachten Vorstellungen des politischen Hauptgegners, der Fortschrittspartei, werden in anderen Gedichten und Liedern die eigenen Forderungen gegenübergestellt. Diese sind zum Teil sehr konkret wie etwa der Ruf nach Lohnerhöhung [Fn-332: Fabrikantenspiegel, in: VS 16.4.1870, Nr. 31.] , nach einem Feiertag [Fn-333: Reinhardt, Strike-Lied, in: VS 30.4.1870, Nr. 35.] , nach freier Presse und Abschaffung des stehenden Heeres [Fn-334: Th.Fr.Pr./G.B.-L., Wählerlied, in: VS 25.2.1871, Nr. 17.] oder die Ablehnung von Polizeiwillkür, Wohnungsnot und Steuerlast [Fn-335: Der sächsische Landtag, in: VS 17.9.1873, Nr. 86.] . Solche Forderungen treten jedoch außerordentlich selten auf. Wesentlich häufiger findet sich der Ruf nach einer Zukunft, die durch gleiches Recht, freies Menschentum und Frieden bestimmt sein soll. [Fn-336: Ein Lied vom Hochverrathsprozeß, in: VS 25.5.1872, Nr. 42; Freiheitslied, in: VS 26.11.1870, Nr. 95; Fr.W.Gr..., Gruß zum Neuen Jahr, in: VS 10.1.1872, Nr. 3.] Ein Großteil aller dichterischen Äußerungen gipfelt in einer vagen Zukunftsvision, in der die Begriffe Freiheit, Gleichheit und (Menschen-)Recht ähnlich einer Beschwörungsformel immer wieder auftauchen. So heißt es in einem Gedicht mit dem Titel „Aufforderung zum Klassenkampf": „Seht frei im Winde flattert unser Banner, / Fort soll der Fluch, fort sollen Noth und Jammer, / Denn unser Ziel ist: Freiheit, Gleichheit, Recht." [Fn-337: G.H. Schnaue, Aufmunterung zum Klassenkampf, in: SD 1870, Nr. 1.7.75; dieses sei beispielhaft für eine Vielzahl anderer genannt.] Oft tritt an die Stelle des Rechtes auch die Bruderliebe, und der Appell ertönt: „Für Freiheit, nicht für Massenmord, / Für Gleichheit, nimmer Tyrannei, / Für Bruderlieb', nie Sclaverei!" [Fn-338: A. Leißring, Das größte, wahre Wort!, in: NSD 17.10.1873, Nr. 120.] Diese Werte werden so gut wie nie näher expliziert; sie ähneln mehr einem Schlachtruf, der begeistern und Mut machen soll.
[Seite der Druckausg.: 102]
Über den Weg in die Zukunft herrscht keineswegs Einigkeit. Die Einheit als alles überwindende Kraft wird allerdings immer wieder beschworen, manchmal gewinnt man geradezu den Eindruck, als sei dies der magische Schlüssel zum Sieg der Arbeiter, denn: „gegen Euch führt Ihr den Krieg, / wenn Einigkeit gebricht: / D'rum handelt einig, brüderlich, / Bis Ihr am Ziele steht; / Nicht schmieden läßt in Fesseln sich / Der Einheit Majestät!"
[Fn-339: G.D., Für Deutschland herbei!, in: SD 4.4.1866, Nr. 77; auch: Gedicht, in: SD 5.4.1865, Nr. 43; Prolog Prolog zur Stiftungsfeier des ADAV in Wüste-Waltersdorf, in: SD 30.6.1865, Nr. 78; F. Polling, Allarmsignal, in: SD 27.1.1867, Nr. 12, Beilage; Volksgesang, in: SD 12.7.1867, Nr. 81; Zum neuen Jahre, in: SD 10.1.1868, Nr. 5; W. Hasenclever, Neujahrsgruß, in: SD 3.1.1869, Nr. 2; An J.F. Richter, Chefredakteur der Hamburger „Reform", in: SD 29.9.1869, Nr. 114; W. Hasenclever, Unsere Sache ist die Sache der Menschheit, in: SD 31.8.1870, Nr. 101.]
Doch auch vom Kampf ist immer wieder die Rede, gemeint ist aber meist unmissverständlich der Kampf mit Wort und Gesetz, mit „des Geistes Keulenschlägen".
[Fn-340: A. Hinze, Ein Gedicht zum Geburtstag Lassalle's, in: SD 5.5.1865, Nr. 56; Goßmann, Das preußische Siegesfest als Mahnruf, in: SD 5.10.1866, Nr. 156; An die Dichter unserer Partei, in: SD 6.1.1867, Nr. 3; R. Falkenberg, An das Proletariat, in: SD 28.8.1867, Nr. 101; St. Str..., Der Geist Lassalle's, in: SD 12.1.1868, Nr. 6; Weiß, Aufruf an die Arbeiter, in: SD 29.4.1868, Nr. 51 (hier das schöne Bild des ADAV als Schiff im Sturm, dessen Steuerruder die Gesetzlichkeit, der Talisman die Einigkeit und der Kompass die Lehre von Lassalle ist), C. Ehmann, Verbrüderungslied, in: NSD 11.8.1871, Nr. 18.]
Dies entspricht den an anderer Stelle dargestellten Vorstellungen Lassalles, der eine friedliche Veränderung der Gesellschaft durch die Errichtung von Produktivassoziationen und die Einführung des allgemeinen, gleichen und geheimen Männerwahlrechtes zu erreichen hoffte.
[Fn-341: Vgl. auch Cora Stephan , 1977, 148.]
Selten ist die Beschwörung des Kampfes verbunden mit der Anrufung der Vernunft auf seiten der Gegner, so wie es 1872 in einem „Gruß zum Neuen Jahr" formuliert wird:
„Mög' nun die Zeit die schroffen Herzen lindern,
Denen Macht und Reichtum stets die Mittel bot,
Mit Einsicht und Erkenntniß einzuführen,
Bald Lind'rung der Bedrängnis und der Noth.[...]
Steht Brüder Alle treu und fest zusammen
In Einigkeit, stets geistig hell und klar."
[Fn-342: Fr.W.Gr..., Gruß zum Neuen Jahr, in: VS 10.1.1872, Nr. 3; ähnlich: Wird denn blos Komödie gespielt, in: VS 23.3.1870, Nr. 24; L. Geffers, Dem Congreß, in: VS 29.6.1870, Nr. 52.]
[Seite der Druckausg.: 103]
Der Kampf für Freiheit, Gleichheit und Recht wird oft in Metaphern des Feuers und Gewitters umschrieben, so dass manches Mal unklar bleibt, ob es sich um einen Kampf mit den Waffen des Geistes oder mit den tödlichen Waffen des Krieges handeln soll, besonders da auch hier oft der Hinweis auf den Verstand nicht fehlt. Die Steigerung ins Mythische bzw. Apokalyptische - wie im folgenden Zitat - ist jedoch selten:
„Gar herrlich wohl der Funken glüht,
Vernunft faßt das Gehirn;
Die schwarze Nacht, die Dummheit flieh
Dem leuchtenden Gestirn.
Und eine Flamme schlägt empor –
Hört ihr den grellen Ton? –
Der Moloch wohl vor Schreck verlor
Die Larve und die Kron'.
Es ringt der Moloch um den Sieg
Und säet Zwietracht aus,
Doch zeugt Vernunft nicht blut'gen Krieg –
Sie baut ein freies Haus.
Und bringt sein letzter gift'ger Hauch
Mord, Schrecken in das Land,
Und sengt er Gut und Habe auch –
Uns bleibt doch der Verstand!"
[Fn-343: Freiheitslied, in: VS 26.11.1870, Nr. 95; auch: Reinhardt, Strike-Lied, in: VS 30.4.1870, Nr. 35.]
Ab 1871 werden die Bilder durch die Anknüpfung an den Kampf der Kommune eindeutiger; sie gilt als die „erste Schlacht im großen Krieg"
[Fn-344: Befreiungs-Lied, in: VS 22.7.1871, Nr. 59.]
, das Fanal für die „wahre Völkerschlacht", geführt von „den Manen der Helden."
[Fn-345: E.K., In Memoriam, in: VS 12.6.1872, Nr. 47; ähnlich: An Euch, Pariser Brüder!, in: VS 14.6.1871, Nr. 48; A. Seib, 1871, in: VS 17.6.1871, Nr. 49; Befreiungs-Lied, in: VS 22.7.1871, Nr. 59, G..., Zur Erinnerung an die Pariser Commune, in: VS 12.4.1873, Nr. 30.]
Herwegh ruft den Freiheitssängern zu: „Darum legt die Harfen ab, / Laßt darin die Windsbraut spielen! / Unser warten Thermopylen, Perser - / und im Schatten manch' ein Grab."
[Fn-346: G. Herwegh, Zuruf, in: NSD 12.5.1872, Nr. 55, Beilage.]
Und es folgt die Drohung: „So wird es zünden, / Und äschert Städt' und Länder ein."
[Fn-347: F. Futzener, Arbeiterschwur am Geburtstage Ferdinand Lassalle's, in: NSD 11.4.1873, Nr. 43.]
Daneben finden sich jedoch
[Seite der Druckausg.: 104]
stets Aufrufe zum reinen Geisteskampf. Dennoch wird die Möglichkeit eines tatsächlichen Kampfes immer wieder ins Auge gefasst. Die starke Stilisierung dieses Kampfes (nach antikem Vorbild, nach dem Vorbild der Kommune, in Naturmetaphern) lässt jedoch Zweifel aufkommen, ob die beabsichtigte ästhetische Wirkung nicht mehr einer pseudo-revolutionären Emphase als einem radikalen Kampfeswillen entspricht. [Fn-348: Zu einem ähnlichen Schluss gelangt Axel Körner , 1997, 216-219. Zweifelhaft erscheint jedoch sein Argument, dass es sich allenfalls um „revolutionäre Programmatik, kaum aber [um] revolutionäre Erfahrung" gehandelt haben könne (217), da es wenig „personelle[] Kontinuitäten" gegeben habe (227). Nicht nur der von Körner genannte Georg Herwegh beteiligte sich an der Revolution von 1848. Eine ganze Reihe derjenigen, die in den sechziger und siebziger Jahren sozialdemokratische Führungspositionen einnahmen, waren 1848 als Arbeiterführer oder radikale Demokraten in Erscheinung getreten, vgl. Werner Conze / Dieter Groh, Die Arbeiterbewegung in der nationalen Bewegung, Stuttgart 1966, 41. Zu nennen wären u.a. Ferdinand Lassalle, Carl Wilhelm Tölcke, Bernhard Becker, Wilhelm Liebknecht, Johann Philipp Becker, Hugo Hillmann und Friedrich Wilhelm Fritzsche; einige betätigten sich auch als Gelegenheitsdichter.]
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Rolle die tatsächliche Revolution von 1848 in den Liedern und Gedichten der Sozialdemokraten spielte. Die Durchsicht der Zeitungen ergibt, dass in den siebziger Jahren vor allem um den 18. März Gedichte und Lieder abgedruckt wurden, die auf die Ereignisse von 1848 Bezug nahmen. [Fn-349: Im SD und NSD, den Zeitungen des ADAV, finden sich diese „März"-Gedichte jedoch äußerst selten. Möglicherweise trat hier der Lassalle-Kult an die Stelle der historischen Tradition.] So heißt es in einem Herwegh-Gedicht 1873: „Noch sind nicht alle Märzen vorbei." [Fn-350: G. Herwegh, Achtzehnter März, in: 26.3.VS 1873, Nr. 25.] Ein anderes Gedicht läßt Robert Blum, aus dem Grab entstiegen, in einer „nächtlichen Heerschau" den Verrat so vieler „Freiheitsfreunde" exemplarisch in der Gestalt seines eigenen Sohnes Hans Blum entdecken. [Fn-351: Die nächtliche Heerschau, in: VS 4.11.1874, Nr. 129.] Am interessantesten ist vielleicht ein dichterischer „Nachruf" auf einen gefallenen Kämpfer von 1848/49, der von seinen Freunden 25 Jahre nach dessen Tod verfasst wurde. In diesem Gedicht wird eine „Erfolgsgeschichte" der Sozialdemokratie von den Kämpfen im Jahre 1848 bis zur Gegenwart der Dichter konstruiert:
„Du Held der Freiheit, Deines Lebens würdig,
Du fand'st den schönen Tod für's Vaterland;
Ja, den Genossen warst Du ebenbürtig,
Die einst die wahre Freiheitsgluth verband! [...]
[Seite der Druckausg.: 105]
Doch was prophetisch Du dereinst gesungen,
Schon halb (??) erfüllt ist es in uns'rer Zeit;
Wir haben alle kühn danach gerungen,
Was wir erstrebt, lehrt die Vergangenheit."
[Fn-352: J.U.B., Nachruf, in: VS 30.9.1874, Nr. 114.]
Auch wenn man nicht vergessen darf, dass es nur vergleichsweise wenige Gedichte dieser Art gibt, so scheint sich in diesen Gedichten doch ein gewisses Bedürfnis auszudrücken, sich innerhalb einer Traditionslinie zu sehen, die vom Jahr 1848 bis zum Kampf der Sozialdemokraten gegen die zunehmenden Repressionen der siebziger Jahre reicht. Der Bezug zu 1848 erscheint als eine Art Verpflichtung gegenüber den Toten, den einmal begonnenen Kampf zu einem Ende zu führen, bzw. als Maßstab, an dem man die Lebenden messen muss. Ab 1871 taucht auch die Französische Revolution im Zusammenhang mit der Kommune auf, die als deren gescheiterte Fortsetzung begriffen wird: „Und 89 wird ein Traum. / Ein Traum? - Du sahst, wie Frankreich fiel / Durch einen Cäsar, sahst die Sühne / Vollzogen auf der Schreckensbühne. - / Deutschland, gedeihe, wachse, grüne, / Geläutert durch dies Trauerspiel!" [Fn-353: G. Herwegh, Epilog zum Kriege, in: VS 30.6.1875, Nr. 73.] Diese Revolution ist den Volksstaat-Lesern aber offensichtlich so wenig präsent, dass die Herausgeber es für notwendig hielten, „89" mit einem Sternchen zu versehen und zu erklären: „Die Französische Revolution, die 1789 begann." Man kann darum mit Recht annehmen, dass die Französische Revolution keinen Bezugspunkt darstellte, dass aber auch die deutsche Erhebung von 1848 nur eingeschränkt als emotional verpflichtende Tradition gesehen wurde, da sie einerseits vergleichsweise selten genannt und andererseits kaum je ins Heldenhafte stilisiert wird.
Neben dieser historischen Tradition ist Ferdinand Lassalle als Identifikationsfigur zu nennen. Dies gilt - wie bereits dargelegt wurde - im besonderen für die Mitglieder des ADAV, in deren Gedichten und Liedern er bis etwa 1874 unangefochtenes und omnipräsentes Leitbild ist. Einen vergleichbaren Personenkult findet man trotz der „Heckerlieder" und den Gedichten und Liedern auf den Ende 1848 in der Brigittenau bei Wien hingerichteten Robert Blum für 1848/49 nicht. Lassalle wird dagegen durchgehend als der große Führer oder „Vater" [Fn-354: G. Herwegh, Am Grabe Ferdinand Lassalle's, in: NSD 8.9.1876, Nr. 104.] des Volkes dargestellt, der das Volk mit dem „Schwert des Geistes", mit seiner geradezu übermenschlichen geistigen Kraft, aus dem „Schlaf der Unwissenheit" geweckt hat:
[Seite der Druckausg.: 106]
„Uns stirbt er nie, der mächtige Titan,
Der uns gewann im Feuer seiner Rede,
Der uns befreit von Finsterniß und Wahn,
Der Licht gebracht in unsrer Zeiten Oede! [...]
Wie er den Weg zu aller Herzen fand,
Wenn er sein Schwert der freien Rede zückte";
„Ermanne Dich! - Der Geistesriese
Lassalle rief uns die Mahnung zu, [...]
Mit seines Geistes Keulenschlägen
Zertrümmert' er den eitlen Wahn."
[Fn-355: Prolog zum Stiftungsfest des ADAV in Berlin, in: SD 24.5.1865, Nr. 64; Fritzsche, Prolog zum 2. Stiftungsfeste des ADAV, in: SD 17.5.1865, Nr. 61; E. Dehnke, An die deutschen Arbeiter als Wähler zum Parlament, in: SD 20.1.1867, Nr. 9.]
Sein Tod wird als Verpflichtung zum Kampf begriffen, da er für die heilige Sache gestorben sei (wobei mit keinem Wort erwähnt wird, dass er eigentlich in einem Duell um eine Frau, Helene von Dönniges, getötet wurde).
[Fn-356: G. Kießling, Zur Todesfeier Lassalle's, in: NSD 13.9.1872, Nr. 106; G. Herwegh, Am Grabe Ferdinand Lassalle's, in: NSD 8.9.1876, Nr. 104. Vgl. zur Biographie Lassalles: Shlomo Na'aman , Lassalle, Hannover 1970.]
Seine „Lehre" ist das Banner, unter dem die Arbeiter kämpfen (das Epitheton „rot" hat eine wesentlich geringere Bedeutung in den Gedichten und Liedern als eben dieser Name): „Das Banner uns Lassalle's Lehre sei!"
[Fn-357: Lied, in: SD 10.12.1869, Nr. 145.]
Man gewinnt manchmal geradezu den Eindruck, als sei die geistige und emotionale Heimat dieser Arbeiter mit dem Namen Lassalle umschrieben. Diese Annahme wird z.B. gestützt durch ein Lied, das zur Melodie „Was ist des Deutschen Vaterland?" gesungen werden soll und die Struktur des parodierten Liedes bewusst mit der Leitfrage „Wer sprach das größte, wahre Wort?" aufnimmt, um die Antwort zu geben: „Es war der große Volkstribun, / Dessen Gebein' in Breslau ruh'n! / Er ist's! Er ist's! nur er allein! / Der Ferdinand Lassalle soll's sein!"
[Fn-358: A. Leißring, Das größte, wahre Wort!, in: NSD 17.10.1873, Nr. 120.]
Ähnlich wirkt folgende Strophe zur Choralmelodie „Ich hab' mich ergeben": „Du ruhest im Grabe / Und lebst dennoch fort - Ja, was ich bin und habe, / Das dank' ich Dir, mein Hort."
[Fn-359: Zu Lassalle's Todesfeier, in: NSD 31.8.1873, Nr. 100.]
Mit den Jahren gewinnt das Bild Lassalles immer stärker religiöse bzw. messianische Züge. Werden 1865 diese Anspielungen noch mehr oder weniger explizit als Vergleiche gekennzeichnet (so in einem Gedicht über Bonifatius: „Ist's nicht ein treues Bild vom Ringen / Des großen Ferdinand Lassalle?" bzw. durch die Bezeichnung „Ar-
[Seite der Druckausg.: 107]
beiterheiland" und „Arbeiterbibel" [Fn-360: Prolog zur Stiftungsfeier des ADAV in Wüste-Waltersdorf, in: SD 30.6.1865, Nr. 78; O. Hippe, Wir Arbeiter aber, wir siegen doch, in: SD 7.9.1865, Nr. 137.] ), so wird er später immer öfter als Meister, Retter und Heiland apostrophiert, dessen Jünger die Arbeiter sind, ohne dass die Metapher als solche kenntlich gemacht wird. So heißt es z.B. in einem zum Stiftungsfest 1867 gedichteten Lied: „‚Haltet fest am Bunde!‘ / Sterbend rief's Lassall'. / Wort von Meisters Munde / Sei kein leerer Schall!" [Fn-361: Lied zum Stiftungsfest, in: SD 10.5.1867, Nr. 56.] An dem letzten Zitat wird deutlich, dass die Christusparallele z.T. über die bloße Benennung hinausgeht; der Missionsbefehl Christi an seine Jünger wird ebenso nachgeahmt wie das Motiv des neuen Bundes in Jesus (hier natürlich in Lassalle: „Mit Kraft wird dann der Bund erneut / In Ewigkeit!" [Fn-362: Lassalia's Weckruf, in: NSD 30.4.1873, Nr. 50; vgl auch: E. Schatzmeyer, Pfingsten, in: NSD 19.5.1872, Nr. 58.] ), das Jesus-Gleichnis des Sämanns („Ist auch der Säemann gefallen, / In guten Boden fiel die Saat" [Fn-363: J. Audorf, Lied der deutschen Arbeiter, in: NSD 8.5.1874, Nr. 53.] ) oder die Nacherzählung der Biographie Lassalles nach dem Modell des Lebens Jesu [Fn-364: Zu Lassalle's Todesfeier, in: NSD 31.8.1873, Nr. 100.] . Dass die Verehrung Lassalles teilweise Züge eines Glaubens angenommen hat, macht noch einmal die Einsendung eines Arbeiters deutlich, der als Kommentar zu seinem Gedicht schreibt, dass er seit dem Tod Lassalles an die geistige Auferstehung glaube, und dann sein Gedicht mit den Worten beginnt: „Lassalle schallt's, als ob es Engel riefen, / Lassalle tönt es hoffend hier wie dort, / Lassalle klingt es aus der Seele Tiefen, / Lassalle hallt's in fernsten Landen fort. (Hervorhebung d.V.)" [Fn-365: Gedicht auf Lassalle, in: NSD 20.8.1871, Nr. 22.] Die allermeisten Gedichte vollziehen diesen Schritt zum Lassalle-Kult im eigentlichen Sinn des Wortes jedoch nicht. [Fn-366: Vgl. auch die Ausführungen in Kapitel 1.2.3.]
In stilistischer Hinsicht folgt die Mehrzahl der Lieder, besonders aber die Lieder des ADAV, einem Liedaufbau, den Karbusicky als die „mythologische Methode" bezeichnet hat. [Fn-367: Vladimir Karbusicky, 1973, 45-68.] Diese Lieder bedienen sich eines Vier-Akte-Schemas, das eine ideologische Antwort auf die vier elementaren Existenzfragen (Wo bin ich? Was bin ich? Was treibt mich? Wohin gehe ich?) bietet. So wird im ersten Teil die Realität auf die suggerierte Kampfsituation reduziert; die Masse, das Wir („die Brüder"), der Führer (Lassalle) und die Zeichen der Bewegung („das Geistesschwert") stehen im Vordergrund. Im zweiten Akt wird die Not und Schwäche des „Wir" demonstriert („Arbeiter als Sklaven und Knechte"), um zu Einheit und Treue zu mahnen. Der dritte Abschnitt beschreibt den Feind („die Bourgeoisie"), der sich im Widerspruch zu
[Seite der Druckausg.: 108]
den postulierten ethischen Tugenden („Freiheit", „Gleichheit", „Bruderliebe" und „Wahrheit") befindet. Der vierte Teil - oft auch in Form eines Refrains - ruft zum Kampf auf, malt eine paradiesähnliche Zukunft an den Horizont (die Zukunftsvision absoluter Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit) und huldigt dem messianischen Retter Lassalle. Wenn auch in den hier untersuchten Gedichten und Liedern die Kategorie des Feindes, die Karbusicky in dieser Konstruktion für entscheidend hält, nicht so stark ausgeprägt ist, so folgen diese Lieder doch im großen und ganzen der mythologischen Methode. Die vergleichsweise schwache Ausmalung des Feindes wurde eventuell durch die stärkere Betonung des Führers bzw. Retters, nämlich Lassalles, ausgeglichen. Nach Ansicht Karbusickys stellt die mythologische Methode „ein dämonologische[s] Substrat alter Mythologien [dar] [...], das den Menschen unbemerkt mit Hilfe vertrauter religiöser Denkmodelle gerade zur Umkehrung der christlichen Ethik führt. [...] Die Ritualakte, die Tabus, der Fetischismus, die Beschwörungsformeln, die Aktualisierung der charismatischen Betrachtung der Parteiführer und andere mythologische Prinzipien sind gesetzmäßige Existenzformen der modernen Ideologien." [Fn-368: Vladimir Karbusicky, 1973, 46/47.]
Eine ähnliche Struktur läßt sich in den Gedichten und Liedern von 1848 nur ansatzweise finden. Hier fehlt vor allem die starke Betonung des „Wir" in Verbindung mit der Kampfsituation. Allerdings vermitteln die politischen Lieder von 1848 stärker als die späteren sozialdemokratischen Lieder den Eindruck, als wohne man dem entscheidenden Kampf zwischen Gut und Böse bei. Dies läßt sich vermutlich dadurch erklären, dass in den demokratisch-republikanischen Liedern zu einer völligen, möglicherweise auch gewaltsamen Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse mit dem Ziel der Errichtung einer Republik aufgerufen werden sollte, während die sozialdemokratischen Lieder und Gedichte sich trotz aller kämpferischen Metaphern zum gesetzlichen Kampf innerhalb des bestehenden Systems bekennen.
Allerdings knüpft die sozialdemokratische Lyrik sprachlich und formal an die Lyrik des Vormärz und der Revolution von 1848 an bzw. ahmt diese weitgehend nach. Typisch ist vor allem die Abbildung der erwünschten revolutionären Veränderung auf Naturereignisse. Hier erfreuen sich besonders jene Naturbereiche besonderer Beliebtheit, die Gesetzmäßigkeiten und Unaufhaltsamkeit symbolisieren. [Fn-369: Vgl. Klaus-Michael Bogdal , 1996, 170.] Dazu gehören insbesondere der jahreszeitliche Wechsel vom Winter zum Frühling, der naturgeschichtlich das unausweichliche Ende der Reaktionszeit durch eine revolutionäre Umwälzung vorzeichnen soll, sowie der Rückgriff auf die Metaphern von „Sturm" bzw. „Gewitter" und „Flut". Die sozialdemokratische Dichtung unterscheidet sich damit deutlich von der zeitgenössischen Literaturströmung des bürgerlichen Realismus,
[Seite der Druckausg.: 109]
dessen „latente[s] Krisengefühl" sie nicht teilt. [Fn-370: Klaus-Michael Bogdal , 1996, 162.] In ihrer idealistischen Grundhaltung ähnelt sie dagegen stark der sogenannten epigonalen Literatur der Gründerzeit, zu der auch die hier untersuchte Lyrik aus der Vossischen und der Kreuz-Zeitung zu rechnen ist. Mit dieser Literaturströmung teilt sie vor allem das kriegerische Vokabular und die „Sakralisierung der eigenen Bewegung" [Fn-371: Klaus-Michael Bogdal , 1996, 163.] . Auf diese Ähnlichkeit der literarischen Mittel weist Bogdal in seiner Studie über die Arbeiterliteratur des 19. Jahrhunderts vor allem anhand der Figur Ferdinand Freiligraths hin, der - so Bogdal - bei seinem „Übergang von der sozialistischen Dichtung zur nationalistischen Epigonenlyrik […] seinen lyrischen Produktionsapparat unverändert lassen konnte und nur minimale semantische Verschiebungen vornehmen musste". [Fn-372: Klaus-Michael Bogdal , Zwischen Alltag und Utopie: Arbeiterliteratur als Diskurs des 19. Jahr hunderts, Opladen 1991, 130.] Bezieht man allerdings die literarische Wirkintention der Dichter in die stilistische Beurteilung ein, so ergibt sich ein entscheidender Unterschied, auf den Bernd Witte zu Recht hingewiesen hat: Im Gegensatz zur hohen und trivialen Literatur dieser Zeit, die sich vornehmlich der Darstellung des Subjektiven, der Empfindungen und Erlebnisse des Einzelnen widmet, „gewinnt die frühe Arbeiterliteratur […] eine soziale Kommunikationsfunktion zurück, welche die hohe Literatur seit der Aufklärung immer mehr eingebüßt hatte." [Fn-373: Bernd Witte , 1977, 15.] Dieser Wunsch nach Kommunikation zwischen Dichter und Leser zeigt sich vor allem an der bereits dargestellten dichotomischen Anordnung des „Wir" und „Ihr", die den Zuhörer dazu zwingt, Stellung zu beziehen, d.h. sich dem kollektiven „Wir" anzuschließen oder sich dieser Vereinnahmung zu verweigern. Darüber hinaus wenden sich viele sozialdemokratische Gedichte direkt an den oder die Zuhörer. Wie noch zu zeigen sein wird, sprechen die Dichter aus der Vossischen und aus der Kreuz-Zeitung selten direkt ihre Zuhörer an oder benutzen die Form des „Wir". Statt dessen beschreiben sie häufig die Situation aus der Position des scheinbar neutralen Zuschauers bzw. schildern die Erlebnisse einer Einzelperson, eines „Helden". So unterscheiden sich sozialdemokratische und „bürgerliche" Gedichte trotz starker sprachlicher und formaler Affinitäten vorwiegend durch die kommunikative Ausrichtung der sozialdemokratischen Poeten, die sich auch aus der im ersten Kapitel darlegten Funktion der Gedichte und Lieder innerhalb der sozialdemokratischen Fest- und Versammlungskultur ergibt.
[Seite der Druckausg.: 110]
2.1.3 Der König als Bewahrer des Rechtes und der Einheit - Konservative und liberale Gesellschaftsbilder
In den Gedichten und Liedern der so arg bekämpften „Bourgeoisie" sucht man die Arbeiter vergebens. In der Sicht der liberalen und konservativen Dichter verschwinden die Arbeiter in der großen Einheit des Volkes. Selbst wenn einmal der Blick auf die einzelnen Glieder dieses Volkes gelenkt wird, fehlen sowohl Arbeiter als auch Handwerker. Statt dessen findet man Berufsbezeichnungen wie Landmann, Fischer, Gärtner, Kaufmann und Hirte, die größtenteils auf das Bild einer ländlichen Idylle verweisen. [Fn-374: Vgl. z.B. die Gedichte von H.K., Zum 22. März 1871, in: VZ 22.3.1871, Nr. 75, 4. Beilage und Eine Veteranentochter, Zum 17. März 1863, in: KrZ 28.5.1863, Nr. 121, Beilage.] Im allgemeinen tritt das Volk jedoch als homogenes Gefüge auf, das dem König oder Fürsten huldigt. Die Beziehung zwischen dem König und seinem Volk wird als eine sehr persönliche und gefühlsbetonte gestaltet. Selbstverständlich wird darum auch zu den Geburtstagen des Königs bzw. Kaisers Wilhelm und dessen Gemahlin Auguste Viktoria am 22. März bzw. am 30. September ein dichterischer Glückwunsch verfasst. Diese regelmäßig wiederkehrenden poetischen Huldigungen zeigen, wie man sich in den Kreisen konservativer und liberaler Bürger das Verhältnis von König und Volk vorstellt bzw. wünscht.
In der konservativen Kreuz-Zeitung „grüßen" 1866 die „frohen Söhne froh den Vater" [Fn-375: An des Königs Majestät, in: KrZ 22.3.1866, Nr. 68.] , während ein Gratulant „aus dem Bergischen" beim Anblick der preußischen Fahne die überschwenglichen Verse zu Papier bringt:
„O Banner, o wallender, streitbarer Aar,
Du weißt es, wie heiß ich Dich liebe!
Und Feuer und Inbrunst durchdringen mich gar, […]
Des Königs allein sei heute gedacht, […]
Das Herz überströmt von der Liebesgluth."
[Fn-376: Aus dem Bergischen, in: KrZ 1.4.1866, Nr. 76, 1. Beilage.]
Der König erscheint hier als Vater des (männlichen) Volkes, die Liebe zu ihm wird in Reimen besungen, die problemlos auch einer Frau von ihrem Geliebten zugeeignet worden sein könnten.
[Fn-377: Ute Frevert konstatiert ebenso, dass das Verhältnis von Männern zum Vaterland in der patrioti schen Lyrik von den Befreiungskriegen bis zum Jahr 1870/71 als „libidinöse[] Beziehung" darge stellt werde, vgl. dies., Nation, Krieg und Geschlecht im 19. Jahrhundert, in: Manfred Hettling / Paul Nolte (Hg.), Nation und Gesellschaft in Deutschland, Hans-Ulrich Wehler zum 65. Geburts tag, München 1996, 151-170, hier: 158.]
Diese familiale Deutung des Verhält-
[Seite der Druckausg.: 111]
nisses König - Volk ist typisch für die in der konservativen Kreuz-Zeitung abgedruckten Gedichte und Lieder.
[Fn-378: Helga Brandes arbeitet diese Entsprechung zwischen dem Bild des „pater familias" und dem Bild des „pater patriae" in ihrer Untersuchung des Mädchenbuches der Gründerzeit ebenfalls heraus. Im Unterschied zu den Gedichten der Kreuz-Zeitung, in denen in erster Linie die Vater-Sohn-Beziehung zwischen Volk und Vaterland thematisiert wurde, steht hier natürlich die Verbindung von Landes vater und Landestochter im Vordergrund. Vgl. dies. , Das Mädchenbuch der Gründerzeit. Zur Heraus bildung einer patriotischen Literatur für Mädchen, in: Jürgen Link / Wulf Wülfing (Hg.), Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1991, 256-274, hier: 259.]
Das immer wieder aufgegriffene Vater-Sohn-Motiv stellt jedoch nicht nur die starke Bindung und Liebe der „Söhne" für den „Vater" heraus. Indem der König zum Vater stilisiert wird, erscheint seine Überordnung und Autorität als „natürlich" und gottgewollt. Sie kann nach den gültigen moralischen Normen ebensowenig hinterfragt werden wie die Position des tatsächlichen Vaters.
[Fn-379: Vgl. Gunilla-Friederike Budde , Auf dem Weg ins Bürgerleben. Kindheit und Erziehung in deutschen und englischen Bürgerfamilien 1840-1914, Göttingen 1994, 153/154. Zu einem ähnli chen Schluss in bezug auf die lyrische Darstellung des Verhältnisses zwischen Volk und Vaterland kommt Peter Uwe Hohendahl in : ders . , Vom Nachmärz zur Reichsgründung, in: Walter Hinderer (Hg.), Geschichte der politischen Lyrik in Deutschland, Stuttgart 1978, 210-231, hier: 225.]
Der königliche „Vater" fordert mit der ganzen Autorität eines bürgerlichen Familienvaters von seinen „Kindern" „Gehorsam" gegen sein „Machtgeheiß".
[Fn-380: Radis, Das Uebel, in: KrZ 20.2.1863, Nr. 43.]
Die Kritik am König wird mit diesem Bild ebenso verharmlost wie die darauffolgenden Repressionsmaßnahmen des Königs. So stellt Ed. Graf von Pfeil in einem im März 1866 in der Kreuz-Zeitung abgedruckten Gedicht über den preußischen Verfassungskonflikt den Umgang Friedrichs II. mit seinem Volk als großes Vorbild für den amtierenden König dar und schreibt:
„Er hatt' auch einen Krückstock,
Den hielt er lieb und werth.
Den wußte er zu schwingen
So mit ganz eignem Schwung,
Und wen er traf, dem blieb auch
Blau die Erinnerung.
[Seite der Druckausg.: 112]
Er machte recht geschmeidig,
Des Trotzes Büffelfell.
Dem König mit dem Krückstock
Gehorchte man gar schnell."
[Fn-381: Ed. v. Pfeil, Ein Einziger - Dreihundert, in: KrZ 15.3.1866, Nr. 62, Beilage.]
Der Rückgriff auf das volkstümliche Bild des „alten Fritzen" mit seinem Krückstock ermöglicht es, vollends von der tatsächlichen Situation des Verfassungskonfliktes zu abstrahieren und so eine Auseinandersetzung auf rationaler Ebene zu umgehen. Der ganze Konflikt wird auf einen typischen Vater-Sohn-Konflikt reduziert. Es geht nicht um die Argumente, sondern um den Trotz des „kindlichen" Volkes, den der Vater seinen Kindern durch körperliche Züchtigung austreiben muss, wenn er seiner Erziehungsverantwortung gerecht werden möchte. Die Gewaltsamkeit und Unrechtmäßigkeit der königlichen Repressionen bzw. der verfassungswidrigen Ausschaltung des preußischen Abgeordnetenhauses wird mit diesem Bild geschickt ausgeblendet. Die königliche Gewalt erscheint durch die Vorstellung des züchtigenden Vaters nicht nur als im Rahmen der „Volks-Erziehung" sinnvolle Maßnahme, sondern auch als Ausdruck der Sorge und Liebe des Königs für sein Volk. Voller Dankbarkeit für die väterliche Führung durch den gerade zum Kaiser proklamierten Wilhelm I. fragt ein Gedicht zum Kaisergeburtstag nach Abschluss des Vorfriedens von Versailles vom 26. Februar 1871:
„Womit kann Dein Volk Dir lohnen,
Was noch glücklicher Dich macht?
Möcht gern dankbar Dir vergelten
Deine Sorgen, Deine Mühn,
Die Dein Herrscheramt Dir stellten
Bis zur jüngsten Zeit noch hin –
Unsre Liebe, unsre Treue
Weise darum nicht von der Hand,
Deutsche Liebe, deutsche Treue
Sind ein köstlich Wiegenband!"
[Fn-382: Radis, Herr, mein Kaiser und König!, in: KrZ 22.3.1871, Nr. 69, Beilage.]
Voller Liebe vertrauen sich die „Kinder" der weisen Führung ihres „Vaters" an, dem in allen Bereichen ein größerer Überblick zugeschrieben wird und der als gerechter „Vater" die „Spannungen" zwischen seinen „Kindern" ausgleichen kann. In einem anderen Gedicht wird von Kaiser Wilhelm I. diese Haltung des versöhnenden und lenkenden Herrschers mit den Worten erbeten:
[Seite der Druckausg.: 113]
„Sei Du die Hand, die weise lenkt und richtet
Den starren Pflug, des schwanken Schiffes Kiel,
Die Hand, die kühn des Geistes Bahnen lichtet
Und Künste führet zum erhabnen Ziel.
Sei Du die Hand, die stets versöhnt
Und Liebe lohnt und Wahrheit krönt. […]
Sei Du der Vater eines Vaterlandes,
Dem jedes Herze sich zum Opfer bringt; […]."
[Fn-383: Th. Raebel, Dem deutschen Kaiser, in: KrZ 29.3.1871, Nr. 75, Beilage.]
In diesem Gedicht wird sowohl durch die Form der „Anrufung" als auch mit dem Bild der „Hand", das zu den geläufigen Gottes-Symbolen zählt, eine Analogie zwischen der königlichen und der göttlichen Herrschaft hergestellt. Damit wird auf die Legitimation des Königs als Gottes „weltlicher Arm" Bezug genommen, die bereits 1863 in einem Gedicht „An die fortschrittlichen Rechts-Verdreher" im Vordergrund stand, in dem es u.a. heißt:
„Ein Gott beherrscht den Himmel,
Ein Fürst das weite Land,
Und alle Macht und Ehre,
Sie sei in Seiner Hand.
Es ist von Gottes Gnaden
Der König eingesetzt,
Und in des Königs Worte
Wird Gottes Wort verletzt."
[Fn-384: An die fortschrittlichen Rechts-Verdreher, in: KrZ 11.9.1863, Nr. 212, Beilage.]
Offensichtlich findet der Kampf um die Stellung des Königs hier auf einem „Schlachtfeld" statt, das - wie gezeigt werden konnte - bereits 1848 heiß umkämpft war. Nach wie vor geht es um die göttliche Legitimation des Königs und um die daraus abgeleitete, durch keine Verfassung tatsächlich zu begrenzende königliche Macht; eine Frage, die durch den Verfassungskonflikt in der ersten Hälfte der sechziger Jahre neuerlich auf die politische Tagesordnung gerät.
In diesem Zusammenhang ist auch die in den sechziger Jahren immer wieder vorgebrachte Anklage der „Demokraten" bzw. „Fortschrittler" zu sehen. Sie werden als diejenigen dargestellt, die die heilige und durch die Opfer der Befreiungskriege erkämpfte Einheit des Volkes mit ihrem „Parteienzwist" gefährden. Die Abgeordneten der Fortschrittspartei werden geradezu als Prototyp des Politikers hingestellt und in ihnen das Parlament an sich als „Fort-
[Seite der Druckausg.: 114]
schritts-Tyrannei" diskreditiert. [Fn-385: Ein Preuße für Millionen seiner Gesinnungsgenossen, Der Pommern Symbolum als Motto, in: KrZ 14.3.1866, Nr. 61, Beilage.] Besonders in den Monaten vor Beginn der preußisch-österreichischen Kriegshandlungen am 15. Juni 1866 häufen sich die gereimten Schmähungen des Parlaments und seiner bei weitem stärksten Fraktion, der Fortschrittspartei. So wird die Tätigkeit des Parlaments in folgenden Versen „beschrieben":
„Sie halten lange Reden,
Mit Lärmen und Geschrei,
Und schimpfen wie die Buben! -
‚Es ist das Wort ja frei!‘ -
Sie wollen frei vertreten
Ein edles Heldenland,
Und suchen zu zerreißen
Der Treue heilig Band! -
Des besten Königs Schöpfung,
Sie möchten sie entweih'n,
Sie wollen dem Heer an's Leben,
Verringern seine Reih'n!
Sie nennen's ‚Verfassungstreue‘
Und treiben Rebellion! -
Sie rathen um Gesetze
Und sprechen ihnen Hohn! […]
Bei ihnen ist die Lüge
Erklärt in Permanenz! -"
[Fn-386: Ed. Graf v. Pfeil, Ein Einziger - Dreihundert, in: KrZ 15.3.1866, Nr. 62, Beilage.]
Die „Lüge" ist das Schlüsselwort dieses Gedichtes. Der Verfasser bemüht sich mit seinen Zeilen, die Aktivitäten der Fortschrittspartei als „Etikettenschwindel" zu „entlarven". Dies ist gerade deshalb wichtig, weil sich die Liberalen im Verfassungskonflikt tatsächlich auf der Seite des Rechtes befanden und sich auf die bestehende Verfassung berufen konnten. Um ihre Argumente von vorneherein auszuschalten, wird die parlamentarische Diskussion als „Geschwätz" verunglimpft und vor der List und den „Schlingen" der „fortschrittlichen Rechts-Verdreher" gewarnt. [Fn-387: Strachwitz, Ein todter Dichter an die Fortschrittspartei, in: KrZ 25.2.1866, Nr. 47, Beilage bzw. An die fortschrittlichen Rechts-Verdreher, in: KrZ 11.9.1863, Nr. 212, Beilage.] In einem Gedicht, das laut Kreuz-Zeitung „nach dem Schlusse der Landtags-Session 1865 in Abgeordnetenkreisen kursierte", wird das Motiv der Geschwätzigkeit „ausgebaut", in-
[Seite der Druckausg.: 115]
dem Genusssucht, versteckter Ehrgeiz, Feigheit und Vaterlandsverrat hinzugefügt werden. Einem liberalen Abgeordneten werden dort folgende Sätze „in den Mund gelegt":
„Zwar Freuden hab' ich viel genossen [während der Landtags-Session],
Bei Tag und Nacht mich amüsirt,
Fünf Monde du theiles unverdrossen
Die Meiers 388 alle chicanirt. […]
- [Fn-388: Damit sind die Minister gemeint. Dieser Vergleich der Minister mit den karolingischen Hausmeiern entstammt einer Rede des liberalen Abgeordneten Rudolf Virchow.]
Den Sieg der Preußen gegen Dänen –
Für nichtig hab' ich ihn erklärt;
Wie kann der Sattelmeier [der Kriegsminister] wähnen,
Daß man ohne mich zieht das Schwert? […]
So hab' ich kühn und fest gestritten,
Von Furcht und Angst auch nicht die Spur - […]
Drum kehr' ich froh zur Heimath wieder, […]
Jetzt schnell zurück zu meinem Herde,
Bald mach' ich Euch ganz gründlich heiß,
Auf daß ich selbst Minister werde. -"
[Fn-389: Sein Abschied, in: KrZ 21.3.1866, Nr. 67, Beilage.]
Gut zwei Wochen nach Erscheinen dieses Gedichts ergänzt ein anderes mit dem Titel „Ministerthat und Philisterrath" die Charakterisierung durch folgendes Element: „Weich sind Glieder und Hände vom Schreiben, vom Hüllen in Seide, / Zierlich die Lippe, das Ohr willig, und hart nur das Herz." [Fn-390: G.v.O., Ministerthat und Philisterrath, in: KrZ 8.4.1866, Nr. 81, Beilage.] Sehr deutlich werden hier den Liberalen negativ konnotierte „weibliche" Eigenschaften wie körperliche Weichheit, Verschlagenheit und Charakterlosigkeit zugeordnet. Die Hartherzigkeit muss, wenn nicht als „weibliches", so doch als spezifisch „unmännliches" Attribut gelten, da besonders in der Darstellung des Soldaten immer wieder dessen „weiches Herz" hervorgehoben wird. [Fn-391: Vgl. Kapitel 2.2.3 der vorliegenden Arbeit.] Die Liberalen als politischer Hauptgegner der Konservativen erscheinen damit in den Gedichten der Kreuz-Zeitung als geschwätzige, verzärtelte „Weiber", auf die es nur eine Antwort geben kann: „Mancherlei schnattern die Gäns', horch: Eier begackern die Hühner, / Aar, Du schärfest den Blick, dehnest den Fittig und schweigst." [Fn-392: G.v.O., Ministerthat und Philisterrath, in: KrZ 8.4.1866, Nr. 81, Beilage.] Bereits durch die Gegenüberstellung der Tiere - Gänse und Hühner auf der einen, der Adler auf der anderen Seite - tritt
[Seite der Druckausg.: 116]
die ganze Verachtung für die Liberalen hervor: Die zahmen Haustiere beschreien jedes unbedeutende Ereignis, wohingegen der stolze Jagdvogel - das Wappentier der Preußen - ihnen so überlegen ist, dass er sich niemals auf ihre Ebene - das Schnattern und Gackern - hinabbegeben wird. Und doch wird er ihr Geschwätz nicht unbedingt mehr lange dulden, die Gewaltandrohung ist deutlich vernehmbar.
Die Auseinandersetzung der Konservativen mit den Liberalen findet jedoch noch auf einer anderen Ebene statt: Dem liberalen Anspruch auf Freiheit wird eine eigene Definition der Freiheit entgegengesetzt. So heißt es 1863 in einem Lied des Preußischen Volksvereins mit deutlicher Spitze gegen die Fortschrittspartei:
„Königlich, königlich
Stolz und frei bekenn' ich mich.
Freiheit kann allein gerathen -
Zum Verdruß der Demokraten -
Freien Königs freiem Volk."
[Fn-393: Noch ein Preußisches Volksvereins-Lied, in: KrZ 31.1.1863, Nr. 26, Beilage.]
Die hier formulierte Freiheitsidee steht in absolutem Widerspruch zu dem von den Liberalen verfolgten Konzept von Freiheit, wie es sich im Anschluss an die Französische Revolution herausgebildet hat. Das Volk ist dann frei, wenn der König frei ist, und das heißt, wenn er nicht durch Gesetze oder Verfassung gebunden ist. In diesem Fall ist das Volk auch darum frei, weil es sich dem König in Liebe und damit aus freiem Willen unterworfen hat. Dieser Gedanke ist eng verbunden mit der Vorstellung, dass der König als der „Freiheit Hort" die gottgegebene Ordnung der Gesellschaft garantieren muss, eine Ordnung, die jedem einen bestimmten Platz in der Gesellschaft zuweist, den jeder dann demütig akzeptiert. Als Menschen erscheinen die Mitglieder dieser Gesellschaft vor König und Gott als Gleiche, gerade weil sie den ihnen zugewiesenen Anteil zum Gelingen der Gesellschaft einbringen. So folgen auf die eben zitierte Strophe die Verse:
„Oberherr, Oberherr,
Aller Stände Hort und Wehr!
Ritter, Bürger, Arme, Reiche,
Sind dem König alle Gleiche,
‚Jedem sein's!‘ sein Wappenspruch."
[Fn-394: Ebd.]
[Seite der Druckausg.: 117]
Damit wird an die Staatstheorien des Ancien régime angeknüpft, die aus der konservativen Sicht der sechziger und siebziger Jahre noch im Zeitalter der Befreiungskriege die Grundlage Preußens gebildet haben. Dass damals noch des „Gedankens Schwinge" frei gewesen sei [Fn-395: Eine Veteranentochter, Zum 17. März 1863, in: KrZ 28.5.1863, Nr. 121, Beilage.] , macht den Charakter dieser Gedichte als rückwärtsgewandte Utopie deutlich. Da aus dieser Perspektive nur derjenige sich als „freier Mann" erweist, der die Ständeordnung akzeptiert, kann dem „Freien" getrost das „freie Wort" zugestanden werden - mit der von den Liberalen eingeforderten Meinungsfreiheit hat dieses „freie Wort" jedoch nichts gemeinsam. Die Verbindung des Freiheitskonzeptes mit dem historischen Ereignis der Befreiungskriege deutet darüber hinaus darauf hin, dass Freiheit vornehmlich auch als äußere Freiheit, d.h. als Freiheit von fremder Herrschaft, verstanden wird. [Fn-396: Vgl. z.B.: B., Des Königs Standbild, in: KrZ 27.6.1871, Nr. 146, Beilage.] Auf diesen Gedanken wird im Zusammenhang mit den Vorstellungen und Bildern von Nation noch näher eingegangen werden.
Das liberale Bild von König und Volk sieht erwartungsgemäß etwas anders aus. In keinem der in der Vossischen Zeitung abgedruckten Gedichte und Lieder findet sich das in den konservativen Gesängen so weit verbreitete Motiv des Königs als Vater. An die Stelle der dort herausgehobenen Beziehung zwischen Königsvater und Volkssöhnen tritt hier oftmals die Betonung der eigenständigen Existenz des Volkes und der Treue zum Vaterland. In einem Toast der beiden liberalen Fraktionen des Abgeordnetenhauses auf dessen Präsidenten Grabow wird gefragt, „was in dem Kampfe mit der argen Welt / Der Mann sich treu und ritterlich erhält, / Was ihn befestigt und die Brust ihm schwellt", und die Antwort lautet: „Die Landestreu, das Kampfesbrüderband, / Der Blick in's unverlierbar Vaterland / Dort droben und hienieden, das hielt Stand!" [Fn-397: Ziegler, Toast auf den Präsidenten des Abgeordnetenhauses Grabow, in: VZ 31.1.1866, Nr. 25.] Ähnlich wird 1871 in einem Trinkspruch zum Stiftungsfest des wissenschaftlichen Kunstvereins die „Einheit" der „Brüder" als der „Dauer Unterpfand" für das „theure Vaterland" beschworen. [Fn-398: Prof. Maercker, Trinkspruch zum Stiftungsfest des wissenschaftlichen Kunstvereins, in: VZ 20.10.1871, Nr. 252, 2. Beilage.] Im Vergleich zum 1848 emphatisch beschworenen „Bruderbund" bzw. zur sozialdemokratischen „Schwurgemeinschaft" der „Brüder" erscheinen die von den Liberalen besungenen „Brüder" jedoch blass und konturlos.
Die Beziehung zum König wirkt ambivalent. Zum einen wird - besonders in den zur Erinnerung an die Befreiungskriege verfassten Gedichten - die damalige Gefühls-Einheit von König und Volk herausgehoben, das „heilig Band",
[Seite der Druckausg.: 118]
das beide umschlang, und König und Volk „durch treuster Liebe Bande" zu einem Geist und einem Herz verschmolz. [Fn-399: E.F.A., Zum Neuen Jahre 1864, in: VZ 1.1.1864, Nr. 1 bzw. Prolog zum Fest des Veteranen vereins, in: VZ 21.9.1866, Nr. 220, 1. Beilage.] Diese Einheit wird offensichtlich dadurch hergestellt, dass der König die Gefühle und das Geschick seines Volkes teilt und in diesem Bewusstsein dem Volk vorangeht, ohne jedoch als Vater unwidersprochen die Geschicke des Volkes bestimmen zu dürfen. Dementsprechend wird die Königin in ihrem Geburtstagsgruß nach Beendigung des preußisch-österreichischen Krieges gegen Dänemark nicht als Mutter des Volkes apostrophiert, sondern zu einer Art „Erster Mutter" des Volkes stilisiert:
„Du theiltest treu das Hoffen und das Bangen
Der Mutterherzen im erregten Krieg;
Die Deinen waren kühn vorangegangen,
Sie führten unser Volk zu Kampf und Sieg
Und hochbeglückt hältst Du sie heut' umfangen, […]"
[Fn-400: E.F.A., Zur Geburtstagsfeier Ihrer Majestät der Königin, in: VZ 30.9.1864, Nr. 232.]
Mit dieser Position des Königspaares verbinden sich bestimmte Erwartungen, wie sie ebenfalls durch den Rückgriff auf die Figur Friedrichs II. formuliert werden. Auf die Frage „Was ist es denn, was Preußen groß gemacht?" wird 1866 an erster Stelle auf das Wirken dieses legendären Königs hingewiesen, das mit den Worten umschrieben wird: „Im Kampf für Wahrheit, Licht und Recht ein Meister, / Ein Schutz dem Volk ob falscher Richter Spruch, / Nicht Fürst, des Staates erster Diener heißt er, […]."
[Fn-401: Wilhelm Zimmermann, Zur Siegesfeier, in: VZ 25.9.1866, Nr. 223, 1. Beilage.]
Dieser Bezug auf die aufgeklärte Gesetzgebung Friedrichs II. war bereits 1848 ein wesentliches Merkmal des von den Vertretern der Linken formulierten preußischen Patriotismus, wenngleich sich diese Argumentation in den hier untersuchten Liedern von 1848 nicht finden ließ.
[Fn-402: Vgl. Peter Borowsky, Was ist Deutschland? Wer ist deutsch? Die Debatten zur nationalen Identität 1848 in der deutschen Nationalversammlung zu Frankfurt und in der preußischen National versammlung zu Berlin, in: Bernd Jürgen Wendt (Hg.), Vom schwierigen Zusammenwachsen der Deutschen. Nationale Identität und Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. u.a. 1992, 81-95, hier: 95.]
Dieses Idealbild des gerechten, konstitutionellen Herrschers lässt sich nach Klenke durch den Mangel an realpolitischen Alternativen zur Machtstaatslösung und durch die bürgerliche Furcht vor einer sozialen Revolution erklären.
[Fn-403: Dietmar Klenke , 1989, 466.]
Diese These lässt sich durch die im Rahmen dieser Arbeit analysierten Lieder und Gedich-
[Seite der Druckausg.: 119]
te der Vossischen Zeitung weder erhärten noch entkräften; wie bereits dargelegt wurde, werden die soziale Realität und die daraus resultierenden Forderungen der Sozialdemokraten sowohl in der Vossischen als auch in der Kreuz-Zeitung vollständig ausgeblendet.
Nach dem siegreichen Krieg gegen Frankreich und der vollzogenen Reichseinigung werden die vorher zaghaft geäußerten Erwartungen an den Staat etwas deutlicher, ohne dass sie direkt an die Adresse des Kaisers gerichtet würden. Der Neujahrsgruß 1871 fasst das neugegründete Reich in die Metapher des Hauses und fordert das Land dazu auf, nun das Haus zu „säubern", das „Überlebte" und „Verrottete" hinauszuwerfen. Nach den Erfahrungen und Opfern des Krieges soll das Volk sich nicht mehr „kleinlichem Joch" beugen, „unwürdiges Schergenthum", „Lüg'„ und „knechtische[r] Geist" sollen verbannt, der „Freiheit erhabenste[r] Hort" dagegen geschützt werden. Sowohl durch die Hausmetapher in Verbindung mit der Eigenschaft „morsch" als auch durch die Wortwahl wird in diesem Gedicht eindeutig auf Sprache und Bilder der Lieder von 1848 Bezug genommen. In völliger Umkehrung der ursprünglichen Intention endet dieser mehr als zwanzig Jahre später verfasste Neujahrsgruß jedoch mit der Aufforderung:
„So raffe dich auf, so ring' dich empor,
So öffne du jubelnd dem Kaiser das Thor!
So ersteh', so erglänze in Herrlichkeit,
Einer neuen Zeit, einer freien Zeit!"
[Fn-404: H. Kletke, Zum neuen Jahre 1871, in: VZ 1.1.1871, Nr. 1.]
Die Position Wilhelms, 1848 noch als „Kartätschenprinz" zu zweifelhaftem Ruhm gelangt, wird demzufolge nach 1871 kaum mehr in Frage gestellt. Doch findet man in vielen Gedichten die Klage, dass die Freiheit auch nach erreichter Einheit noch ihrer „Erlösungsstunde" harre, und so erscheinen die ehemaligen Helfershelfer des „Tyrannen", die „Pfaffenheit" und das „Junkerthum", nun als die diejenigen, die das „schöne Weib" Freiheit in Ketten und Banden legen. [Fn-405: Adolph Glaßbrenner zum 27. März 1871, in: VZ 26.3.1871, Nr. 79, 4. Beilage.] Auch hier - in einem Adolph Glaßbrenner, einem der bekanntesten republikanischen Dichter von 1848 gewidmeten Gedicht [Fn-406: Vgl. zu Adolph Glaßbrenner Peter Uwe Hohendahl , 1978, 219/220.] - wird also die Terminologie von 1848 wieder aufgegriffen und ihrer fürstenfeindlichen Spitze entkleidet. Offensichtlich steht der Anspruch dahinter, das „Erbe" von 1848 fortzuführen, wenn auch die veränderten Umstände und das
[Seite der Druckausg.: 120]
bereits Erreichte einen Wandel der Stoßrichtung nahe legen.
[Fn-407: Damit wird in den Gedichten und Liedern des liberalen Bürgertums die Erinnerung an 1848 und die Verfassungsbewegung als spezifischer Anteil des liberalen Bürgertums bei der Reichseinigung nicht vollständig aus dem Gedächtnis getilgt, wie es Wolfgang Hardtwig für den Bereich der Staats symbolik herausgearbeitet hat. Allerdings wird der eigene Anteil einer Umdeutung unterworfen. Vgl. Wolfgang Hardtwig, Bürgertum, Staatssymbolik und Staatsbewußtsein im Deutschen Kaiserreich 1871-1914, in: ders., Nationalismus und Bürgerkultur, Göttingen 1994, 191-218, hier: 207.]
Dies scheint jedoch nicht ganz unumstritten gewesen zu sein. 1874 wird in der Vossischen Zeitung der Prolog zu einer Feier abgedruckt, die dem Gedächtnis des 1870 verstorbenen liberalen Politikers Benedikt Waldeck gewidmet war.
[Fn-408: Waldeck war 1848 einer der Protagonisten der äußersten Linken in der preußischen National versammlung, wurde 1860 als Mitglied der Fortschrittspartei in das preußische Abgeordnetenhaus gewählt und hatte im preußischen Verfassungskonflikt die Befugnisse dieser Kammer verteidigt.]
In diesem Gedicht wird die Arbeit im Geiste Waldecks selbstkritisch mit folgenden Versen dargestellt:
„Der Geist, der treu zur Freiheit hält,
Und bis die letzten Kräfte schwinden,
Wie auch des Schicksals Würfel fällt,
Ihr Banner nie sich läßt entwinden;
Der Geist, der nur das Recht verlangt,
Von allem Schein und Trug sich wendet,
Nicht vor dem Zorn der Mächt'gen bangt,
Doch auch die Niedern nicht verblendet; […]
Noch sind wir weit entfernt vom Ziel,
Und Vorsicht fordern diese Tage,
Es ward der heil'ge Ernst zum Spiel,
Unsicher schwankt des Rechtes Waage;
Umsonst nach Freiheit noch begehrt,
Nach ihrem festen Grund, die Einheit -- […]
Ihr haltet seinen [d.h. Waldecks] Geist gefangen.
Die Feigheit, die der That sich schämt,
Die Eigensucht, die immer dreister,
Rücksicht, die Mund und Hände lähmt,
Das sind die schlimmen Kerkermeister. […]
Nur wer sich muthig selbst befreit,
Wird endlich seines Volk's Befreier […]."
[Fn-409: Albert Traeger, Prolog zur Waldeckfeier, in: VZ 4.12.1874, Nr. 284, 2. Beilage.]
[Seite der Druckausg.: 121]
Hier fällt das Stichwort der „Mächt'gen", vor denen man sich im Kampf um die Freiheit nicht fürchten solle, unklar bleibt jedoch, gegen wen sich diese Bezeichnung richtet. Neu ist, dass die eigene Feigheit und Eigensucht angeprangert und für die Einschränkung der Freiheit mitverantwortlich gemacht wird. Neben diese kritischen Töne setzen andere Gedichte allerdings helle Visionen ländlich-traditioneller Idyllen, die besonders häufig im Anschluss an die Kriege einen neuen Frühling feiern, als dessen Hüter der König bzw. Kaiser erscheint. So heißt es in der Gratulation der Vossischen Zeitung zum ersten Geburtstag Wilhelms als deutscher Kaiser:
„Nun darf getrost den Baum der Gärtner setzen,
Der Landmann sorgt nun froh für Feld und Haus,
Der Fischer flickt mit Hast an seinen Netzen
Und segelt frisch die freie See hinaus,
Der Kaufmann weiß des Friedens Glück zu schätzen
Und wagt und mißt Erfolg und Gunst sich aus, -[…]
Nun grüß', o Deutschland, jubelnd Deinen Kaiser,
Der Dir die Fahne stark und unverzagt
Im Sturme hielt, und was in schlimmen Stunden
Abfiel in Schmach, an's Herz Dir neu gebunden!"
[Fn-410: H.K., Zum 22. März 1871, in: VZ 22.3.1871, Nr. 75.]
Das Motiv des Königs bzw. Kaisers als Friedensbringer und -bewahrer ist den Gedichten und Liedern von Vossischer und Kreuz-Zeitung gemeinsam, ein Motiv, das angesichts von drei Kriegen in nur zehn Jahren erstaunen könnte. Tatsächlich wird in den bürgerlichen Kriegsgedichten immer wieder die Notwendigkeit und Unvermeidbarkeit dieser Kriege herausgestellt. [Fn-411: Vgl. Kapitel 2.2.3 der vorliegenden Arbeit.]
Trotz aller Angriffe besonders der Kreuz-Zeitungs-Poeten auf die Liberalen ergeben sich in den Gedichten und Liedern des konservativen und des liberalen Bürgertums einige Gemeinsamkeiten. In allen bürgerlichen Gedichten bleibt die Autorität des Fürsten mehr oder weniger unbestritten, wenn auch die Bilder, mit denen die Herrschaft legitimiert wird, differieren. Findet sich in den konservativen Dichtungen das Bild des gütigen und gerechten Landesvaters, der fraglosen Gehorsam von seinen „Söhnen" fordern kann, so trifft man bei den Liberalen eher auf die Vorstellung des Herrschers als eines „primus inter pares", der seine Qualität durch Achtung vor Gesetz und Verfassung erweisen muss. Beide Anschauungen bedienen sich unterschiedlicher
[Seite der Druckausg.: 122]
Facetten des Mythos vom „alten Fritzen", um ihre Argumentation historisch zu rechtfertigen. Die Darstellung des Volkes ähnelt sich in ihrer Stilisierung zum Ländlich-Idyllischen. Die Folgen der Industrialisierung werden konsequent ausgeblendet, dementsprechend bleiben die Sozialdemokraten unerwähnt. Ob dies als Ausdruck der Geringschätzung der Sozialdemokraten als politischer Gegner gelten muss oder als bewusstes Verschweigen eines angstbesetzten Themas zu werten ist, lässt sich aus den Gedichten und Liedern nicht herauslesen. In den sechziger Jahren wurden die Sozialdemokraten möglicherweise noch als politisch unbedeutend eingeschätzt, da sie sich nur auf eine zahlenmäßig geringe Mitgliedschaft stützen konnten. Mit dem überraschenden Wahlerfolg der Sozialdemokraten von 1874, der ihnen trotz ungünstiger Voraussetzungen immerhin einen Stimmenanteil von 6,8 % und damit neun Mandate im Reichstag eintrug, wurden sie jedoch immer mehr zum ernstzunehmenden Faktor im politischen Spiel. Dies zeigt die mit der Ernennung Tessendorfs zum Staatsanwalt in Berlin einsetzende Unterdrückung und Verfolgung der Sozialdemokraten, die 1878 im sogenannten Sozialistengesetz ihren Höhepunkt erreichte. Die zunehmende Furcht des Bürgertums vor einer Revolution spiegelt sich jedoch nicht in den hier untersuchten Gedichten und Liedern.
Der eigentliche politische Gegner ist in den Augen der Konservativen die liberale Fortschritts-Partei, die als „weibisch" und geschwätzig diskreditiert wird. Die Liberalen wenden sich demgegenüber gegen den Einfluss von Adel und „Junkerthum", womit auf Vokabeln von 1848 zurückgegriffen wird, die keinen parteipolitischen, sondern eher einen sozialen Gegner kennzeichnen. Die Auseinandersetzung kreist um den Begriff „Freiheit", der bereits 1848 zu den zentralen Punkten zählte. Während die Forderung der Liberalen nach Freiheit in den Liedern und Gedichten ähnlich unbestimmt bleibt wie schon 1848, grenzen die Konservativen ihr Konzept der Freiheit ganz deutlich von den liberalen Vorstellungen ab. Freiheit ist in ihren Augen die nicht von einer Verfassung „reglementierte" Beziehung zwischen Volk und König, die jedem seinen gottgegebenen Platz in der Gesellschaft zuweist. Damit wird auf die Ständeverfassung des Ancien Régime Bezug genommen. Sowohl bei den Konservativen als auch bei den Liberalen ist Freiheit jedoch immer auch als äußere Freiheit zu verstehen.
Bei den Sozialdemokraten überlagern sich im Gegensatz zu den bürgerlichen Vorstellungen sehr deutlich soziale und politische Wahrnehmungsmuster von Gesellschaft. Das Volk wird als Gemeinschaft derjenigen Männer definiert, die durch Arbeit zum Nutzen der Gesellschaft beitragen. Damit dient eine zunächst soziale Verortung zur Bestimmung des Volkes, wohingegen in den bürgerlichen Liedern - wie noch zu zeigen sein wird - der Begriff „Volk" eindeutig über die Kategorie des Vaterlandes festgelegt wird. Das „Arbeits
[Seite der Druckausg.: 123]
volk" nimmt sich gegenseitig als „Brüder" wahr, die durch einen Schwur miteinander verbunden sind. So tritt an die Stelle der emotionalen Beziehung zwischen Volk und Herrscher, wie sie in den bürgerlichen Versen besungen wird, das gefühlsbeladene Verhältnis der „Volks-Brüder" untereinander. Der Fürst wird dagegen weitgehend negativ als „Tyrann" und „Despot" dargestellt, doch fällt die Gegnerschaft im Vergleich mit 1848 wesentlich weniger radikal aus. Im allgemeinen richten sich die sozialdemokratischen Gesänge gegen die „Ketten" der Arbeit, deren Enden die „Bourgeosie" in Händen hält. Auch hier gehört die Freiheit zu den Schlüsselwörtern, neben das allerdings die Gleichheit tritt. Freiheit wird vorwiegend sozial verstanden, wenn auch der angestrebte Weg über das allgemeine Männerwahlrecht ein politischer ist. Am Begriff der Freiheit wird besonders deutlich, dass Sozialdemokraten und Bürger, aber auch Bürger unterschiedlicher politischer Couleur oftmals in verschiedenen „Sprachen" sangen und dichteten.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Januar 2002