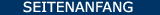![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
-
Stefan Berger
- 1. Einleitung: ‘1945 and all that …’
- 2. Die 1950er Jahre: auf der Suche nach einem modernen Reformismus
- 3. Die 1960er Jahre: Sozialdemokratismus im Zenit
- 4. Die 1970er Jahre: Krise, Selbstzweifel und der Ruck nach links
- 5. Die 1980er Jahre: auf der Suche nach neuem sozialdemokratischen Profil
- 6. Die 1990er Jahre: Speerspitze eines ‘liberalen Sozialismus’
Die britische Labour Party, 1945-2000
[Seite der Druckausg.:87]
Stefan Berger
Die britische Labour Party, 1945-2000*
* [Überarbeitete Fassung meines Eingangsstatements zur Podiumsdiskussion. - Einen Überblick über die Entwicklung der Labour Party nach dem zweiten Weltkrieg bieten Duncan Tanner/Pat Thane/Nick Tiratsoo (Hrsg.), Labour’s First Century, Cambridge 2000; Keith Laybourn, A Century of Labour. A History of the Labour Party 1900-2000, Stroud 2000; Andrew Thorpe, A History of the British Labour Party, London 1997; Steven Fielding, The Labour Party: ‘Socialism’ and Society since 1951, Manchester 1997; Eric Shaw, The Labour Party since 1945, London 1996; Henry Pelling, A Short History of the Labour Party, 11 th edn, London 1996; Willie Thompson, The Labour Party Since 1945, Cambridge 1994; Kevin Jeffreys, The Labour Party since 1945, London 1993; Lewis Minkin, The Contentious Alliance: Trade Unions and the Labour Party, Edinburgh 1991; Kenneth O. Morgan, Labour People: Leaders and Lieutenants, Oxford 1987. Zur Selbstdarstellung von New Labour siehe Peter Mandelson/Roger Liddle, The Blair Revolution: Can New Labour Deliver?, London 1996; Anthony Giddens, The Third Way and its Critics, Cambridge 2000. Siehe auch die website der Partei unter http://www.labour.org.uk/ . Zur Beurteilung von New Labour siehe auch die Debatte im New Left Review, Nr. 2-4, 2000, an der sich Peter Mair, David Marquand, Anthony Barnett und Ross McKibbin beteiligten, sowie die Sonderausgabe von Marxism Today, Nov./Dec. 1998. Zur vergleichenden Betrachtung der Geschichte der Labour Party nach 1945 siehe vor allem Herbert Kitschelt, The Transformation of European Social Democracy, Cambridge 1994; Donald Sassoon, One Hundred Years of Socialism, London 1996; Frank Unger/Andreas Wehr/Karen Schönwälder, New Democrats, New Labour, Neue Sozialdemokraten, Berlin 1998; René Cuperus/Johannes Kandel (Hg.), European Social Democracy: Transformation in Progress, Bonn 1998.]
1. Einleitung: ‘1945 and all that …’
1945 besaß die britische Labour Party Ansehen und Einfluss in einem Maße, wie sie es vorher und nachher im 20. Jahrhundert nicht wieder erreichen sollte. Großbritannien hatte soeben den Krieg gegen Hitler-Deutschland erfolgreich beendet. Bei den
[Seite der Druckausg.:88]
Unterhauswahlen erreichte die Partei gegen alle Erwartungen einen erdrutschartigen Sieg.
Sie stellte in den nächsten sechs Jahren die Regierung, die für die Entwicklung Großbritanniens in der Nachkriegszeit wichtigste Weichenstellungen vornehmen sollte. Innenpolitisch leitete Labour eine Wirtschaftspolitik ein, die die Eisenbahnen, die Kohle-, Strom- und Stahlindustrie sowie die Bank of England und die Flugzeugindustrie verstaatlichte. Dabei erhielten die verstaatlichten Industrien autonome Aufsichtsräte, die keinen direkten Einfluss der Regierung auf die verstaatlichten Indus-
trien erlaubten. Zudem war ausschlaggebendes Kriterium für die Verstaatlichung die Ineffizienz und Krisenhaftigkeit einer Industriebranche. Florierende privatwirtschaftliche Branchen wurden, mit Ausnahme der Stahlindustrie, in der Regel nicht sozialisiert. Hier setzte die Regierung auf vom Staat unterstützte Sozialpartnerschaft. 80 % der britischen Industrie blieben somit in privater Hand, und diejenigen Betriebe, die in Gemeinbesitz überführt wurden, waren in der Regel erst zu sanieren. Die später oft geäußerte Kritik an der wirtschaftlichen Ineffizienz der verstaatlichten Betriebe berücksichtigt häufig nicht, dass dieselben Betriebe auch in privater Hand notorisch ineffizient waren.
Das Verstaatlichungsprogramm wurde vor dem Hintergrund einer massiven wirtschaftlichen Krise des Landes in der unmittelbaren Nachkriegszeit mit einem Höchstmaß an Umsicht und Rücksicht auf die Produktivität der britischen Wirtschaft insgesamt ausgeführt. Die Exportkapazitäten Großbritanniens waren 1945 im Vergleich zu 1939 um zwei Drittel geschrumpft. Die lebenswichtigen finanziellen Kriegshilfen der USA (lend-lease aid) kamen zu einem abrupten Ende. 1946/47 bereitete ein extrem strenger Winter Probleme bei der Kohleversorgung, die zur Schließung von Fabrikanlagen, Produktionsausfall und einem kurzzeitigen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf circa zwei Millionen führten. Trotz eines sechzigprozentigen Anstiegs der britischen Exportkapazitäten seit 1945 kam es 1949 zu einer schweren Zahlungsbilanzkrise. Zudem machten ein erhebliches Haus-
[Seite der Druckausg.:89]
haltsdefizit und die Krise der britischen Währung der Wirtschaftspolitik der Labourregierung zu schaffen. Dennoch gelang es der Regierung, die Inflation unter Kontrolle zu halten, die industrielle Produktion des Landes im Vergleich zur Vorkriegszeit um circa 30% zu steigern und, mit Ausnahme des Winters 1946/47, Vollbeschäftigung zu garantieren. Die exzellenten Beziehungen zwischen Labourregierung und Gewerkschaften spielten dabei eine wichtige Rolle für die erstaunliche Bereitschaft der Gewerkschaften, Zurückhaltung bei Lohnforderungen zu zeigen. Arbeitslosigkeit war in starkem Kontrast zur Situation nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nach 1945 kein ernsthaftes Problem.
Vielen Labouranhängern galt und gilt die Reform des Gesundheitswesens als das Glanzstück der Regierung Attlee. Eine Ikone des linken Parteiflügels, Aneurin Bevan, schuf den National Health Service, der zum ersten Mal eine umfassende und universale gesundheitliche Versorgung der gesamten Bevölkerung garantierte, die allein aus Steuermitteln finanziert wurde. Zudem wurde 1946 eine umfassende ‘national insurance’ eingeführt, die Arbeitnehmern gegen obligatorische Beitragszahlungen, die allerdings nicht nach Einkommen gestaffelt und deshalb sozial ungerecht waren, Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung ebenso wie eine Sterbekasse bot. Im Erziehungswesen wurde erheblich mehr Geld bereit gestellt, um qualitativ bessere Schulen zu garantieren. Außerdem wurde das schulpflichtige Alter auf 15 Jahre heraufgesetzt. Die Regierung begab sich auch an die Reform des Verfassungssystems. Bereits vor 1945 hatten diverse Labour-Party-Programme Parlamentsreform, Wahlrechtsreform, Kabinettsreform, die Abschaffung des House of Lords sowie die Schaffung von regionalen Parlamenten gefordert. Nach 1945 kam es dann zu einer Umsetzung wichtiger Reformen vor allem durch den Vizepremier Herbert Morrison: Das Vetorecht des House of Lords wurde weiter eingeschränkt, die Gehälter der Abgeordneten stiegen um zwei Drittel an. Das parlamentarische Prozedere wurde effizienter gestaltet,
[Seite der Druckausg.:90]
das Parlament vom ‘talking shop’ zum ‘workshop’ umgestaltet. Undemokratische Anachronismen, wie die Möglichkeit mehrfacher Stimmabgabe und die separaten Unterhaussitze für Universitäten, wurden abgeschafft.
Auch außenpolitisch setzte die Nachkriegsregierung Maßstäbe: Der Außenminister Ernest Bevin gilt zu Recht als Ziehvater des nordatlantischen Verteidigungspaktes (NATO), und unter der Labouradministration begann die Dekolonisierung des britischen Empire. 1947 wurde Indien in die Unabhängigkeit entlassen. Insgesamt war die britische Labourregierung zwischen 1945 und 1951 die erfolgreichste britische Reformregierung während des gesamten 20. Jahrhunderts. An den konkreten Reformmaßnahmen der Labourregierung sollten sich in der Folgezeit die wichtigsten politischen Kontroversen des Landes entzünden. Auch für die innerparteiliche Mythenbildung war diese Zeit von herausragender Bedeutung. Mit ihr schienen die langen Jahre der politischen Machtlosigkeit endgültig vorbei. Im innerparteilichen Selbstverständnis hatte die Partei über Jahrzehnte einen heroischen Kampf gegen Ignoranz und Kleinmut der Wähler geführt. Die Labour-Minderheitsregierungen von 1924 und 1929 waren, so der Parteimythos, jeweils kläglich an der Heimtücke ihrer politischen Kontrahenten und am ‘Verrat’ des Parteiführers Ramsay MacDonald gescheitert. Aber 1945 wusste man sich am Ziel eines bedeutsamen Etappensieges, der zugleich zur Selbstvergewisserung des langen Marsches zum engültigen Siege (‘the forward march of labour’) wurde.
Von den 1950er bis zu den 1970er Jahren entwickelte sich ein breiter ideologischer Konsens zwischen Labour Party und Conservative Party. Die konservative Partei akzeptierte die nach dem Krieg von Labour vorgenommenen und von den Tories z.T. heftig attackierten Reformen (Butskellism): Der Sozialstaat blieb ebenso unangetastet wie die Verstaatlichungen, und den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit schrieben sich die konservativen Regierungen dieser Jahre ebenso auf die Fahnen wie ihre Labouropponenten. Erst in den 1980er Jahren kam es dann unter
[Seite der Druckausg.:91]
Margaret Thatcher zu einem massiven Angriff auf die ‘Errungenschaften’ der Nachkriegs-Labourregierung, die nun als eigentliche Ursache für die wirtschaftliche Misere des Landes und seinen Prestigeverlust in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend herhalten musste. Die Labour Party befand sich außerdem Ende der 1970er Jahre nicht mehr im Gleichschritt mit ihren europäischen Schwesterparteien. Sie war in den 1970er Jahren immer weiter nach links gerückt. 1981 spaltete sich ein rechter Parteiflügel ab, und unter der Führung von Michael Foot erlitt die Partei 1983 ihre empfindlichste Wahlniederlage. Erst unter Neil Kinnock orientierte sich die Partei politsch um. Sie begann nun, Teile des alten, in den 1980er Jahren so massiv diskreditierten Selbstverständnisses zu revidieren, aber sie hielt zugleich, selbst unter Tony Blair, an den sozialdemokratischen Traditionen der Partei nachhaltig fest.
2. Die 1950er Jahre: auf der Suche nach einem modernen Reformismus
Die Labour Party konnte die Zahl der für sie abgegebenen Stimmen bei den Wahlen von 1950 im Vergleich zu 1945 noch steigern, aber das ebenso skurrile wie undemokratische britische Wahlrecht brachte es mit sich, dass sie dennoch 78 Parlamentssitze verlor. Ihre Mehrheit schrumpfte auf 5 Sitze zusammen. Innerparteiliche Querelen (die politischen Gegensätze zwischen Parteilinken und Parteirechten, aber auch persönliche Animositäten, wie die zwischen Attlee und Morrison) bestärkten innerhalb eines weiteren Jahres die Ansicht, dass die Regierung sich in einer Krise befinde. Labour trat die Flucht nach vorn an, und im Oktober 1951 kam es zu erneuten Wahlen. Die Partei erzielte 48,8 % aller abgegebenen Stimmen, ein Ergebnis, das bis 1992 von beiden großen Parteien unübertroffen blieb, erhielt allerdings nur 295 Sitze, während die Konservativen mit 48% der Stimmen 321 Sitze errangen. Nach nur sechs Jahren war Labour
[Seite der Druckausg.:92]
in die Opposition zurückgekehrt. Besonders beunruhigend für eine Arbeiterpartei war die Tatsache, dass die Konservativen 1951 44% aller Arbeiterstimmen auf sich vereinigen konnten. Hier machte sich ein in Großbritannien schon lange und nachhaltig etablierter Arbeiterkonservatismus bemerkbar, der sicher etwas mit Deferenzverhalten, aber doch insgesamt sehr viel mehr mit konkreten Politikangeboten der Konservativen zu tun hatte, die für viele, gerade Facharbeiter, attraktiv waren. In der longue durée blieben allein die Bergarbeiter und die städtischen Arbeiter der Labour Party treu.
Zahlreiche Historiker haben gegen Ende der Nachkriegs-Labourregierung gewisse Ermüdungserscheinungen bei der Partei ausgemacht. Sie schien sich nicht mehr sicher, was noch zu tun blieb: Sollte die Sozialisierung wichtiger Industrien weiter vorangetrieben werden, oder sollte man das Erreichte erst einmal konsolidieren. Nach der einschneidenden Reformpolitik der ersten fünf Nachkriegsjahre drängte sich führenden Labourpolitikern die Frage auf: was jetzt? Damit war zugleich das Problem aufgeworfen, für welche Form des Sozialismus die Labour Party einzutreten bereit war. Wie die meisten sozialistischen Parteien Westeuropas sozialdemokratisierte sich die Labour Party in den 1950er Jahren. Unter den Bedingungen des Kalten Krieges und der Pax Americana machte sie ihren Frieden mit dem Kapitalismus. Die Stärke des sozialdemokratischen Revisionismus in der Partei wurde 1955 nachhaltig dadurch unterstrichen, dass einer seiner Hauptvertreter, Hugh Gaitskell, zum Nachfolger Attlees gewählt wurde. Nach zwei weiteren Wahlniederlagen (1955 und 1959) geriet Gaitskell allerdings zunehmend innenpolitisch unter Druck. Unter den Bedingungen des anhaltenden wirtschaftlichen Nachkriegsbooms konnte sich die Konservative Partei als Partei wirtschaftlicher Prosperität darstellen, die die Konsumbedürfnisse breiter Bevölkerungsgruppen erfüllte. Die zunehmende Feminisierung der Arbeitsmärkte, die Krise der Schwerindustrien (die zugleich Labourhochburgen waren) und der auch in Großbritannien viel diskutierte ‘Abschied von der Proletarität’ (Josef Moo-
[Seite der Druckausg.:93]
ser) ließen so manche politische Beobachter die Frage stellen, ob Labour überhaupt noch mehrheitsfähig sei. Zudem hatte die Partei offensichtlich Probleme, Frauen und Jungwähler für sich zu gewinnen. All diese Entwicklungen schienen eine Modernisierung der Labour Party nur noch notwendiger zu machen. In dieser Situation schien der Parteiführung um Gaitskell der Abschied von der die alte Arbeiterpartei symbolisierenden Clause Four (die, seit 1918, die Sozialisierung der Wirtschaft zur zentralen Forderung des britischen Sozialismus erhob) das einzig richtige Zeichen zu sein zum Aufbau einer neuen, sozial inklusiven Labour Party. Dabei unterschätzte der der Mittelklasse entstammende, in Oxford ausgebildete Ökonom Gaitskell allerdings die emotionalen Bindungen vieler in der Partei an Clause Four. Sein bewusst zur Schau getragener Jetset-Sozialismus war dabei ebensowenig hilfreich wie seine offenen Sympathien für die erzrevisionistischen Vorstellungen seines Parteifreundes Douglas Jay, der vorschlug, die Bindung zu den Gewerkschaften zu lösen, den Namen ‘Labour Party’ aufzugeben und ein historisches Bündnis mit der Liberal Party zu schließen. Nach einer scharfen Debatte auf der Parteikonferenz 1959 wurde der Antrag auf Abschaffung von Clause Four zurückgewiesen. Die symbolisch bedeutsame Beerdigung dieser nach 1945 immer anachronistischer anmutenden Forderung ließ noch fast vierzig Jahre auf sich warten.
Der sich mit dem Kapitalismus arrangierende sozialdemokratische Reformismus wurde dadurch allerdings nicht in die Defensive gedrängt. Anthony Crosland stieg in den 1950er Jahren zum weit über die Grenzen des Inselreichs bekannten Propheten des Sozialdemokratismus auf. Sein 1956 veröffentlichtes Buch ‘The Future of Socialism’ wurde zur Bibel der Revisionisten in der Labour Party. Crosland argumentierte explizit gegen weitere Verstaatlichungen. Statt dessen favorisierte er eine keynesianische Wirtschaftspolitik, die die makroökonomischen Rahmenbedingungen absteckte, ohne dabei direkt in die private Verfasstheit der Wirtschaft einzugreifen. Zudem appellierte Cros-
[Seite der Druckausg.:94]
land daran, neben den traditionellen Pfeilern der Parteipolitik, wie Ausbau des Sozialstaats und Chancengleichheit, auf eine radikalere Bildungspolitik zu setzen und Arbeiter nicht nur als Produzenten, sondern auch als Konsumenten ernst zu nehmen. Der Wohlstand der 1950er Jahre kontrastierte scharf mit der Rationierung und den Sparprogrammen der 1940er Jahre, mit denen die Labourregierungen Attlees weitgehend assoziiert blieben. Die Konservativen stellten sich als Partei des wirtschaftlichen Aufschwungs dar, die weiten Bevölkerungskreisen den schnellen Zugang zu den begehrten neuen Konsumgegenständen versprach. Labour, so Crosland, könne diese gerade in Arbeiterschichten weit verbreiteten Bedüfnislagen nicht einfach ignorieren. Die Parteilinke (Keep Left in den 1940er Jahren und im Anschluss daran die Bevanites in den 1950er Jahren), die an Nationalisierung und Arbeiterethos weitgehend festhielt, hatte zwar ihr Gegenmanifest im bereits 1952 von Bevan verfassten ‘In Place of Fear’, das vor allem größere industrielle Demokratie anmahnte und die Aufsichtsräte der verstaatlichen Industrie stärkerer politischer Kontrolle unterwerfen wollte. Dennoch kann man insgesamt von einem Sieg der Revisionisten in den 1950er Jahren sprechen. Die 1961 auf dem Parteitag verabschiedeten ‘Signposts for the Sixties’ gelten zu Recht als britisches Äquivalent zu Bad Godesberg.
3. Die 1960er Jahre: Sozialdemokratismus im Zenit
Wie in keinem anderen Nachkriegsjahrzehnt dominierten sozialdemokratische Politiker die 1960er Jahre in Westeuropa: Olof Palme, Willy Brandt und für Großbritannien Harold Wilson standen für den hoffnungslosen Fortschrittsoptimismus einer sozialdemokratischen Zukunftsvision, in der sich technologischer Fortschritt verband mit Vorstellungen von einem auf der Partnerschaft von Kapital und Arbeit beruhenden andauernden Wirtschaftswachstum und einem omnipotenten Wohlfahrts- und
[Seite der Druckausg.:95]
Interventionsstaat, der mittels ‘social engineering’ eine sozial gerechtere und chancengleiche Gesellschaft hervorbringen sollte. Der Siegeszug des Sozialdemokratismus schien unaufhaltsam, und zahlreiche politische Kommentatoren sahen auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte andauernde sozialdemokratische Mehrheiten voraus, wie sie im sozialdemokratischen Musterland Schweden ja bereits seit den 1930er Jahren funktionierten. In Großbritannien erzielte die Labour Party nach 1945 zum ersten Mal wieder 1966 eine substantielle parlamentarische Mehrheit, nachdem sie bereits seit 1964, nach einem knappen Wahlsieg, die Regierung stellte.
Gaitskell war 1963 verstorben. Sein Nachfolger wurde Harold Wilson, der politisch weiter links stand und über stärkere Wurzeln in der Arbeiterbewegung verfügte als Gaitskell. Gaitskells Bewunderer verachteten ihn bald als ‘common little man’, aber sein Image, Pfeifenraucher, Liebhaber von brown sauce und Anhänger von Huddersfield Town Football Club, machte ihn unter traditionellen Anhängern der Labour Party beliebt. In den Wahlen von 1964 und 1966 konnte sich Labour auf die Arbeiterstimmen verlassen. Die Regierung Wilson trat 1964 an mit dem Versprechen einer technologischen Revolution, die den langen wirtschaftlichen Abstieg des Landes im 20. Jahrhundert endlich umkehren werde. Wilson sah den Staat explizit als ‘nützliches Arbeitstier’ und bewunderte die staatliche Planung der sowjetischen Wirtschaft ebenso wie die französische staatliche Planungsbürokratie. Unter Wilson unterstützte die Partei hochinterventionistische Strategien für eine zentrale Wirtschaftsplanung. Ein Department of Economic Affairs wurde eingerichtet: Ihm oblag es, einen nationalen Plan für ein schnelleres Wirtschaftswachstum zu erstellen. Ein neues Technologieministerium wurde aus dem Boden gestampft, das vor allem die Forschung und Entwicklung neuer Technologien befördern sollte. Dass dabei oft von oben herab und unter Nichtbeachtung der Interessen breiter Wählerschichten geplant wurde, zeigt der bekannte Ausspruch eines der wirtschaftlichen Vordenker der
[Seite der Druckausg.:96]
Partei nach 1945, Douglas Jay: ‘the gentleman from Whitehall really does know better what is good for the people.’
Unter Richard Crossmann brachte die Labourregierung außerdem wichtige Verwaltungs- und Parlamentsreformen in Gang. So wurden die Rekrutierungspraxis des Beamtenapparates und die Struktur der kommunalen Verwaltung modernisiert. Der Sozialstaat wurde unter bewusster Fortführung der Attleeschen Reformen weiter ausgebaut, obwohl die Regierung sich massiven Wirtschaftskrisen ausgesetzt sah und sich gleichzeitig lange (viele Kritiker meinten im nachhinein: zu lange) einer Abwertung des Pfundes widersetzte (die 1967 dennoch erzwungen wurde): Die Renten wurden erhöht, der soziale Wohnungsbau intensiviert, das Erziehungswesen wurde demokratisiert und erweitert, das schulpflichtige Alter auf 16 Jahre erhöht. Eine auch international Maßstäbe setzende Fernuniversität wurde gegründet, die Todesstrafe abgeschafft, die Abtreibung legalisiert und Homosexualität entkriminalisiert. Das Wahlalter wurde von 21 auf 18 Jahre abgesenkt, neue Scheidungs- und Gleichstellungsgesetze werden verabschiedet, die besonders die Position der Frauen in der britischen Gesellschaft verbessern sollten.
Führende Labourpolitiker waren seit Gründung der Partei immer wieder nachhaltig für eine Gleichberechtigung von Frauen eingetreten. Frauen stellten in der Zwischenkriegszeit gut die Hälfte aller Parteimitglieder, und sie gehörten oft zu den Aktivsten in den Ortsverbänden. Es wurde ihnen allerdings in einer weitgehend von Männern dominierten Partei nicht gerade leicht gemacht, Sozialismus und Feminismus miteinander zu verbinden. Der Feminismus war als bürgerlich verschrien, und politisch aktive Frauen wurden oft auf sogenannte weibliche Politikfelder abgeschoben: Geburtenkontrolle, Familienpolitik, Sozial- und Bildungspolitik standen dabei ganz oben auf der Liste. Margaret Bondfield wurde 1929 erste Labourministerin; nach 1945 war dann auch nur eine Frau, Ellen Wilkinson, im Kabinett Attlee vertreten. In der Partei herrschten Vorstellungen von der heroischen ‘working-class Mam’ vor, die bestenfalls als passives
[Seite der Druckausg.:97]
Opfer eines bösartigen Kapitalismus imaginiert wurde, aber keinesfalls die zentrale Bedeutung eines männlich besetzten Produktions- und Arbeitsethos im Selbstbild der Partei verdrängen konnte. Es ist von daher kaum verwunderlich, dass noch in den 1960er Jahren führende Labourfrauen, wie etwa Barbara Castle oder Shirley Williams, die Bezeichnung ‘Feministin’ für sich selbst explizit ablehnten. Erst nach 1968 sollte es unter dem Eindruck des ‘second wave feminism’ zu einem Eindringen feministischer Aktivistinnen in zahlreiche Ortsverbände der Partei kommen, wobei es hier häufig zu massiven Konflikten mit den traditionellen Labourfrauen kam, die das alte, männlich geprägte Selbstbild der Partei nicht aufzugeben bereit waren.
Problematisch gestalteten sich in den 1960er Jahren auch die Beziehungen zwischen den um zentralistische Wirtschaftslenkung bemühten Labourregierungen und den auf ihre Tarifautonomie pochenden Gewerkschaften. Führende Regierungsvertreter konnten nur voll Neid auf die unproblematischen Beziehungen zwischen Attlee-Regierung und Gewerkschaftsspitzen zurückblicken. Dabei hatte sich an der Grundhaltung der Gewerkschaftsführer gegenüber der Partei eigentlich nichts geändert. Die starke formelle Macht der Gewerkschaften innerhalb der Partei (sie stellten seit 1918 eine klare Mehrheit im Parteivorstand und konnten auf Parteikonferenzen alle anderen Parteisektionen mühelos überstimmen) stand in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Bereitschaft der Gewerkschaften, sich in die Politik der Labour Party einzumischen. Mit großem Pragmatismus überließ man die politischen Geschäfte der Partei und konzentrierte sich auf die industriellen Belange der Gewerkschaftsmitglieder. Obwohl man seit 1945 von einem starken linken Gewerkschaftsflügel in der Partei (ca. 30% der Gewerkschaften standen konstant links) ausgehen kann, unterstützte die klare Mehrheit der Gewerkschaften doch regelmäßig die moderate Parteiführung. Nur auf denjenigen Politikfeldern, die direkt die industriellen Interessen der Gewerkschaften betrafen, räumten sich die Gewerkschaftsführer ein Vetorecht in Parteiangelegen-
[Seite der Druckausg.:98]
heiten ein. Dies war bereits 1931 deutlich geworden und wurde 1969, in den Diskussionen um das umstrittene Arbeitspapier von Barbara Castle ‘In Place of Strife’, aktiviert, um eine staatlich dominierte sozialpartnerschaftliche Regelung britischer industrieller Beziehungen abzulehnen. Auch beim Scheitern der social contracts 1979 fühlten sich die Gewerkschaften in ihren ureigensten Belangen von den Labourpolitikern überfordert. Maßgeblich für die starken Spannungen zwischen Gewerkschaften und Partei war wohl gerade angesichts der engen formellen Bindungen die Abwesenheit von wichtigen Integrationsfiguren, die zwischen Gewerkschafts- und Partei- bzw. Regierungsinteressen vermitteln konnten. In der Zwischenkriegszeit war Arthur Henderson eine solche Figur, und nach 1945 spielte dann Ernest Bevin eine vergleichbare Rolle. In den 1960er und 1970er Jahren hatten sie kein Pendant.
Neben den Frauen und den Gewerkschaften war es vor allem die Haltung der Labourregierung zur Einwanderungspolitik, die der Partei in den 1960er Jahren Kopfschmerzen bereiten sollte. Die offizielle Labourpolitik trat ein für das Recht auf Einwanderung aller Commonwealthbürger und für die Gleichstellung aller Rassen (racial equality). Ihre weiße Arbeiterklientel allerdings zeigte stark rassistische Tendenzen: Offen auftretende Rassisten in der Konservativen Partei, wie etwa Enoch Powell, appellierten gerade an die Arbeiter Großbritanniens. Auf den zunehmenden Rassismus im Land reagierte die Regierung Wilson einerseits mit Gesetzen, die rassische Diskriminierung unter Strafe stellte (Race Relations Act, 1965). Andererseits verkündete sie im selben Jahr Einwanderungsbeschränkungen. Drei Jahre später, 1968, verstieß die Regierung gegen ihre eigene Gesetzgebung, als sie im Commonwealth Immigrants Act offen weiße vor schwarzen Immigranten bevorzugte.
[Seite der Druckausg.:99]
4. Die 1970er Jahre: Krise, Selbstzweifel und der Ruck nach links
Obwohl die Regierung Wilson unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen zahlreiche Erfolge zu verbuchen hatte, war die öffentliche Wahrnehmung nicht positiv: Vor allem ihr Scheitern in der Wirtschaftspolitik wurde ihr vorgeworfen. Auch die schmerzhafte Abwertung des britischen Pfundes 1967 hatte die wirtschaftliche Krise langfristig nicht lösen können. Zudem wurde der Regierung vorgeworfen, die Gewerkschaften nicht ausreichend zu kontrollieren. Nach den Wahlen von 1970 fand sich die Labour Party erneut in der Opposition. Innerhalb der Partei wurden die Wilsonjahre bald zum Gegenbild der Attleejahre stilisiert: Erschienen letztere in einer Gloriole des Triumphs, so standen die Labourregierungen der 1960er Jahre (unverdienterweise) bald für gebrochene Versprechen und zerstörte Hoffnungen. Die im Gefolge der Ölkrisen der ersten Hälfte der 1970er Jahre einsetzenden wirtschaftlichen Krisenphänomene erschütterten den sozialdemokratischen Zukunftsrausch weiterhin nachhaltig. Obwohl die Parteiführung nach wie vor in moderaten Händen verblieb, begann sich die Parteibasis zu radikalisieren. Unter dem Eindruck stagflationärer Tendenzen in den 1970er Jahren wandten sich zugleich viele Gewerkschaften vom keynesianischen Konsensus ab, der die Bindung der Gewerkschaften an die moderate Parteiführung lange Jahre zementiert hatte. Einige Gewerkschaften wurden nun militanter und begannen verstärkt, den linken Parteiflügel zu unterstützen. Der von der konservativen Regierung verabschiedete Industrial Relations Act von 1971, der die Autonomie der Gewerkschaften stark beschnitt, erregte erbitterten Widerstand und provozierte eine erneute Annäherung der Gewerkschaften an die Labour Party, die 1973 in der Formulierung einer gemeinsamen wirtschaftspolitischen Konzeption gipfelte: Eine Labourregierung werde einen ‘Social Contract’ mit den Gewerkschaften schließen, der gewerkschaftliche Mäßigung bei Lohnforderungen verband mit
[Seite der Druckausg.:100]
dem Versprechen auf eine Einflussnahme der Gewerkschaften auf makroökonomische Rahmenpolitik sowie auf einen weiteren Ausbau des Sozialstaats. Zudem verpflichtete sich die Partei, den Industrial Relations Act aufzuheben.
Die Konservativen verloren bei den Wahlen vom Februar 1974 ihre Mehrheit knapp. Da diese Wahlen keine regierungsfähige Mehrheit produzierten, die Liberalen aber ein Bündnis mit den Konservativen ablehnten, gab es im Oktober 1974 erneut Wahlen, die Labour nach nur vier Jahren Opposition wieder an die Regierung brachten. Die Wirtschaft Großbritanniens schien in fliegendem Fall begriffen. Eine davongaloppierende Inflationsrate, steigende Ausgaben der öffentlichen Hand und ein riesiges Loch im Haushalt führten zu Zahlungsbilanzdefiziten und einer erneuten schweren Krise der britischen Währung. Der Regierung blieb schließlich nichts anderes übrig, als kurzfristig auf die Hilfe des International Monetary Fund (IMF) zurückzugreifen. 1975 verdoppelte sich innerhalb eines Jahres die Arbeitslosigkeit nahezu: von 678.000 auf 1.129.000 Arbeitsuchende. Vollbeschäftigung zu garantieren schien nun nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, und die Labourregierung konzentrierte sich auf die Aufrechterhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der britischen Wirtschaft. Bekämpfung der Inflation erhielt Vorrang vor Arbeitsbeschaffungsprogrammen. Der Keynesianismus erhielt ein erstklassiges Begräbnis. Der ‘Social Contract’ wurde nun einseitig dazu benutzt, von den Gewerkschaften Mäßigung bei Lohnforderungen anzumahnen. Dabei war die Regierung extrem erfolgreich: Durchschnittliche Lohnerhöhungen fielen von 26% 1975 auf 10% 1977. Die im Gegenzug versprochene Einflussnahme der Gewerkschaften auf makroökonomische politische Entscheidungsprozesse materialisierte sich allerdings kaum. Unter dem Druck der eigenen Basis wurden die Gewerkschaften erst zu unzufriedenen und dann zu unzuverlässigen Bündnispartnern der Labourregierung, der seit dem Rücktritt Wilsons 1976 James Callaghan vorstand. Nirgendwo wurde dies augenfälliger als im ‘winter of discontent’
[Seite der Druckausg.:101]
von 1979. Der Finanzminister Dennis Healey hatte im Rahmen des Social Contract mit den Gewerkschaftsführern unrealistische Begrenzungen von Lohnforderungen der Arbeiter im öffentlichen Dienst auf 5% ausgehandelt - zu einer Zeit, zu der in der privaten Industrie zweistellige Lohnerhöhungen gängig waren. An der gewerkschaftlichen Basis und bei vielen Einzelgewerkschaften hatte diese Maßnahme das Fass zum Überlaufen gebracht. Die National Union of Public Employees (NUPE) forderte im Januar 1979 eine vierzigprozentige Lohnerhöhung für ihre Mitglieder. Bald rollte eine massive Streikwelle durch das Land und drohte es, in der Wahrnehmung vieler Briten, zum Stillstand zu bringen. Als sich die Müllberge in den Straßen der Städte häuften und zahlreiche Krankenhäuser auf Notbetrieb umstellen mussten, schien vielen Briten die von den Konservativen bereits 1973 gestellte Frage danach, wer denn dieses Land regiere: demokratisch gewählte Vertreter des Volkes oder die Gewerkschaften, einleuchtend. Britische Wirtschaftshistoriker haben inzwischen eindeutig herausgearbeitet, dass das Land 1979 durchaus nicht von den Gewerkschaften in eine nachhaltige politische oder auch nur wirtschaftliche Krise gestürzt wurde. Allerdings hatte der Mythos von 1979 weitreichende Bedeutung für die Unterstützung weiter Bevölkerungsteile für die konsequent anti-gewerkschaftliche Haltung der Regierung Thatcher in den 1980er Jahren. Seit 1979 haben die britischen Gewerkschaften ein massives Legitimierungsproblem.
In den 1970er Jahren schien die Labour Party auf einem Kurs nach links, der sie nicht nur ihren kontinentalen Schwesterparteien immer weiter entfremdete, sondern sie auch innerparteilich ihrer vielleicht schwersten Zerreißprobe unterwarf. Die Regierungserfahrung der 1960er und 1970er Jahre schien der Parteilinken Beweis dafür, dass ein massives Sozialisierungsprogramm sowie stärkere Kontrollen über die Wirtschaft die Voraussetzung für eine erfolgreiche linke Wirtschaftspolitik waren. Dies führte zur Entwicklung der Alternative Econonomic Strategy (AES), die von den politischen Gegnern der Partei als Rezept
[Seite der Druckausg.:102]
für eine Wirtschaftsordnung osteuropäischen kommunistischen Zuschnitts angegriffen wurde. Protektionistische und antieuropäische Gefühlslagen schienen in der Labour Party die Oberhand zu gewinnen. Der Parteitag entschied 1980, dass nicht mehr die Fraktion allein den Parteiführer wählen, sondern ein aus Fraktion, Ortsverbänden und Gewerkschaften bestehender Wahlausschuss diese Aufgabe übernehmen sollte: ein klares Zeichen, dass die Parteibasis und die Gewerkschaftsführung unzufrieden waren mit der Fraktion. Zum ersten Mal stellte die Parteilinke 1980 mit Michael Foot auch den (allerdings noch nach altem Wahlmodus gewählten) Parteivorsitzenden. Teile des rechten Parteiflügels spalteten sich daraufhin unter Führung einer sogenannten ‘Viererbande’ (Roy Jenkins, David Owen, Bill Rodgers und Shirley Williams) 1981 von der Partei ab und gründete die Social Democrat Party (SDP), die bei den Wahlen 1983 in Allianz mit der kleinen Liberalen Partei beinahe so viele Stimmen gewann wie die Labour Party. Die SDP war pro-europäisch, pro-amerikanisch, gegen einseitige Abrüstungsmaßnahmen und für eine gemischte Wirtschaftsform. Ein anderer Teil des rechten Parteiflügels blieb allerdings, wohl vor allem aus einem Gefühl tiefer Verbundenheit zu ‘ihrer’ Partei, in der Labour Party. Unter Führung von Roy Hattersley suchten Dennis Healey, Gerald Kaufman, John Smith und andere die reformistischen Kräfte der Partei in der Labour Solidarity Campaign zu sammeln.
Was die Wählergunst anbetraf, war Labour 1983 am Tiefpunkt ihrer Nachkriegsgeschichte angelangt: 27,6% der abgegebenen Stimmen, das entsprach dem schlechtesten Ergebnis seit 1918, und 209 Sitze im Parlament, die geringste Zahl seit 1935. Nur 40% aller Gewerkschafter hatten für Labour gestimmt. Wichtige Teile von Labours Stammwählerschaft drohten abzuwandern. Die Partei ähnelte zunehmend einer Partei der Minderprivilegierten und sozial Ausgeschlossenen, die sich wahlpolitisch ins Abseits stellte. Ihre Hochburgen, wie etwa Merseyside, Mid und West Glamorgan, Tyne und Wear und Cleveland, wa-
[Seite der Druckausg.:103]
ren Regionen des industriellen Verfalls, der Langzeitarbeitslosigkeit und der allgemeinen Hoffnungslosigkeit.
5. Die 1980er Jahre: auf der Suche nach neuem sozialdemokratischen Profil
Michael Foot, der wie kaum ein anderer die Linkswende der Partei verkörperte, trat sofort nach der Wahl 1983 vom Amt des Parteivorsitzenden zurück. Sein Wunschnachfolger, der Waliser Neil Kinnock, kam ebenfalls vom linken Parteiflügel, aber unter seiner Ägide begann die Partei den langen Marsch zurück zu einem gemäßigten Sozialdemokratismus westeuropäischen Zuschnitts. Wichtigste Wegmarke war dabei der 1989 von der Partei verabschiedete Policy Review.
Die konservative Regierung unter Margaret Thatcher machte mittlerweile Großbritannien zu einem Land, dass, vom Kontinent aus betrachtet, sich immer weiter von seinen gesamteuropäisch-sozialdemokratisch geprägten Wurzeln zu entfernen schien. Als selbsternannter Apostel des freien Marktes hasste Thatcher alles, was nur im entferntesten nach Sozialismus roch: Sozialstaat, Wirtschaftslenkung, hohe Staatsausgaben, Besteuerung, soziale Umverteilung, sozialer Wohnungsbau und Arbeitsbeschaffungsprogramme. Mit Verve ging sie die Privatisierung der von Labour nach 1945 sozialisierten Industrien an. Besonders die restlose Zerstörung eines auch in Großbritannien durchaus verankerten europäischen Modells von Sozialpartnerschaft zwischen Kapital und Arbeit erregte Aufsehen. Die Gewerkschaften wurden zum innerparteilichen Feind Nummer eins erklärt. Scheibchenweise wurden die Rechte der Gewerkschaften durch sieben Employment Acts zwischen 1980 und 1990 beschnitten. Das Recht, Streikposten zu stellen, wurde eingeschränkt. Ein mit der Anstellung verbundener automatischer Gewerkschaftseintritt (closed shop) wurde verboten. Die Gewerkschaften konnten nun für während eines Streiks auftretende Schäden haftbar gemacht
[Seite der Druckausg.:104]
werden. Insgesamt wurde die rechtliche Stellung der Gewerkschaften im Verlauf der 1980er Jahre immer prekärer und der Arbeiterschutz immer weiter unterminiert. Arbeiter und Angestellte verließen die Gewerkschaften in Scharen (1979: 13,5 Millionen Mitglieder, 1991: 9,5 Millionen). Es war sicher kein Zufall, dass an den treuesten gewerkschaftlichen Bündnispartnern der Labour Party, den Bergarbeitern, ein besonderes Exempel statuiert wurde. Im beinahe zwölf Monate dauernden Bergarbeiterstreik von 1984-85, in dem es immer wieder zu erbitterten, fast bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in den diversen Kohlefeldern Großbritanniens kam, zerstörte die konservative Regierung nicht nur den einheimischen britischen Kohlebergbau und seine Gewerkschaften, sondern es ging immer auch darum, dass die Gewerkschaften insgesamt ihre mühsam errungene gesellschaftliche und politische Stellung im Land einbüßen sollten. Sie galten nicht mehr als Partner, sondern als wichtigstes Hindernis eines von den Konservativen verordneten wirtschaftlichen Kurses, der staatliche Abstinenz in der Wirtschaftslenkung verband mit Sozialdumping und finanziellen Anreizen für ausländische Investoren.
Labour verurteilte die antigewerkschaftliche Politik der konservativen Regierungen, sah sich aber 1984, angesichts des innerhalb der Partei ungemein beliebten Bergarbeiterstreiks, einem Dilemma ausgesetzt: Einerseits konnte die Partei ihre treuesten Bündnispartner nicht gut im Stich lassen, andererseits verurteilte die Parteiführung die Haltung des der extremen Linken zugehörigen Präsidenten der National Union of Mineworkers (NUM), Arthur Scargill, der den Streik ausgerufen hatte, ohne darüber unter den Mitgliedern abstimmen zu lassen. Als die Bergarbei-ter in Nottinghamshire dem Streikaufruf der Gewerkschaften nicht folgten und die Gewerkschaftsführung sogenannte ‘flying pickets’ aus anderen Teilen des Landes einsetzte, um auch in Nottinghamshire das Streikgebot durchzusetzen, kam es zu den ersten gewalttätigen Auseinandersetzungen des Konflikts. Wäh-
[Seite der Druckausg.:105]
rend der gesamten Dauer des Streiks vermied es die Parteiführung, sich eindeutig auf die Seite von Scargill zu stellen.
Neben dem Bergarbeiterstreik war die Unterwanderung der Partei durch trotzkistische Gruppierungen, die Militant Tendency, das zweite große Problem der Labour Party in der ersten Hälfte der 1980er Jahre. 1983 waren erstmals zwei offene Sympathisanten von Militant für die Partei ins Parlament gewählt worden. In einigen prominenten Constituency Labour Parties, besonders in Liverpool unter Derek Hatton, dominierte Militant die Kommunalpolitik der Partei. Zwar war die Unterstützung von Militant schon seit dem Dezember 1982 offiziell unvereinbar mit einer Labour-Party-Mitgliedschaft. Zwar hatte der Parteivorstand 1983 die fünf Herausgeber der Zeitschrift ‘Militant’ aus der Partei ausgeschlossen, was auch einige lokale Parteiverbände dazu veranlasste, Ausschlussverfahren gegen Sympathisanten von Militant anzustrengen. Aber vor größeren Aktionen schreckte die Parteiführung noch zurück. Erst 1985 ging Kinnock gegen die harte Linke in der Partei vor, als der Labour-dominierte Stadtrat von Liverpool seinen 31.000 Angestellten die Kündigung zustellen ließ. Geplant war dies als spektakulärer Protest gegen die Sparpolitik der konservativen Regierung, aber innerhalb der Labour Party stießen solche hazardistischen Strategien auch auf der Linken überwiegend auf Ablehnung.
Kinnock bemühte sich redlich, die innerparteiliche Fraktionierung der Labour Party zu überwinden und besonders die harte Linke aus der Partei herauszudrängen. Auch auf den unterschiedlichen Politikfeldern leitete er bereits in den ersten Jahren seiner Parteiführung erhebliche Änderungen ein: Die dezidiert antieuropäische Haltung wurde aufgegeben, der Resozialisierung wurde explizit keine Priorität eingeräumt, und ein weiterer Ausbau des Sozialstaates wurde abhängig gemacht von der Finanzierbarkeit weiterer Reformen. Allerdings blieben so manche Vorstellungen zum Teil sehr inkohärent. Besonders bei den Punkten Besteuerung, wo sich die Partei nicht festlegen wollte, und Verteidigung, wo Forderungen nach einseitiger Abrüstung
[Seite der Druckausg.:106]
beibehalten wurden, blieb Labour angreifbar. Was die Parteiorganisation anbetrifft, baute Kinnock nach 1985 das Büro des Parteiführers (leader’s office) zur wichtigsten Entscheidungszentrale der Partei aus. Die Kompetenzen der Parteikonferenz wurden dagegen eingeschränkt. Die Labour Party achtete nun unter den wachsamen Augen des Party Communication Director, Peter Mandelson, auf ihre Präsentation in den Medien und startete selbst mehrere glitzernde und Aufmerksamkeit erregende Werbekampagnen.
Die erneute Wahlniederlage 1987 beschleunigte nur die organisatorische und programmatische Umorientierung der Partei. Ein umfassender Policy Review wurde angekündigt, unter dessen Imprint eine kohärent moderate Labourpolitik sich abzuzeichnen begann. Begraben wurden Sozialisierungsstrategien, der Keynesianismus, staatliche Wirtschaftsplanung, Vollbeschäftigung und der weitere Ausbau des Sozialstaats. Die Thatcheristischen Reformen der industriellen Beziehungen wurden nun in weiten Teilen akzeptiert. In der Außenpolitik verabschiedete man sich von einseitiger Abrüstung und strebte statt dessen eine Annäherung an Europa explizit an. Zum Zeitpunkt der Wahlen 1992 waren alle „heiligen Kühe„ der Parteilinken geschlachtet. Zur gleichen Zeit schritt die Professionalisierung und Hierarchisierung des Parteiapparats weiter voran. Dennoch scheiterte die Partei für viele unerwartet auch 1992. Ein ganzes Paket an Gründen kann hier zur Erklärung herangezogen werden: Die Konservativen hatten sich 1990 selbst der im Land immer verhassteren Thatcher entledigt und ihre wohl unpopulärste Maßnahme, die Kopfsteuer (poll tax), durch eine am Wert des Hauses ausgerichtete Grundbesitzsteuer (council tax) ersetzt. Thatchers Nachfolger, John Major, kultivierte das Image eines moderaten Konservativen. Die wirtschaftliche Lage des Landes war nicht schlecht, und viele Wähler misstrauten dem neuen Image der Labour Party noch. Gerade der Parteivorsitzende wurde oft kritisiert, hatte er doch selbst eine linke Vergangenheit, in der er gegen alles gestanden hatte, für das er nun einzu-
[Seite der Druckausg.:107]
treten bereit war. Der Vorwurf des Opportunismus lag nah. Es half auch nicht, dass Kinnock Waliser war, was es den Konservativen erlaubte, englische Vorurteile gegen ‘walisische Windbeutel’ (‘Welsh windbags’) zu mobilisieren. Schließlich mag auch die Haltung der einflussreichen Murdochpresse beim Ausgang der Wahlen eine gewisse Rolle gespielt haben. Die auflagenstarke ‘Sun’ wartete am Wahltag mit der Schlagzeile auf: ‘in the event of a Labour victory will the last person to leave the UK please switch off the light.’ Am nächsten Tag war sie die erste, die behauptete: ‘[it was] the Sun who won it.’ Für Kinnock war der Ausgang der Wahl auch persönlich eine schwere Enttäuschung und Niederlage. Er legte den Parteivorsitz nieder und machte Platz für einen glaubhafteren Reformisten: John Smith. Besonders die innerparteilichen Reformen wurden unter ihm konsequent fortgeführt. 1992 wurde der union bloc vote auf Parteitagen abgeschafft, und ein Jahr später wurde das Prinzip ‘one member, one vote’ für Wahlen zum Parteivorsitz und stellvertretenden Parteivorsitz eingeführt.
6. Die 1990er Jahre: Speerspitze eines ‘liberalen Sozialismus’
Nach dem völlig überraschenden Tod von John Smith 1994 übernahm der mit einer Überdosis jugendlichen Charmes ausgerüstete Erzreformer Tony Blair das Amt des Parteivorsitzenden. Ihm gelang, woran Gaitskell 1959 gescheitert war: Die der Sozialisierung verpflichtete Clause Four wurde 1995 ersetzt durch ein Bekenntnis zu einem ethisch fundierten demokratischen Sozialismus: „The Labour Party is a democratic socialist party. It believes that by the strength of our common endeavour we achieve more than we achieve alone, so as to create for each of us the means to realise our true potential and for all of us a community in which power, wealth and opportunity are in the hands of the many, not the few. Where the rights we enjoy re-
[Seite der Druckausg.:108]
flect the duties we owe. And where we live together, freely, in a spirit of solidarity, tolerance and respect." Die engen formellen Beziehungen zu den Gewerkschaften wurden gelockert, ohne dass die Gewerkschaften der Partei ihre Unterstützung entzogen. Ihnen blieb letztendlich gar nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, dass eine Labourregierung zumindest die wichtigsten Diskriminierungen wieder aufheben und den Gewerkschaften zu neuer Bewegungsfreiheit verhelfen werde. Insgesamt sind diese Erwartungen von Blair auch erfüllt worden, wobei unübersehbar ist, dass der Habitus des Premierministers vom Habitus des Gewerkschafters meilenweit entfernt ist. Seiner Herkunft nach (Blairs Vater war konservativer Stadtrat. Blair selbst bezeichnet sich als christlicher Sozialist.) steht Blair den Gewerkschaften eher distanziert gegenüber, und es verwundert auch nicht, dass es im Kabinett nur wenige Minister mit Gewerkschaftserfahrung gibt. Für die einflussreichen politischen Berater Blairs gilt dies erst recht.
Nach den Vorstellungen innerparteilicher Reformer sollte die Partei endlich von einer Gewerkschafts- zu einer Mitgliederpartei umgestaltet werden. Aufwendige Werbekampagnen brachten tatsächlich einen Anstieg der Mitgliedschaft von 266.000 im Jahre 1988 auf 405.238 im Jahre 1999. Doch bereits 1999 fielen die Mitgliederzahlen erstmals seit zehn Jahren auf 387.776. Die Demokratisierung innerparteilicher Entscheidungsprozesse wurde mit dem Ziel, den Einfluss linker Parteigruppen auf die Parteipolitik weiter zu begrenzen, fortgeführt. Zugleich sollte die Parteiführung weniger stark an in der Partei organisierte Interessen gebunden werden. 1997 entmachtete sich die Parteikonferenz weiter, indem sie das von Blair unterstützte organisatorische Reformpaket (‘Partnership into Power’) annahm. Die Grundpfeiler der Parteipolitik werden seitdem nicht mehr von der Parteikonferenz, sondern von einem 175-köpfigen National Policy Forum bestimmt. Die Zusammensetzung des Parteivorstands wurde ebenfalls so geändert, dass die Position des Parteivorsitzenden weiter gestärkt wurde. Im Hinblick auf eine stärke-
[Seite der Druckausg.:109]
re Gleichberechtigung der Geschlechter führte die Partei erstmals 1989 Quoten für die Wahlen zum Vorstand und zum Schattenkabinett ein. 1996 verbot ein Arbeitsgericht in Leeds die Quotierung von innerparteilichen Ämtern und von Parlamentskandidaten ironischerweise als Verstoß gegen den Sex Discrimination Act. Die Partei ging gegen diese Entscheidung nicht in die Berufung, fand allerdings mit dem ‘pairing arrangement’ in den Wahlen zum walisischen Parlament 1999 einen neuen modus vivendi, der vorsah, dass jeder zweite Parlamentskandidat der Partei eine Frau sein musste.
Blair bemühte sich auch nachhaltig darum, die Partei nicht mehr als allein produktionistischen Normen verpflichtete Arbeiterpartei erscheinen zu lassen, sondern Arbeiter und Mittelschichten gemeinsam als Konsumenten anzusprechen. Die in der Labour Party immer wieder ausgeprägte Verachtung vor allem sozialistischer Ideologen für die angebliche Unreife der Wähler und für die Bedeutsamkeit von Wahlerfolgen teilte Blair nicht. Er setzte auf medienwirksam inszenierte Partei-PR, die nicht nur ein moderates und einheitliches Selbstbild beförderte, sondern außerdem weitreichende inhaltliche Angebote machte, die in der Lage schienen, breite Wählerschichten anzusprechen. Dabei distanzierte sich Blair explizit von dem, was die alte Labour Party angeblich ausgemacht hatte: Staatsinterventionismus, Keynesianismus, umfassender Sozialstaat, Gewerkschaftspartei, Partei des ‘tax and spend’. Statt dessen postulierte er die Idee von einer neuen, wiedergeborenen Partei, ‘New Labour’, die zwar den alten sozialdemokratischen Werten verpflichtet blieb, aber von überkommenen Politikvorstellungen Abschied nahm, um ‘suburban Middle England’ zu gewinnen, den Konservativen ihren Status als ‘one nation party’ streitig zu machen und einen linken Patriotismus zu mobilisieren, der nicht zuletzt seinen Ausdruck in ‘cool Britannia’ und der Modellhaftigkeit von ‘New Labour, New Britain’ fand. Blair und sein Finanzminister Gordon Brown bezeichneten sich explizit als ‘liberale Sozialisten’, angetreten, die alten Antagonismen von Markt und Staat, Frei-
[Seite der Druckausg.:110]
heit und Gleichheit zu überwinden. Sie standen dabei durchaus in einer Parteitradition, aber diese war nicht leicht offen zu verteidigen, verband sie sich doch mit den bestgehassten ‘Verrätern’ in der Parteigeschichte: Ramsay MacDonald, der 1931 die Partei verließ und ein Bündnis mit den Konservativen einging, und die ‘Viererbande’, die 1981 die SDP gegründet hatten. Bei solchen Ahnen war es verständlich, dass man das label ‘New Labour’ vorzog.
Diese Taktik war fraglos erfolgreich.1997 erreichte Blair den dritten überzeugenden Wahlsieg in der Parteigeschichte Labours gegen die Konservativen: Zum ersten Mal seit 18 Jahren stellte die Labour Party wieder eine Regierung. Wie sieht die Bilanz der Regierung Blair nach nunmehr drei Jahren aus? Der Aufrechterhaltung eines modernen Sozialstaats sieht sich die Regierung verpflichtet. Bereits 1994 empfahl die von der Partei eingesetzte Social Justice Commission eine nachhaltige Verbindung von Gemeinschaftsidealen mit der Marktgesellschaft, um einen modernen Sozialstaat finanzieren zu können. Dabei setzte die Regierung Blair sicher weniger auf Staat als die Regierungen Attlee und Wilson. Es geht ihr nicht um die Wiederbelebung des allumfassenden Interventionsstaates der 1960er Jahre, sondern vielmehr um den Aufbau dessen, was Labour-Party-Vordenker einen ‘enabling state’ nennen – einen Staat, der es aktiven Staatsbürgern erleichtert, sich in ihren alltäglichen Lebensbezügen politisch und sozial zu engagieren. Nach dem Thatcherismus, für den es bekanntlich nur Einzelne, aber keine Gesellschaft (‘there is no such thing as society’) gegeben hatte, versucht ‘New Labour’ eine Wiederbelebung ethisch fundierter Gemeinschaftsideen, wie sie vor allem im modernen Kommunitarismus vertreten werden. Dabei werden allerdings gerade in der Innenpolitik der Labourregierung häufig autoritäre Lösungen sozialer Konflikte angestrebt, die traditionellen ‘law and order’-Konzepten der Konservativen ebenso verwandt sind wie sozialdemokratischen Vorstellungen von einem 'social engineering’, die die ‘kleinen Leute’ oftmals zu bloßen Objekten der Politik
[Seite der Druckausg.:111]
degradieren. Beispiele wären hier die nächtlichen Sperrstunden für Kinder, Geldstrafen für Eltern, deren Kinder dauerhaft die Schule schwänzen, oder auch eine geplante Werbekampagne, Bettlern keine Almosen mehr zu geben, da diese ohnehin nur in Alkohol oder Drogen umgesetzt würden.
Der staatliche (u.U. auch eiserne) Wille zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung einer ethisch fundierten Gemeinschaft wird auch in den Plänen der Labourregierung zur Arbeitsgesellschaft deutlich: Die zentrale Bedeutung des Faktors Arbeit wird hier betont. Auch hier weiß sie sich den sozialdemokratischen Traditionen der Partei verpflichtet, gehört doch das Recht auf Arbeit zu den frühesten Forderungen der Labour Party nach 1900. Für diese Arbeit führte die Labourregierung 1998 erstmals Mindestlöhne ein, um die skandalöse Niedrigstlohnwirtschaft der 1980er Jahre zu überwinden, und sie garantierte zudem das Recht auf gewerkschaftliche Vertretung in denjenigen Betrieben, wo die Mehrheit der Belegschaft sich für eine solche Vertretung ausspricht. Damit wurde die unter Thatcher gängige Behandlung der Gewerkschaften als outlaws rückgängig gemacht.
Gerade Bildung und Ausbildung sind zentrale Bestandteile des Regierungskonzepts für mehr Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Prosperität. Schulen und Hochschulen erhalten wesentlich mehr Geld, um Klassenstärken zu verringern und höhere Ausbildungsstandards zu gewährleisten. In Partnerschaft mit der Wirtschaft startete die Regierung eine Kampagne für mehr Ausbildungsplätze für arbeitslose Jugendliche. Gerade in den Armenghettos der Großstädte sollten die Menschen von ihrer ‘welfare dependency’ geheilt werden, indem ihnen nachhaltig Arbeitsangebote gemacht werden sollten. Im Juli 1997 wurden 5,2 Millionen Pfund einer einmaligen Steuer, die einigen der unter Thatcher privatisierten Industrien auferlegt wurde, dazu benutzt, ein sogenanntes ‘welfare to work’-Programm zu finanzieren, das vor allem die Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit reduzieren soll. Im Januar 1998 wurde speziell für junge Arbeitsuchende zwischen 18 und 24 Jahren ein ‘new deal’ ver-
[Seite der Druckausg.:112]
kündet, der die Bereitstellung von Arbeitsplätzen durch private Betriebe staatlich subventioniert. Wer sich allerdings dem ‘new deal’ verweigert, dem wird die Unterstützung gestrichen. Insgesamt gelten aber Bildung und Erziehung Labour immer noch als der große Egalisator auf der Suche nach mehr sozialer Gerechtigkeit. Sind einzelne Maßnahmen der Regierung, wie etwa die Kürzung der Sozialbezüge für alleinerziehende Eltern, in der linken Öffentlichkeit auf massive Kritik gestoßen, so bleibt doch festzuhalten, dass die Budgets der Labourregierung bislang im klassischen Sinne redistributiv waren, auch wenn dies vom Schatzkanzler nicht gerade an die große Glocke gehängt wurde.
Einen wichtigen Akzent setzte die Regierung auch bei der Modernisierung des britischen Verfassungswesens, wo Blair nahtlos an die Bemühungen von Morrison und Crossmann anknüpfte. Zum einen verschrieb sie sich der Regionalisierung. Schottland, Wales und Nordirland bekamen ihre eigenen Parlamente mit jeweils unterschiedlichen Regierungsbefugnissen. In Nordirland wurde zudem ein Friedensprozess in Gang gebracht, der trotz zahlreicher Rückschläge die Aussicht hat, Nordirland dauerhaft zu befrieden und damit den 1974 von einer anderen Labourregierung eingeführten Prevention of Terrorism Act, der im Prinzip ein militärisches Engagement der Briten in Nordirland zur Folge hatte, überflüssig zu machen. Zum anderen begab sich die Partei auf einen Kurs der Annäherung zu den Liberalen, die neue Formen der Koalitionsregierung nahelegen. In Schottland und Wales kam es zu formellen Koalitionsregierungen, und in Westminster sind die Liberalen z.T. in die Planungsphasen diverser Gesetzgebungsvorhaben der Labourregierung mit einbezogen. In Westminster geschieht dies, obwohl die Mehrheitsverhältnisse durchaus eine Alleinregierung erlauben würden. Eine solche Praxis nährt die Gerüchte, dass Blair auf mittlere Sicht auch eine Wahlreform anstrebt, die das Mehrheitswahlrecht durch ein Proportionalwahlrecht ersetzen würde. Eine solche Maßnahme würde die politische Landschaft Großbritanniens nachhaltig verändern. Die Konservative Partei müsste sich ge-
[Seite der Druckausg.:113]
mäßigteren, christdemokratischen Positionen annähern, um koalitions- und damit mehrheitsfähig zu werden. Eine radikal-fundamentalistische Konservative Partei, wie sie z.Z. William Hague vertritt, wäre unter einem Proporzwahlrecht zu dauerhafter Opposition verdammt. Daneben kam es zu einer Reform des Oberhauses, die auf mittlere Sicht die erblichen Lords ganz durch ernannte Vertreter ersetzen wird. Ein ebenfalls geplanter Freedom of Information Act, der vor allem eine größere Transparenz des politischen Systems garantieren sollte, ist allerdings bislang noch nicht über die Veröffentlichung eines eher enttäuschenden White Paper hinausgekommen.
Die Umweltpolitik war lange Zeit Stiefkind der britischen Labourpolitik. Sozialismus wurde verbunden mit Vorstellungen größerer Modernität, größerer Moralität und größerer Effizienz. Die organisatorische Komplexität der Moderne werde zwangsläufig zum Sozialismus führen. In diesen Zukunftsvisionen wurde die zerstörerische Potenz dieser Moderne, wenn überhaupt, nur am Rande wahrgenommen. Die Abwesenheit einer starken grünen Bewegung in Großbritannien brachte auch parteipolitisch keinen Druck, diese Haltung zu ändern. Ein parteiinterner Umdenkungsprozess führte erst in den 1990er Jahren dazu, dass der Umweltpolitik etwa in den neuesten Policy-review-Programmdebatten ein zentraler Platz eingeräumt wird. Unter dem energischen Umweltminister Michael Meacher versucht die Labourregierung auch international Maßstäbe zu setzen, etwa was Emissionsgesetze anbetrifft. Insgesamt allerdings nimmt gerade im Vergleich zu Deutschland die Umweltproblematik eine vergleichsweise geringe Rolle im öffentlichen Politikdiskurs ein. Umweltbewusstsein ist auf der Insel auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch weitgehend ein Fremdwort.
Außenpolitisch verkündete Robin Cook eine ‘ethische Außenpolitik’ der Labourregierung, die sich durch den Einsatz für die internationale Aufrechterhaltung von Menschenrechten und demokratischen Prinzipien auszeichnen sollte. Beim Waffenexport in Länder der sogenannten Dritten Welt, im Krieg mit Ser-
[Seite der Druckausg.:114]
bien (wo die britische Labourregierung zu den Scharfmachern gehörte) und im Zimbabwekonflikt zeigte sich allerdings bald, dass die alten Spannungen zwischen Realpolitik und ethisch fundierten Prinzipien auch in den 1990er Jahren unvermindert fortbestanden. In den 1940er ebenso wie in den 1960er Jahren standen Labourregierungen einerseits für einen eurozentrischen Internationalismus, eine Politik des Friedens, des Anti-Imperialismus und der Menschenrechte, andererseits produzierte eine Labourregierung die britische Atombombe, konzipierte die NATO und wurde in blutige Kolonialkriege verwickelt.
Eher enttäuschend entwickelte sich auch das Verhältnis der Labourregierung zu Europa. Hier wurde der Anspruch Blairs, Großbritannien vom Abstellgleis weg zu bringen und es zum Motor der europäischen Einigung zu machen, weitgehend nicht eingelöst. Insgesamt sind nach 1945 starke Stimmungsschwankungen in der Haltung der Labour Party zur Europäischen Union (EU) charakteristisch. Ernest Bevin trat nachhaltig für eine westeuropäische Union ein, sah allerdings, ähnlich wie Winston Churchill, kaum einen Weg, der die globalen Interessen des britischen Weltreiches mit einem europäischen Engagement verbinden konnte. Dazu kam noch eine bei einigen Labourpolitikern ausgeprägte innenpolitisch motivierte Ablehnung der wirtschaftlichen Konföderationspläne hinzu: wie es in Morrisons bekanntem Bonmot im Blick auf eine britische Beteiligung an westeuropäischen Unionsplänen auf das Essentielle verkürzt heißt: ‘the Durham miners won’t wear it.’ Die Wilsonregierungen in den 1960er Jahren traten für einen Eintritt in die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ein, allerdings begegnete Großbritannien zu dieser Zeit einem hartnäckigen Veto des französischen Präsidenten. 1971, als unter einer konservativen Regierung dann der Beitritt erfolgte, stimmte eine Mehrheit der Partei im Parlament gegen den Beitritt. 1974 war es dann allerdings eine Labourregierung, die erfolgreich die Beitrittsbedingungen in Brüssel nachverhandelte. Die antieuropäische Grundhaltung der dominanten Parteilinken 1980 war schließlich der
[Seite der Druckausg.:115]
unmittelbare Anlass für die Spaltung der Partei 1981. Spätestens seit 1989 ist die Partei offiziell wieder pro-europäisch. Eine der ersten Maßnahmen der Regierung Blair war der Beitritt Großbritanniens zur europäischen Sozialcharta. Außerdem implementierte die Regierung die europäische Arbeitszeitdirektive und sprach sich wiederholt für einen Beitritt des Landes zur europäischen Währungsunion aus, allerdings unter der Voraussetzung, dass die ökonomischen Rahmenbedingungen stimmen und die Mehrheit der Bevölkerung in einem Referendum der Abschaffung des einheimischen Pfundes zustimmt. Von einer offensiven Werbekampagne für Europa kann aber, wohl auch mit Blick auf die starken Divergenzen in der eigenen Partei, nicht die Rede sein.
Blair wird häufig vorgeworfen, einen Napoleonischen Führungsstil zu pflegen, Entscheidungen inmitten von handverlesenen und demokratisch nicht legitimierten persönlichen Beratergremien zu fällen und alsdann durch geschickte Medienmanipulation der Partei aufzuzwingen. Dass Blair die Medien geschickt zu nutzen versteht, ist dabei sicher richtig. Allerdings fehlt bei dieser Argumentation der Hinweis, dass durch die gesamte Geschichte der Partei hindurch Führungspersönlichkeiten oft von zentraler Bedeutung für die Entwicklung der Partei und ihrer Politik waren. Das gilt für Ramsay MacDonald, Ernest Bevin, Clement Attlee, Harold Wilson ebenso wie für Jim Callaghan, Dennis Healey, Neil Kinnock und eben auch Tony Blair. Auch dies verweist abschließend noch einmal darauf, dass ‘New Labour’ durchaus nicht das Resultat einer Politik des ‘verbrannten Bodens’ ist, sondern dass die neue Partei sich durchaus den sozialdemokratischen Traditionen von ‘Old Labour’ verpflichtet weiß. Obwohl die meisten Projekte der Regierung Blair noch in ihrer Anfangsphase stecken, kann sich nach drei Jahren die Bilanz durchaus sehen lassen. Blair scheint auf dem besten Weg, sein Verspechen aus dem Jahr 1997 einzulösen, wonach seine Regierung ‘one of the great reforming governments in British history’ werden sollte.
[Seite der Druckausg.:116 = Leerseite]
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | April 2001