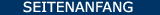![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
-
4. Gesamtwirtschaftliche Nachfrage und Beschäftigung
[Seite der Druckausg.: 82 ]
4. Gesamtwirtschaftliche Nachfrage und Beschäftigung
4.1 Produktions- und Beschäftigungseffekte einer Nachfrageveränderung
Welchen Einfluss die Nachfrage auf die Produktion und über diese auf die Beschäftigung ausüben kann, ist in der Wirtschaftswissenschaft durchaus umstritten. Mikroökonomisch wird seit Marshall die Position vertreten, dass Angebot und Nachfrage den Preis und gleichzeitig die Produktionsmenge bestimmen. Demnach würde eine Erhöhung der Nachfrage die produzierte Menge und den Preis erhöhen. Die Ausnahmen, bzw. Extremfälle, sind die beiden Sonderfälle eines vollkommen unelastischen und eines vollkommen elastischen Angebots. Ein vollkommen unelastisches Angebot bedeutet, dass sich eine Nachfrageerhöhung ausschließlich in einer Preiserhöhung niederschlägt, während die produzierte Menge unverändert bleibt. Liegt dagegen ein vollkommen elastisches Angebot vor, so wird die Nachfrageerhöhung zu einer von keinerlei Preiserhöhung begleiteter Ausdehnung der produzierten Menge führen. Marshall war der Auffassung, dass die Elastizität des Angebots eine Frage der zugrunde liegenden Frist ist: in der ultrakurzen ist das Angebot starr, in der langen dagegen sehr elastisch.
Auch in der Makroökonomik geht es um die Frage, ob man bei einer Variation der Nachfrage eher mit Preis- oder Mengeneffekten zu rechnen habe. Es liegt auf der Hand, dass das Vertrauen, das man in eine im wesentlichen auf die Beeinflussung der Nachfrage gerichtete Politik zu setzen gewillt ist, entscheidend von der Beantwortung dieser Frage abhängt. Wer den Effekt einer Nachfragestimulierung vorrangig im Auftrieb des Preisniveaus sieht, wird sich kaum zu einer solchen Maßnahme entschließen können. Derjenige, der sich davon überwiegend mengenmäßige, also produktionserhöhende Auswirkungen verspricht, wird zu einer ganz anderen Einschätzung kommen und viel eher bereit sein, eine Politik zu unterstützen, die auf eine Ausdehnung der effektiven Nachfrage hinausläuft.
[Seite der Druckausg.: 83 ]
Mit der bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnten Phillips-Kurve [Fn.71: Phillips selbst ging es um den Zusammenhang zwischen der Arbeitslosenquote und der Veränderungsrate der Nominallöhne. Der stabile nicht-lineare Zusammenhang, den er dafür für Großbritannien fand, ist nach ihm, insbesondere von Samuelson und Solow, dann auf einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und Inflationsrate übertragen worden. Auf diese modifizierte Phillips-Kurve beziehen wir uns hier. Siehe Phillips, A.W.H., The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957, Economica 25 (1958), S. 283-299; Samuelson, P.A. and Solow, R.M., Analytical Aspects of Antiinflation Policy, American Economic Review 40 (1960), S. 177-194] schien ein allgemeiner Konsens gefunden, was die jeweilige Bedeutung von Mengen- und Preiseffekten anbetraf. Bei hoher Arbeitslosigkeit, so die vorherrschende Überzeugung, wird eine Stimulierung der Nachfrage vor allem einen Mengeneffekt auslösen, also Produktion und Beschäftigung positiv beeinflussen, das Preisniveau dagegen nicht all zu stark, eventuell sogar überhaupt nicht beeinflussen. Gerade umgekehrt bei einem schon einigermaßen hohen Beschäftigungsstand: Eine weitere Ausdehnung der Nachfrage hat vor allem eine Erhöhung des Preisniveaus zur Folge, während die Auswirkungen auf die Beschäftigung bescheiden bleiben.
Diese Einschätzung, die in den sechziger Jahren auch mit den vorliegenden Erfahrungen einigermaßen konform ging, ist dann durch empirische und theoretische Entwicklungen stark in Frage gestellt worden. Die Stagflationserfahrung hat die zuvor für gesichert gehaltene Stabilität der Phillips-Kurve erheblich in Zweifel gezogen. Eine stabile Phillips-Kurve erfordert Gegenläufigkeit von Inflationsrate und Arbeitslosenquote, was man erlebte, war aber der gleichzeitige Anstieg beider Größen [Fn. 72: In den USA betrug die durchschnittliche jährliche Inflationsrate zwischen 1973 und 1983 8,4 Prozent, die durchschnittliche Arbeitslosenquote 7,2 Prozent - beides Werte, die deutlich über denen lagen, die man davor kannte.] und daneben ein Rückgang von Produktions- und Produktivitätswachstum. Damit war aber auch das nachhaltig in Frage gestellt, was man zuvor als sichere Erkenntnis angesehen hatte, nämlich dass die relativen Preis- und Mengeneffekte einer Nachfrageausweitung vom jeweiligen Zustand der Ökonomie, wie er etwa in der Arbeitslosenquote zu Ausdruck kommt, abhängen. Die bereits an früherer Stelle erwähnten theoretischen Entwicklungen taten ein übriges, die bis dahin vorherrschenden Vorstellungen in Bedrängnis zu bringen.
In den neunziger Jahren trat - allerdings nur - in den USA etwas ein, das für die Theoretiker wiederum neue Herausforderungen aufwarf. Mit der vertikal verlaufenden langfristigen Phillipskurve hatten sie eine Begründung dafür zu finden versucht, dass - jedenfalls langfristig - nicht mit einem "trade-off" zwischen Inflationsrate und
[Seite der Druckausg.: 84 ]
Arbeitslosenquote gerechnet werden könne. Der Versuch, durch Stimulierung der Nachfrage die Beschäftigungssituation zu verbessern, müsse, wenngleich nicht in der kurzen Frist, so doch jedenfalls in der langen, scheitern [Fn. 73: Die heute nicht nur bei Monetaristen sondern auch bei New Keynesians verbreitete Vorstellung, dass in langfristiger Betrachtung eine Nachfragestimulierung sich ausschließlich in Preissteigerungen niederschlagen wird, stellt die Marshallsche Vermutung gerade auf den Kopf, der ja in der (sehr) kurzen Frist eine Dominanz des Preiseffekts, in der längeren dagegen vorrangig einen Mengeneffekt erwartete.] . Was bleibe, sei eben letztendlich doch nur eine Erhöhung der Inflationsrate. Nicht vorgesehen war allerdings das, was dann die Entwicklung der neunziger Jahre in den USA kennzeichnen sollte: Ein eindeutiger Rückgang der Arbeitslosenquote und gleichzeitig ein Rückgang der Inflationsrate, also gerade die Umkehrung der Stagflationserfahrung.
Wie im folgenden deutlich werden wird, ist der langanhaltende Aufschwung der US-amerikanischen Ökonomie durch eine starke Nachfrage aufrechterhalten worden. Dass die bei einer sinkenden (und inzwischen im historischen Vergleich ungewöhnlich niedrigen) Arbeitslosenquote eigentlich zu erwartenden Inflationsgefahren bisher nicht zur Realität geworden sind [Fn. 74: Ganz entscheidend für die weitere Entwicklung der Inflationsrate dürfte sein, was mit dem Preis für Rohöl weiter geschehen wird. Er ist zuletzt stark gestiegen und das hat nicht nur damit zu tun, dass erstmals wieder Absprachen zwischen den ölproduzierenden Ländern zu funktionieren scheinen. Selbstverständlich kommt dazu, dass ein Boom in einem so wichtigen Industrieland wie den USA die Nachfrage nach diesem immer noch wichtigen Rohstoff stimuliert. Die Abhängigkeit davon ist sicher nicht mehr so groß wie in den siebziger und achtziger Jahren, es wäre aber falsch, die Bedeutung der Preisentwicklung dieses Rohstoffs zu unterschätzen.] , hat aber möglicherweise auch mit Veränderungen auf der Angebotsseite zu tun. Ohne dass man daraus schon auf eine Veränderung des Trends schließen könnte, hat sich in den letzten Jahren in den USA eine bemerkenswerte Erhöhung im Produktivitätswachstum ergeben und gerade das könnte erklären, weshalb es über eine Reihe von Jahren möglich war, gleichzeitig die Arbeitslosenquote und die Inflationsrate zu reduzieren.
Die besonders günstige Konstellation die sich in den letzten Jahren für die USA ergeben hat (sinkende Arbeitslosigkeit, rückläufige Inflationsrate, Anstieg der Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität), veranlasste manchen Beobachter dazu, dies bereits als den Beginn ganz neuartiger Verhältnisse zu sehen - von einer "new economy" ist die Rede. Andere, die die Neigung der Ökonomen kennen, aus eher kurzfristigen Entwicklungen gleich auf langfristige Entwicklungen zu schließen, warnen davor, aus den veränderten Erfahrungen weniger Jahre gleich auf
[Seite der Druckausg.: 85 ]
grundsätzlich neuartige Verhältnisse für viele kommende Jahre zu schließen [Fn. 75: "[I]t is far too early to make definitive judgements on such matters until sufficient time passes to have some historical perspective" Blinder, A., The Internet and the New Economy, The Internet Policy Institute, January 2000, S.1 http://www.brookings.edu/views/papers//blinder/20000131 .htm] . Wir werden auf die hiermit verbundenen Fragen zurückkommen. Zunächst wollen wir uns aber der Frage zuwenden, weshalb in den neunziger Jahren die Entwicklungen in den USA und in Deutschland so unterschiedlich waren. Dafür geben u.E. die im vorangegangenen Kapitel diskutierten Punkte keine Antworten, da man in den neunziger Jahren hier eher Annäherung als eine weitere Auseinanderentwicklung feststellen kann. Die Antworten sind nach unserer Auffassung daher eher zu finden, wenn man sich den makroökonomischen Bedingungen zuwendet, denen die beiden Ökonomien in dem Zeitraum ausgesetzt waren, in dem sie sich besonders unterschiedlich entwickelt haben. Darauf soll im folgenden besonders eingegangen werden.
4.2 Zur Bedeutung der effektiven Nachfrage in den USA
Da sich die besonders günstige Beschäftigungsentwicklung in den USA vollzogen hat, ist es sinnvoll, die Frage nach der Bedeutung der Nachfrageseite zunächst im Hinblick auf diese Ökonomie zu stellen. Geradezu notwendig ist es angesichts der in Deutschland vorherrschenden Diskussion, in bezug auf die USA zu zeigen, dass es dort eben nicht nur die angeblich so viel höhere Flexibilität des Arbeitsmarkts gab, sondern auch andere Umstände, die sich günstig auf die Beschäftigungssituation ausgewirkt haben. Wir wollen hier nicht den Versuch unternehmen, den quantitativen Beitrag der jeweiligen Faktoren abzuschätzen. Notwendig erscheint uns aber, auf die andere und in Deutschland weitgehend übersehene Seite des amerikanischen Beschäftigungswunders einzugehen, nämlich auf die Rolle der Nachfrageseite.
Wir wollen uns dabei insbesondere auf die Entwicklung in den neunziger Jahren konzentrieren, da sich die Unterschiede in der deutschen und amerikanischen Entwicklung hier besonders deutlich zeigen. Dabei können wir allerdings nicht ganz darauf verzichten, auf die vorangegangene, vor allem auf die von den "Reaganomics" geprägte Phase einzugehen und auf die Unterschiede aufmerksam zu machen.
[Seite der Druckausg.: 86 ]
4.2.1 Das Zwillingsdefizit unter Reagan
In der Regierungszeit von Reagan wurde, offiziellen Bekundungen zufolge, einer nachfrageseitig ansetzenden Politik überhaupt kein Kredit eingeräumt, man setzte voll und ganz auf die "supply siders", d.h. auf die Angebotstheoretiker. Selbst Maßnahmen, für die es plausible Begründungen auf der Grundlage der keynesianischen Theorie gab, wurden nicht mit diesen, sondern mit angebotstheoretischen Argumenten implementiert. Die durchgeführten Steuersenkungen sind hier ein besonders deutliches Beispiel. Im Kontext der keynesianischen Theorie sind Steuersatzsenkungen eine Maßnahme, um Investoren und Konsumenten weniger Mittel abzunehmen und um damit zu erreichen, dass deren Nachfrage zunimmt. Von der solchermaßen stimulierten Nachfrage wird eine höhere Produktion und höhere Beschäftigung erhofft, was dann - über die Verbreiterung der Steuerbemessungsgrundlage - wiederum auf höhere Steuereinnahmen hoffen lässt.
Die Angebotstheoretiker verfochten die gleiche Sache, nämlich eine Senkung der Steuern, vor allem der Einkommensteuer, mit ganz anderen Argumenten. Dabei spielte die zu Unrecht für originell gehaltene Laffer-Kurve eine besondere Rolle. [Fn. 76: Die von einem Ökonomen namens Laffer dem amerikanischen Präsidenten plausibel gemachte Idee hätte dieser schon in Gullivers Reisen nachlesen können. Aber wann kommt man als Präsident schon zum Lesen?] Sie machte, kurz gesagt, von der zunächst einmal sicher nicht falschen Einsicht Gebrauch, dass ein Staat keine Einkünfte erzielt, wenn er seinen Bürgern gar keine Steuern abnimmt, aber auch nicht, wenn er ihnen eine 100 Prozent-Steuer auferlegt. Dass er im erstgenannten Fall keine Steuern einnimmt, ist offensichtlich. Dass er aber auch im zweiten keine erhält, liegt einfach daran, dass niemand bereit sein wird, den Steuertatbestand zu erfüllen.
Aus diesem recht simplen Gedanken folgt zunächst nur, dass der Staat mit einem möglichst hohen Steuereinkommen sicher nicht bei diesen Extremen, sondern nur irgendwo dazwischen, also bei einem Steuersatz zwischen null und hundert Prozent rechnen kann. Zulässig ist auch die Folgerung, dass eine Steuersatzreduktion grundsätzlich durchaus auch zu Steuermehreinnahmen führen kann - dann nämlich, wenn sich als Folge der Steuersatzsenkung eine so starke Ausweitung der
[Seite der Druckausg.: 87 ]
Steuerbemessungsgrundlage ergibt, dass im Endeffekt die Steuereinnahmen zunehmen.
Eher fahrlässig ist dagegen die Behauptung, man brauche nur in einer bestimmten Situation den Steuersatz zu senken, um mehr Steuern einzunehmen. Genau das scheint aber Laffer seinem Präsidenten suggeriert zu haben. Dieser inszenierte jedenfalls ein großangelegtes Steuersenkungsprogramm und verfolgte gleichzeitig ein ehrgeiziges Rüstungsprogramm mit entsprechenden Ausweitungen der staatlichen Ausgaben. Da Laffer und sein Präsident die grundsätzliche Möglichkeit, durch Steuersatzsenkungen zu Steuermehreinnahmen zu gelangen, nun offenbar nicht nur für eine grundsätzliche, sondern auch für eine unter den damaligen Bedingungen funktionierende hielten, schienen ihnen die Senkung der Steuersätze und die Ausweitung der Ausgaben durchaus vereinbar. Die Realität verweigerte sich allerdings diesem Wunschdenken: Riesige Defizite im Federal Budget waren die Folge.
Mit dem Defizit im Staatshaushalt einher ging ein ebenso bemerkenswertes Defizit in der Leistungsbilanz. Ein Leistungsbilanzdefizit bedeutet, dass ein Land seinen Devisenbestand reduziert und/oder sich gegenüber dem Ausland (zusätzlich) verschuldet, also (netto) einen Kapitalimport verzeichnet. Normalerweise ist das einem Land nur vorübergehend möglich, da es immer schwieriger wird, die notwendigen Kapitalimporte zu erhalten. Für ein Land, das über eine Leitwährung verfügt, stellt sich das allerdings anders dar: Gestützt auf den Dollar haben die USA in dieser Hinsicht ganz andere Möglichkeiten als andere Länder. Hohe Kapitalimporte, auch über einen längeren Zeitraum, sind jedenfalls für die USA noch kein Grund, einen grundsätzlichen Politikwechsel vorzunehmen. Insbesondere folgt daraus keineswegs, dass eine Abwertung der Währung eintreten muss, um das Problem zu beseitigen.
Die Existenz eines "twin deficits", wie diese Situation bezeichnet wurde, also das gleichzeitige Vorliegen eines Defizits im Staatshaushalt und in der Leistungsbilanz, ist allerdings anders zu beurteilen als ein Leistungsbilanzdefizit bei mehr oder minder ausgeglichenem Staatshaushalt. Der Kapitalimport, der dem Leistungsbilanzdefizit gegenübersteht, dient bei einem (hohen) Defizit im Staatshaushalt ja auch dazu, dieses Defizit (mit) zu finanzieren. Das ist aber ganz anders zu beurteilen als ein Kapitalimport, der dazu dient, eine hohe Investitionstätigkeit im Inland mitzufinanzieren.
[Seite der Druckausg.: 88 ]
Hier liegt ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen den achtziger und den neunziger Jahren. Ende der neunziger Jahre weist der amerikanische Bundeshaushalt einen Überschuss auf, während er unter Reagan stark defizitär war. Während der Kapitalimport in den achtziger Jahren auch zur Finanzierung des Defizits im Staatshaushalt benötigt wurde, bedeutet er heute, dass es die hohen amerikanischen Investitionen sind, die teilweise zu ihrer Finanzierung auch auf das Sparen des Auslands zurückgreifen.
Aller angebotstheoretischen Rabulistik zum Trotz war die unter Reagan betriebene Wirtschaftspolitik der Sache nach eine keynesianische Nachfragepolitik reinsten Wassers. Das aus einer Fehleinschätzung über die Elastizität der Einkommensteuersatzsenkung entstandene erhebliche Defizit im Staatshaushalt wirkte in der theoretisch zu erwartenden Weise auf Produktion und Beschäftigung, nämlich stimulierend. Dass es gleichzeitig zu erheblichen Defiziten in der Leistungsbilanz kam, entsprach ebenfalls einem bekannten Muster. Die davon ausgelösten Folgen entsprachen diesem dann allerdings nicht. Während solche Defizite in der Leistungsbilanz z.B. Großbritannien in der Nachkriegszeit immer wieder gezwungen hatten, eine auf Expansion gerichtete Politik schnell wieder zu beenden und eine "Stop and go-Politik" zu betreiben sowie Frankreich Anfang der achtziger Jahre schnell wieder von einer national betriebenen Expansionspolitik abbrachten, spielten in den USA solche Restriktionen keine Rolle. Wenn man als nationale Währung eine internationale Leitwährung hat, gelten eben etwas andere Gesetzmäßigkeiten. Zu diesen gehört, dass auch länger andauernde Leistungsbilanzdefizite (und die diesen korrespondierenden Kapitalimporte) durchgehalten werden können und nicht auf Grund der außenwirtschaftlichen Beziehungen eine Korrektur erzwungen wird.
4.2.2 Makroökonomische Bedingungen In der Clinton Ära
4.2.2.1 Nachfrageexpansion bei rückläufigem Budgetdefizit
Während man jedenfalls für einen Teil der Regierungszeit von Reagan durchaus von einem "Keynesianismus wider Willen" sprechen kann, indem die Defizite im Staatshaushalt erheblich dazu beitrugen, eine produktions- und beschäftigungsfördernde Nachfragesituation aufrecht zu erhalten, ist es etwas komplizierter, die
[Seite der Druckausg.: 89 ]
makroökonomische Politik der Clinton Administration zu beurteilen. Dass die Entwicklung seit 1992 als sehr günstig einzuschätzen ist, kann kaum bestritten werden. Die folgenden Bilder belegen das, wenn man das Augenmerk auf die Entwicklung der Arbeitslosenquote und der Inflationsrate seit 1992/93 legt und mit vorangegangenen Bewegungen dieser Größen vergleicht. Dabei wird deutlich, dass der gleichzeitige Rückgang von Arbeitslosenquote und Inflationsrate über eine Reihe von Jahren eine durchaus rare Angelegenheit ist.
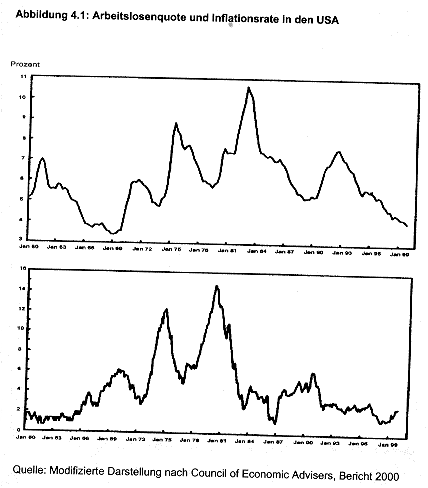
[Seite der Druckausg.: 90 ]
Ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem vorangegangenen Konjunkturzyklus wird deutlich, wenn man sich die beiden folgenden Bilder betrachtet. Bild 4.2 zeigt, dass die große Lücke zwischen Ausgaben und Einnahmen im Föderal Budget nach 1992 reduziert wurde und in den beiden letzten Jahren sogar ein Überschuss im Staatshaushalt vorlag. Und in Bild 4.3 sieht man, dass der (strukturelle) Budgetsaldo im Verhältnis zum potentiellen Bruttoinlandsprodukt in der jüngsten Expansionsphase einen anderen Verlauf nahm als in 1961-69 und 1982-90. Während in der erstgenannten Expansionsphase ein Anstieg der Defizite zu verzeichnen war, in der zweiten die Defizite zunächst stark stiegen, um dann wieder etwas zurückzugehen, sind sie in der letzten seit dem zweiten Jahr der Expansion laufend zurückgegangen. Das deutet jedenfalls nicht auf herkömmliche keynesianische Politik durch deficit spending hin.
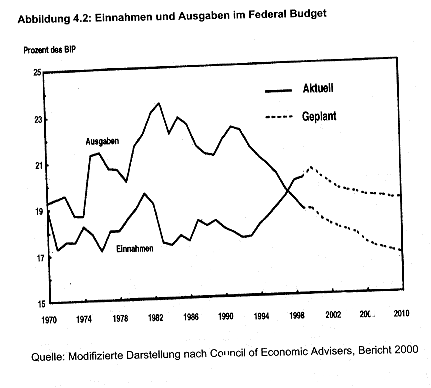
[Seite der Druckausg.: 91 ]
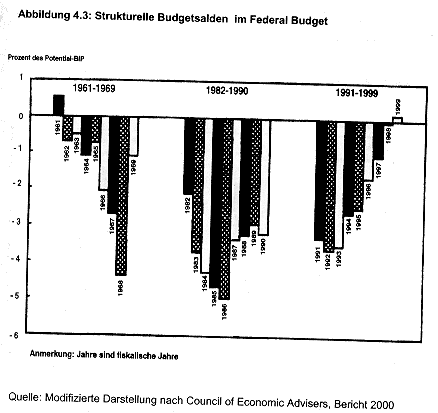
Da vom Zwillingsdefizit noch immer das andere Defizit, nämlich das in der Leistungsbilanz, übrig geblieben ist, fällt auch ein anderer möglicher Träger der amerikanischen Beschäftigungsexpansion aus: Das für die deutsche Wirtschaft inzwischen schon charakteristische exportgetragene Wachstum spielt für die US-Wirtschaft keine Rolle; der Beitrag des "Netto-Export" (sprich: Leistungsbilanzdefizit) zum Wachstum ist negativ. Wie das folgende Bild zeigt, war das auch in der vorangegangenen Expansion der Fall, wenn auch nicht im gleichen Umfang. Es wird auch ersichtlich, dass der Beitrag des Staates an Bedeutung verloren hat. Damit ist implizit schon gesagt, wo wir nach den Determinanten der Expansion zu suchen haben und das Bild bestätigt uns das: der private Konsum und die private Investition
[Seite der Druckausg.: 92 ]
sind die bedeutsamen Komponenten - entschieden bedeutsamer als in zurückliegenden Aufschwungphasen.
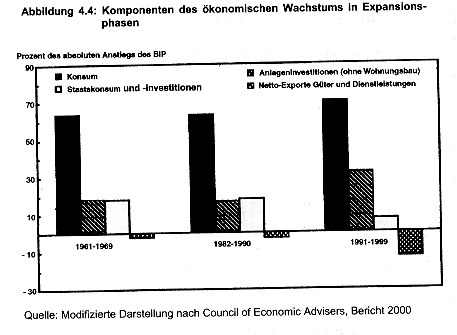
Angesichts dieser Konstellation muss man natürlich fragen, was die amerikanische Wirtschaftspolitik richtig (und umgekehrt die deutsche eventuell falsch) gemacht hat, um eine solche, von der privaten inländischen Nachfrage getragene Expansion zu erreichen. Oder ist diese Frage falsch gestellt, weil von Seiten der Wirtschaftspolitik eigentlich nichts getan wurde und die Ökonomie einfach auf Grund günstiger Umstände expandierte und sich geradezu als Job-Maschine erwies?
Die Bedeutung der Wirtschaftspolitik ist sicherlich schon deshalb nicht zu unterschätzen, weil sie stets mit ihrem Tun und Unterlassen auf die Ökonomie einwirkt und in bestimmten Phasen günstige Entwicklungen unterstützen oder auch abwürgen kann. Dies hatte vermutlich Solow im Auge als er in einem 1999 in München gehaltenen Vortrag sagte: "If the Bundesbank were sitting in Washington, the American prosperity would have been cut off by higher interest rates at least two years
[Seite der Druckausg.: 93 ]
ago, and more likely four years ago." [Fn. 77: Solow, K.M., Unemployment in the United States and In Europe, A Contrast and the Reasons, unveröffentlichtes Manuskript, März 1999] In der Tat kommt der amerikanischen Geldpolitik das Verdienst zu, nicht schon auf einen Restriktionskurs gegangen zu sein als die gemessene Arbeitslosenquote den Wert unterschritt, der vielfach für die NAIRU genannt worden war. [Fn. 78: Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die diesbezüglichen Aussagen im dritten Kapitel.] Vom Federal Reserve Board ist vielmehr sehr genau die Entwicklung des Preisniveaus beobachtet worden und es ist daraus der - wie sich zeigen sollte - richtige Schluss gezogen worden, dass ohne Gefahr für das Preisniveau auch eine niedrigere Arbeitslosenquote realisiert werden kann. Damit konnten Produktionspotentiale realisiert werden, die bei einer ängstlichen und einseitig am Geldwert orientierten Politik verschenkt worden wären.
Der Bundesbank hat es dagegen an einer solchen Souveränität gemangelt. Ihre einseitige Orientierung am Geldwert und natürlich auch die Austeritätsprogramme geradezu provozierenden Maastrichter Kriterien haben in Deutschland (und auch in anderen europäischen Ländern) dazu geführt, dass Produktions- und Beschäftigungspotentiale verschenkt wurden - und zwar wohlgemerkt auch solche, die ohne Gefahr für den Geldwert hätten realisiert werden können. Das ist auch von Solow so gesehen worden, der in dem bereits erwähnten Vortrag feststellte, "that American fiscal and monetary policy has been more successful than Europe has been in supporting aggregate demand, and above all more aggressive in taking advantage of opportunities to expand whenever inflationary pressure has been weak, whatever the cause of that weakness." [Fn. 79: a.a.O., S. 16]
Auf die Frage, weshalb sich die Inflationsgefahren als gering erwiesen, werden wir noch eingehen. Zunächst soll aber auf die beiden wesentlichen Komponenten der Nachfrage in der jüngsten amerikanischen Expansionsphase eingegangen werden, auf den privaten Konsum und auf die Investitionstätigkeit. Dabei interessiert natürlich vor allem, warum eine ähnliche Dynamik in Deutschland nicht festzustellen war.
[Seite der Druckausg.: 94 ]
4.2.2.2 Konsumgetragenes Wachstum
Abbildung 4.4 hat bereits darauf aufmerksam gemacht, dass der privaten Konsumnachfrage in der langen Expansionsphase der neunziger Jahre (die noch immer anhält) eine hervorgehobene Rolle zukommt. Gleichzeitig ist aber im vorangegangenen Kapitel deutlich geworden, dass sich seit den siebziger Jahren (zumindest bis Mitte der neunziger Jahre) nur eine recht moderate Lohnerhöhung ergeben hat; im Bereich der unteren Lohngruppen sind die Reallöhne sogar gesunken. [Fn. 80: Siehe Abbildung 3.1] Die starke Ausweitung der Konsumnachfrage ist somit sicherlich nicht durch Einkommenssteigerungen bei den Gruppen mit einer besonders hohen Konsumneigung zustande gekommen, wie das mitunter von Linkskeynesianern empfohlen wird.
Eine kräftige Expansion der Konsumausgaben bei mäßigen Lohnerhöhungen - wie soll das zugehen? Dahinter stecken im wesentlichen die folgenden Entwicklungen. Zunächst muss man festhalten, dass nicht nur die starke Erhöhung der Konsumausgaben die Beschäftigungsentwicklung günstig beeinflusst hat, sondern dass man es auch mit der umgekehrten Wirkungsrichtung zu tun hat: Eine steigende Beschäftigung schafft zusätzliche Konsumnachfrage. Es gilt gleichsam, dass es die Masse macht. Dazu kommt, dass sich in den Vereinigten Staaten Einkommen und Vermögen kräftig erhöht haben - zwar nicht bei den unteren Schichten, wohl aber bei denen, die in der Einkommenspyramide schon zuvor weiter oben angesiedelt waren. Deren Konsumneigung hat sich keineswegs als gering erwiesen, vielmehr ist es im Zuge der Expansion zu einer kräftigen Ausdehnung im Konsum von Luxusgütern gekommen (die Hersteller besonders exklusiver und teurer Autos in Deutschland haben davon profitiert). Und schließlich ist da noch das bemerkenswerte und viel diskutierte Absinken der Sparquote privater Haushalte (Anteil des Sparens privater Haushalte am verfügbaren Einkommen), die 1999 sogar zeitweilig negative Werte aufwies.
Das "personal saving" ist natürlich nicht identisch mit dem gesamten inländischen Sparen, denn daneben gibt es noch "corporate saving", also die nichtausgeschütteten Gewinne der Kapitalgesellschaften, und "government saving", das zuletzt ja positiv war. Dennoch ist dieser Rückgang bemerkenswert und hat die Ökonomen veranlasst,
[Seite der Druckausg.: 95 ]
über die Ursachen nachzudenken. Dabei spielt natürlich wiederum die Überlegung eine Rolle, ob wir es hier mit einer spezifisch amerikanischen Erscheinung zu tun haben, oder ob ähnliche Entwicklungen - möglicherweise mit Zeitverzögerung - auch in Europa sich abspielen werden.
Bei dem Versuch, den Rückgang der privaten Sparquote zu erklären, ist insbesondere auf den boomenden Aktienmarkt verwiesen worden. Das Argument lautet, dass angesichts schon eingetretener oder weiter erwarteter Kurssteigerungen sich die Konsumausgaben daran orientieren und insofern im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen ansteigen. Folge: Ein Rückgang der (im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen) privaten Sparquote. Insbesondere die Erwartung weiter steigender Kurse kann dazu führen, dass - gewissermaßen im Vorgriff darauf - Konsumausgaben getätigt werden. Die Allgegenwart der Kreditkarte in den Vereinigten Staaten hat darüber hinaus die Möglichkeit, Konsumausgaben unter Inanspruchnahme von (allerdings teuren) Krediten zu tätigen, erheblich verbreitert. Eatwell und Taylor verweisen darauf, dass sich die Schulden der amerikanischen Privathaushalte auf fast sechs Billiarden Dollar belaufen, davon allerdings 70 Prozent in der Form von Hypotheken, aber immerhin 25 Prozent in der Form von Konsumentenkrediten. Das bedeutete, dass Ende 1997 das Verhältnis der Schulden privater Haushalte zum verfügbaren Einkommen 0,98 betrug. 1993 lag das Verhältnis noch bei 0,89. [Fn. 81: Eatwell, J. and Taylor, L., The American Stock-Flow Trap, Challege Vol. 42, No. 5 (1999), S. 34-49 ]
So günstig sich die amerikanische Verschuldungsbereitschaft auf die Konsumgüternachfrage auswirkte, so problematisch kann sich natürlich der hohe Stand der Konsumentenkredite erweisen, wenn die Erwartung weiterer Kurssteigerungen kippt oder wenn sich der Federal Reserve Board zu einer deutlichen Anhebung der Zinsen gezwungen sieht. Neben der hier lauernden Gefahr ist aber auch mit der hohen Auslandsverschuldung ein latentes Instabilitätspotential vorhanden. Käme es in größerem Umfang zu Kapitalabzügen, hätte das eine Erhöhung des Zinsniveaus zur Folge und das wiederum würde Konsum und Investition treffen. Eatwell und Taylor sprechen deshalb von einer "American Stock-Flow Trap". [Fn. 82: a.a.O.]
[Seite der Druckausg.: 96 ]
4.2.2.3 Private Investitionstätigkeit als Wachstumsmotor
Dass eine expansive Nachfrage nach Konsumgütern sich auch auf die Investitionsgüternachfrage günstig auswirkt, wird niemanden besonders überraschen; den Ökonomiestudenten ist ein solcher Zusammenhang als Akzeleratorprinzip bekannt. Aber daneben waren im Fall der US-amerikanischen Wirtschaft in den neunziger Jahren weitere günstige Umstände im Spiel. Die Gewinnentwicklung war generell günstig und dies förderte zum einen die Investitionsneigung und verstärkte zum anderen die Investitionsmöglichkeit, da die Firmen zur Finanzierung der Investitionen auf stabile und ansteigende unausgeschüttete Gewinne zurückgreifen konnten. Aber auch die Möglichkeiten, Kredite zu erhalten, waren für Investoren vorteilhaft. Dazu trug vor allem die Reduktion des Budgetdefizits bei, der die Konkurrenz des privaten und des öffentlichen Sektors um Kredite reduzierte. Und schließlich waren die Zinsen zwar nicht extrem niedrig, aber sie waren stabil und hatten insofern einen günstigen Einfluss auf die Investitionstätigkeit.
Und es gab, nicht zu vergessen, neben dem Wunsch, über die entsprechenden Kapazitäten zur Befriedigung der starken Nachfrage zu verfügen, einen ganz entscheidenden Investitionsgrund: die rasante Entwicklung im Bereich der Informationstechnologien. 1987 - das erste Jahr, für das offizielle Zahlen über nominale und reale Größen vorliegen - hatten die nominalen Investitionen für Computer, Computer-Peripherieeinrichtungen und Software erst 14,3 Prozent der gesamten privaten Investitionen ohne Wohnungsbau betragen. 1999 lag dieser Anteil bei 20,7 Prozent. Noch weit eindrucksvoller fällt die Entwicklung der deflationierten Größen aus. Das Verhältnis der "realen" Investitionsausgaben für Computer, Peripherie und Software betrug 1987 6,7 Prozent der gesamten privaten Bruttoinvestitionen ohne Wohnungsbau. Die Schätzungen für 1999 besagen, dass dieser Anteil 1999 30,7 Prozent betragen hat. [Fn.83: Zu den Zahlen siehe die Tabellen B 16 und B 17 im Report des Council of Economic Advisers vom Februar 2000.] Die ungleich stärkere Ausdehnung bei der Verwendung deflationierter Größen beruht natürlich auf den starken Preisrückgängen, zu denen es im Bereich der Informationstechnologien gekommen
[Seite der Druckausg.: 97 ]
ist, wenn man gleichzeitig (wie es bei dieser Rechnung versucht wird) die eingetretenen Qualitätssteigerungen berücksichtigt. [Fn. 84: Da man über die Methode, mit der die rapide steigende Leistungsfähigkeit der Computer berücksichtigt wird, natürlich streiten kann, müssen sogenannte "reale" Größen mit Vorsicht betrachtet werden. Daran, dass es im Bereich der Informationstechnologien zu weit stärkeren Preissenkungen als anderswo gekommen ist, kann es allerdings keinen Zweifel geben. Insofern ist klar, dass der "reale„ Anteil der Investitionen in Computer stärker gestiegen ist als der nominale. Die Frage kann nur sein, um wie viel stärker.]
Die (insbesondere in realer Betrachtung) stark gestiegene Bedeutung der Investitionen in Informationstechnologie sollte aber nicht zu falschen Schlussfolgerungen führen. Schaut man nämlich nicht auf die Investitionen sondern auf den Kapitalstock, so stellt man fest, dass dabei die Computer und ihre Peripherie lange nicht die Bedeutung haben, die ihnen angesichts der zuletzt genannten Daten zuzukommen scheint. Vom gesamten Anlagevermögen ohne Wohnungsbauten entfallen nach Aussage des CounciI of Economic Advisers in den USA bisher weniger als zwei Prozent auf Computer und Computerperipherie. [Fn. 85: Report des CounciI of Economic Advisers vom Februar 1999, S. 75] Dieser immer noch sehr geringe Anteil der Computer am gesamten Anlagevermögen wird sich natürlich mit deren steigender Bedeutung bei den Investitionen erhöhen. Der bisher immer noch geringe Anteil am Kapitalstock könnte aber eine der Antworten auf die von Solow aufgeworfene Frage sein, weshalb man überall auf Computer stößt, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass sich die Investitionstätigkeit in den USA seit Beginn der neunziger Jahre sehr günstig entwickelt hat. Schaut man auf die Nettoinlandsinvestition, muss man allerdings konstatieren, dass deren Anteil am Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu früheren Phasen nicht besonders eindrucksvoll ist (siehe Abbildung 4.5).
[Seite der Druckausg.: 98 ]
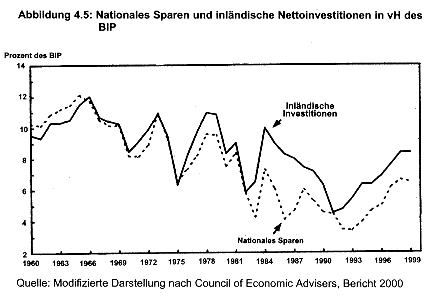
Bei der Interpretation des Bildes, das sich auf Nettogrößen bezieht, sollte man allerdings zwei Punkte berücksichtigen. Zum einen war der (in der Abbildung nicht dargestellte) Anteil der Bruttoinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt (jeweils nominal) 1999 höher als 1960. Zum anderen haben sich wichtige, bzw. wichtiger gewordene Investitionsgüter relativ verbilligt, was bedeutet, dass in realer Betrachtung das Verhältnis von Bruttoinvestition zu Bruttoinlandsprodukt sich günstiger als in nominaler Betrachtung entwickelt hat. Die Zahlen für die US-Ökonomie bestätigen das. Setzt man die jeweils nominal ermittelten Werte für Bruttoinvestition und Bruttoinlandsprodukt zueinander ins Verhältnis, so erhält man für 1960 15,5 Prozent und für 1999 17,5 Prozent. In Preisen von 1996 erhält man dagegen für 1960 11,9 Prozent und für 1999 18,5 Prozent, also eine deutlich stärkere Zunahme der Bruttoinvestitionsquote.
In realer Betrachtung und abgestellt auf die für die Entwicklung der effektiven Nachfrage entscheidenden Bruttoinvestitionen wird man also feststellen können, dass die sehr günstige Beschäftigungsentwicklung in den USA vom privaten Konsum und von der privaten Investitionstätigkeit getragen wurde.
[Seite der Druckausg.: 99 ]
4.3 Deutschland dagegen
Auf das deutsche makroökonomische Kontrastprogramm in den neunziger Jahren soll nur sehr kurz eingegangen werden. Die Entwicklung, die sich in Deutschland vollzogen hat, ist selbstverständlich sehr stark geprägt durch die deutsche Vereinigung und durch die ihr vorangegangene Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Auch wenn man sich, wie das hier geschah, fast ausschließlich auf Westdeutschland bezieht, ist klar, dass sich dort ohne die deutsche Vereinigung eine ganz andere ökonomische Entwicklung ergeben hätte - ob zum Besseren oder Schlechteren, sei hier dahingestellt.
Wir werden auch in diesem Abschnitt die besonderen ökonomischen Probleme der deutschen Vereinigung weitgehend ausblenden [Fn. 86: Ein weiteres Charakteristikum der neunziger Jahre bestand in den Maastrichter Kriterien und einer daran ausgerichteten Politik in den beitrittswilligen Ländern. Auch diesen wichtigen Aspekt blenden wir weitgehend aus.] und damit auch von einer Analyse der Frage absehen, in welchem Umfang sie zum Anstieg der Arbeitslosigkeit beigetragen haben. Ein paar kurze Bemerkungen dazu müssen jedoch gemacht werden.
Die politischer Opportunität folgenden Bedingungen der Währungsumstellung (1:1 bei den Stromgrößen, wie von der ostdeutschen Bevölkerung gefordert), die den Produktivitätsanstieg weit übersteigenden Lohnsteigerungen nach der Einführung der Währungsunion, der Wegfall osteuropäischer Märkte, Qualitätsprobleme und anderes führten in der ehemaligen DDR zunächst zu einem historisch beispielslosen Rückgang von Produktion und Beschäftigung, vor allem im Produzierenden Gewerbe. Durch Kurzarbeit, Frühverrentung, ABM und anderes wurde zwar versucht, den Anstieg bei den registrierten Arbeitslosen in Grenzen zu halten, aber der Rückgang der Erwerbstätigenzahlen ließ das wahre Ausmaß der Arbeitslosigkeit erahnen, das sich nach der Vereinigung in den Neuen Bundesländern ausbreitete. Mit der Rückführung der statistikschönenden Maßnahmen wurde das Ausmaß der Arbeitslosigkeit dann auch in den offiziellen Zahlen der Arbeitslosenstatistik sichtbar. Bis heute gilt, dass die Arbeitslosenquote in den neuen Bundesländern wesentlich höher als in den alten ist.
[Seite der Druckausg.: 100 ]
Die alten Bundesländer erlebten zunächst einen 'Vereinigungsboom", der bewirkte, dass die rezessiven Erscheinungen in den europäischen Ländern und auch in den USA sich 1990/91 in Deutschland zunächst nicht bemerkbar machten. Mit zeitlicher Verzögerung haben sie sich dann aber doch und besonders stark auch in Deutschland durchgesetzt. Die deutsche Vereinigung hat dabei insofern eine Rolle gespielt, als immer deutlicher wurde, dass die letztlich von Westdeutschland zu tragenden Kosten für den "Aufbau Ost", aber auch für die im Einigungsvertrag übernommenen Verpflichtungen weit höher waren als das den damals politisch Verantwortlichen zunächst bewusst war. Um die hohen Transfers zu finanzieren, die dafür erforderlich waren, musste eine gewaltige Erhöhung der öffentlichen Schuld vorgenommen werden [Fn.87: Dies veranlasste die Bundesbank zwischen 1990 und 1992 mehrmals die Geldmarktzinsen zu erhöhen, die danach nur zögerlich - und für eine günstigere Entwicklung der privaten Nachfragkomponenten wohl zu zögerlich - gesenkt wurden.] und gleichzeitig wurden Steuern und Sozialbeiträge erhöht. Der Bundeshaushalt wurden zusätzlich durch die Steuerausfälle belastet, die sich aus großzügigen Investitionszulagen und Abschreibungserleichterungen für Kapitalanleger in den neuen Bundesländern ergaben. Wie man heute sagen muss, hat das in großem Umfang eine Fehlallokation von Kapital bewirkt, wobei sich in den neuen Bundesländern teilweise eine Überkapitalisierung ergab, während in den alten notwendige Modernisierungsinvestitionen unterblieben.
Die Unterschiede zwischen West und Ost erschöpfen sich damit aber keineswegs und eben darum kann man eben doch nicht ganz von der deutschen Vereinigung absehen, denn in mancherlei Hinsicht hat man es, jedenfalls in ökonomischer Betrachtung, immer noch mit zwei Deutschlands zu tun. Unterschiede zeigen sich z.B. im Wachstumsmuster. Eigentlich war erwartet worden, dass die neuen Bundesländer für viele Jahre eine höhere Wachstumsrate aufweisen würden und dass sich auf diese Weise eine Konvergenz ergeben würde - gewiss nicht so schnell, wie das von gewissen Politikern in sicherer Distanz von ökonomischer Theorie, Wirtschaftsgeschichte oder einfach historischer Erfahrung behauptet wurde, aber doch immerhin.
Die statistischen Daten zeigen demgegenüber, dass nur von 1992-96 in den neuen Bundesländern eine höhere Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts realisiert werden konnte, danach war die in den alten Bundesländern etwas höher und
[Seite der Druckausg.: 101 ]
das wird auch für das laufende Jahr erwartet. Ganz offensichtlich war der Konvergenzprozess (jedenfalls fürs erste) viel schneller zu Ende als allgemein angenommen.
Der wirklich bedeutsame Unterschied zeigt sich aber in bezug auf die Leistungsbilanz. Die offizielle Statistik liefert schon seit einigen Jahren keine nach West und Ost getrennten Daten mehr. Dennoch deutet alles darauf hin, dass hinter dem seit 1993 wieder positiven Außenbeitrag zwei vollkommen unterschiedliche Sachverhalte stehen: Ein deutlicher Überschuss der alten Bundesländer, ein ebenso deutliches Defizit bei den neuen Bundesländern. Einer Schätzung von Sinn zufolge betrug 1998 - also in einem Jahr, in dem sich in Deutschland der Außenbeitrag auf +1,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts belief - in den neuen Bundesländern das Defizit 50 Prozent [Fn. 88: Sinn, H.W., Germany's Economic Unification. An Assessment After Ten Years, NBER Working Paper 7586, March 2000, http://www.nber.org/papers/w7586] . Ohne die Vertrauenswürdigkeit dieser Zahl zu diskutieren, können wir jedenfalls festhalten, dass in dieser Hinsicht in Ost und West gänzlich unterschiedliche Bedingungen existieren. Diese spiegeln sich natürlich auch im Vorzeichen der Transfers wider: Die alten Bundesländer leisten, die neuen empfangen.
Die diametral unterschiedlichen Verhältnisse, die in dieser Hinsicht in Deutschland noch immer herrschen, machen es unmöglich, für Gesamtdeutschland gültige Aussagen zu machen. Immerhin kann man aber sagen, dass sich inzwischen für Gesamtdeutschland das wieder eingestellt hat, was vor der deutschen Vereinigung für die damalige Bundesrepublik noch in weit stärkerem Maße galt: Ein positiver Außenbeitrag gehört geradezu notorisch zum Erscheinungsbild der ökonomischen Entwicklung in Deutschland.
Für Westdeutschland war das vor und nach der deutschen Vereinigung der Normalfall. Wenn wir uns allein auf Westdeutschland beziehen, können wir sagen, dass hier ein ganz wesentlicher Unterschied gegenüber der amerikanischen Wirtschaft liegt. Zum einen war der Export (und die Erzielung eines Exportüberschusses) für die deutsche Wirtschaft in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg immer ungleich wichtiger als für die US-amerikanische Ökonomie, die sich angesichts ihres riesigen Binnenmarktes ganz anderen Verhältnissen gegenüber sah. Demgegenüber musste man in bezug auf die Bundesrepublik zeitweise den Eindruck gewinnen, dass hier beschäftigungspolitisch eine "beggar-my-neighbour-Politik" im großen Stil betrieben wurde, da sich die
[Seite der Druckausg.: 102 ]
angestrebten und realisierten Leistungsbilanzüberschüsse ja an andere Stelle als Defizite niederschlagen mussten.
Wenn wir die Verhältnisse in den USA und in der Bundesrepublik (repräsentiert durch Westdeutschland) für die neunziger Jahre vergleichen, können wir also feststellen, dass die maßgeblichen Komponenten der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage unterschiedliche waren: In den USA die private Konsum- und Investitionsgüternachfrage, in (West-)deutschland die staatliche Nachfrage und die Auslandsnachfrage. Es gibt keine wirklich überzeugenden Argumente dafür, dass unter Beschäftigungsaspekten ersteres erfolgversprechender als letzteres ist. Im vergangenen Jahrzehnt und in bezug auf die beiden von uns betrachteten Länder war das allerdings der Fall.
4.4 Mengen- statt Preiseffekte
Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft dazu zwingt, einige populäre Vorurteile zu überprüfen. Zu diesen Vorurteilen gehört die schon am Anfang dieser Untersuchung erwähnte Behauptung, dass der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgehe. Nicht nur was die gegenwärtige Expansionsphase anbelangt, sondern auch wenn wir die längerfristige Entwicklung betrachten, stellen wir aber für die USA eine kräftige Erhöhung der Erwerbstätigenzahlen und des Arbeitsvolumens fest. Widerlegt wird auch die (für Entwicklungsländer ja in der Regel auch zutreffende) Vermutung, dass starkes Bevölkerungswachstum ein sinkendes oder doch nur wenig steigendes Pro-Kopf-Einkommen zur Folge hat.
Speziell durch die immer noch anhaltende Expansionsphase sind weitere Vermutungen überprüfungsbedürftig geworden. Dazu gehört z.B. die Auffassung, dass eine auf Konsolidierung des Staatshaushalts gerichtete Politik die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stark dämpfen und einen Aufschwung damit zum Erliegen bringen muss. Die Erfahrung der letzten Jahre bestätigt das nicht. Offensichtlich ist es
[Seite der Druckausg.: 103 ]
unter den günstigen Bedingungen [Fn. 89: Zu den günstigen Bedingungen gehörte natürlich auch, dass als "Friedensdividende" die Rüstungsausgaben in ihrem Wachstum begrenzt werden konnten. ] , wie sie in den USA vorlagen, möglich, Konsolidierung des Staatshaushalts und ein günstiges Nachfrageklima miteinander zu verbinden. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die private Nachfrage sich entsprechend entwickelt und gerade das ist in den USA geschehen. Diese Lektion sollte in Deutschland all denjenigen, die für die Finanzpolitik Verantwortung tragen, mit allen Mitteln, die die Didaktik zur Verfügung stellt, verabreicht werden.
Die vielleicht wichtigste Lehre, die die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre in den USA vermittelt, scheint uns aber zu sein, dass es nicht gerechtfertigt ist, die Unterschreitung einer bestimmten Arbeitslosenquote wirtschaftspolitisch zu verhindern, weil davon ein Auftrieb des Preisniveaus erwartet wird. In den USA hat sich gezeigt, dass sinkende Arbeitslosenquoten - und zwar sinkend bis auf ein historisch sehr niedriges Niveau - ohne Preisauftrieb, ja sogar mit sinkenden Inflationsraten einher gehen können.
Die Frage, die wir noch einmal aufzugreifen haben, ist, ob wir es hier mit einer amerikanischen Besonderheit zu tun haben. Eine expandierende gesamtwirtschaftliche Nachfrage ist eine notwendige Bedingung für eine kräftige Ausdehnung von Produktion und Beschäftigung. Sie ist jedoch keine hinreichende Bedingung. Es ist immer möglich, dass eine kräftig steigende gesamtwirtschaftliche Nachfrage eher Preis- als Mengeneffekte bewirkt. Die Sorge, dass das der Fall sein könnte, steht ja gerade hinter den Versuchen (und legitimiert dieselben), eine weitere Verbesserung der Beschäftigungssituation zu verhindern.
In den USA hat man [Fn. 90: "Man„ meint hier in erster Linie, dass die für die Geldpolitik Verantwortlichen mehr Pragmatismus aufbrachten und damit größere Erfolge erzielten als das bei einer Orientierung an den vorherrschenden theoretischen Moden der Fall gewesen wäre.] die weitere Verbesserung der Beschäftigungssituation auch noch zugelassen, als die Arbeitslosenquote unterschritten wurde, die man allgemein gerade noch für inflationsstabil ansah. Damit ist man bis jetzt gut gefahren. Es ist gelungen, die Arbeitslosenquote erheblich unter die Größen zu drücken, die als
[Seite der Druckausg.: 104 ]
NAIRU oder NAWRU immer wieder genannt wurden, ohne dass der davon befürchtete Inflationsauftrieb eingetreten wäre. [Fn. 91: 1999 ist die Inflationsrate zwar höher als 1998 ausgefallen, das ist aber im wesentlichen durch die deutlichen Erhöhungen beim Ölpreis bedingt. Für den immer wieder diskutierten "trade-off" zwischen Arbeitslosenquote und Inflationsrate spielen aber natürlich auch die Rohstoffpreise eine Rolle: Produktions- und Beschäftigungssteigerungen in wichtigen Industrieländern erhöhen die Nachfrage nach Rohstoffen und vergrößern die Chancen, bei diesen Preiserhöhungen durchzusetzen. Gelingt die Durchsetzung höherer Preise, so bestätigt das die Befürchtung von der Existenz eines "trade-off".]
Zu fragen ist also, was dahinter steht, ob es sich um ein typisch amerikanisches Phänomen handelt oder ob bei etwas größerem Mut der politisch Verantwortlichen, bzw. weniger einseitigen Maastricht-Kriterien, auch europäische Länder eine vergleichbare Entwicklung hätten nehmen können.
Bei dem Versuch zu beurteilen, ob die in den zurückliegenden Jahren besonders geglückte Erzeugung von Mengen- (bei gleichzeitig weitgehend vermiedenen Preis-) Effekten mit den in den USA herrschenden Bedingungen zu tun hat, liegt es natürlich nahe, die in Kapitel 3 aufgeführten Punkte erneut aufzugreifen. Ihnen könnte es ja geschuldet sein, dass es der amerikanischen Ökonomie gelang, die aus einer stark ansteigenden gesamtwirtschaftlichen Nachfrage immer drohenden Preissteigerungstendenzen im Zaum zu halten und statt dessen im wesentlichen Mengeneffekte zu produzieren. Die sich scheinbar unversöhnlich gegenüberstehenden angebots- und nachfragetheoretischen Erklärungen der Arbeitslosigkeit könnten damit gleichzeitig zusammengeführt und als einander ergänzend begriffen werden: Die immer wieder beschworene Flexibilität des amerikanischen Arbeitsmarkts würde dann zwar nicht direkt die Beschäftigungsexpansion erklären, wohl aber, weshalb in den USA eine Nachfrageausweitung günstigere Bedingungen dafür vorfindet, dass sich das in Mengen- (also Produktions- und Beschäftigungs-) Effekten und nicht so sehr in Preiseffekten niederschlägt.
Eine solche Sicht, die in einer kräftigen Nachfrageausweitung eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für eine Beschäftigungsausweitung sieht und die verschiedenen Aspekte der Flexibilität, die wir Revue passieren ließen, dann in ihrer Bedeutung für die Dominanz von Mengen- oder Preiseffekten hinterfragt, ist jedenfalls differenzierter als der gängige direkte Schluss von der größeren Arbeitsmarktflexibilität auf die bessere Beschäftigungssituation, wie wir ihn z.B. bei Siebert finden:
[Seite der Druckausg.: 105 ]
„[I]nstitutional differences between Europe and the United States can explain their different employment pictures". [Fn. 92: Siebert. H., Labor Market Rigidities: At the Root of Unemployment In Europe, Journal of Economic Perspectives, Vol. 11 (1997), S. 39]
Aber auch wenn die Flexibilität des Arbeitsmarkts darüber mitentscheidet, ob sich aus einer steigenden Nachfrage eher Mengen- oder Preiseffekte ergeben, ist noch nicht gesagt, dass das allein darüber entscheidet. Solow referiert in einem Aufsatz Case Studies, die von McKinsey durchgeführt wurden, und in denen sechs Branchen in Deutschland und Frankreich jeweils mit dem Land verglichen wurden, das für die jeweilige Branche das höchste Produktivitätsniveau aufwies [Fn. 93: Das waren in vier Fällen die USA, in einem Fall Japan und in einem weiteren die Niederlande.] . Das Ergebnis fasst Solows folgendermaßen zusammen: "There are a few contexts in which labour-market factors are a significant influence on the number and kind of jobs created. But the bottom line is clearly that these case studies strongly confirm the inadequancy (to put it mildly) of the standard Iitany that places the blame for low employment in Europe squarely on the inflexibilities of the labour market. It tums out that practiced observers of the industrial scene, when they come down to careful, structured evaluation, do not classify labour-market rigidities as an important causal factor in the failure of (at least) these six industries to create more Jobs". [Fn. 94: Solow, R.M., What is Labour-Market Flexibility? What is it Good for?, Proceedings of the British Academy, 97 (1998), S. 189-211. Das Zitat (Hervorhebung von uns) ist der Internet-Version entnommen. Siehe http://britac3.britac.ac.uk/pubs/keynes97/text3.html]
Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis, schon deshalb, weil es ja nicht damit abgetan werden kann, dass es von einem der Nachfragetheorie nahestehenden Ökonomen erzielt wurde. Was Solow wiedergibt, sind vielmehr die Ergebnisse von professionellen Unternehmensberatern, von denen man eigentlich eher erwarten würde, dass sie in den Chor derjenigen einstimmen, die die Rigidität der europäischen Arbeitsmärkte beklagen. Es verdient also festgehalten zu werden, dass das, was für Siebert eine feststehende Tatsache ist, durch diese Ergebnisse entschieden bestritten wird.
Wo aber liegen die Probleme, wenn der Lieblingskandidat, nämlich die Rigidität der Arbeitsmärkte, sich als nicht so überzeugend erweist? Wir lassen dazu noch einmal Solow zu Wort kommen: The implied weakness in Job creation is most likely the result of excessive and anti-competitive product-market regulation, restrictive
[Seite der Druckausg.: 106 ]
macroeconomic policy, especially monetary policy, and inadequate discipline from the capital markets. This is quite different from the conventional picture." [Fn. 95: a.a.O.]
Darauf, dass es wohl möglich gewesen wäre, seitens der Deutschen Bundesbank eine beschäftigungsfreundlichere Geldpolitik in Deutschland [Fn. 96: Bei der Dominanz der Deutschen Bundesbank vor der Gründung der Europäischen Zentralbank hat ihre Geldpolitik in erheblichem Umfang auch die der anderen europäischen Länder bestimmt.] zu betreiben, ist auch von uns bereits hingewiesen worden. Anders als vom Federal Reserve Board sind die inflationären Gefahren offensichtlich überschätzt worden und statt einer das Ziel der Geldwertstabilität und das Vollbeschäftigungsziel gleichermaßen beachtenden Politik ist statt Stabilitätspolitik im wesentlichen Stabilisierungspolitik, nämlich eine einseitig auf die Stabilisierung des inneren Geldwerts ausgerichtete Politik betrieben worden. Diese, den vorherrschenden Verhältnissen nicht entsprechende Ausrichtung hat eine günstigere Entwicklung der Beschäftigung verhindert.
Richtig ist aber sicher auch, dass in Deutschland (und darüber hinaus in anderen europäischen Ländern, aber das ist hier nicht unser Thema) Rigiditäten an den Produktmärkten vorliegen, die sich als hinderlich erweisen können, wenn es darum geht, tatsächliche oder potentielle Nachfrage in zusätzliche Produktion und Beschäftigung umzusetzen. Das in diesem Zusammenhang immer wieder genannte Ladenschlussgesetz ist unter dem Gesichtspunkt der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze sicher ein weniger bedeutsames Hindernis als oft vermutet, da seine Beseitigung kaum in nennenswertem Umfang zu zusätzlicher Nachfrage führen würde, sondern wohl in erster Linie zu einer Nachfrageverschiebung. Aber ohne Zweifel gab und gibt es Produktmarktregulierungen, die es erschweren oder sogar verhindern, dass schnell auf neue Bedürfnisse reagiert werden kann und dass daraus zusätzliche Produktion und Beschäftigung entsteht. Der Bereich der Telekommunikation liefert hier wohl das anschaulichste Beispiel. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass unter Beibehaltung der alten Strukturen, unter denen der Post eine Monopolstellung zugestanden wurde, sich eine ähnlich dynamische Marktentwicklung hätte vollziehen können.
Es ließen sich zusätzlich zahlreiche Beispiele dafür anführen, dass durch wettbewerbsbeschränkende Regulierungen mögliche positive Beschäftigungseffekte
[Seite der Druckausg.: 107 ]
behindert werden. Die für das Handwerk geltende Ordnung liefert ein Beispiel, von den an das mittelalterliche Zunftwesen gemahnenden Regelungen für besondere Bereiche (Kaminkehrer!) ganz zu schweigen.
Eine umfassende Durchforstung der für Produktmärkte (und das schließt natürlich auch Dienstleistungsmärkte ein) vorliegenden Regulierungen wird sicher zu dem Ergebnis führen, dass hierbei nicht nur der Allgemeinheit dienende Wettbewerbsbegrenzungen vorgenommen wurden, sondern auch solche, die recht offensichtlich ganz partikulare Interessen schützen. In der Sprache der Ökonomie heißt das, dass in solchen Fällen eine ökonomische Rente bezogen wird, d.h. ein auf einer Vorzugsstellung beruhendes und insofern unberechtigtes Einkommen. Man würde nun aber allerdings zu weit gehen, wenn man jede Regulierung als die Zuweisung einer ökonomischen Rente auffassen würde. Regulierungen werden oft in der Absicht vorgenommen, die Allgemeinheit zu schützen. Ob sie das erreichen oder aber vielleicht doch nur dazu führen, dass bestimmte Gesellschaftsmitglieder eine ökonomische Rente einstreichen können, muss natürlich jeweils gefragt und überprüft werden. Dennoch würde man das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man - einem bestimmten neoliberalen Rigorismus folgend - sich daran machen würde, alle Regulierungen zu beseitigen. Man tut gut daran sich zu erinnern, dass mit Regulierungen oft auf deutlich gewordene Defizite eines unregulierten Marktgeschehens reagiert wurde.
Um Produktions- und Beschäftigungseffekte zu fördern und umgekehrt zu verhindern, dass zusätzliche Nachfrage im wesentlichen zu steigenden Preisen führt, ist es also durchaus sinnvoll, die Waren- und Dienstleistungsmärkte auf nicht mehr zeitgemäße Regulierungen zu überprüfen und - so erforderlich - diese zu beseitigen. Dabei sollte man allerdings unterscheiden zwischen Regulierungen, die überwiegend der Allgemeinheit dienen und solchen, mit denen im wesentlichen Partikularinteressen bedient werden. Um ein beschäftigungsfreundlicheres Klima zu schaffen, sind es letztere, die beseitigt werden sollten.
Mit den zuletzt gemachten Bemerkungen wollten wir vor allem eine Sicht der Dinge gerade rücken, die wir als schief empfinden. Sie besteht darin, die Waren- und Dienstleistungsmärkte als annähernd ideal funktionierende darzustellen und dem
[Seite der Druckausg.: 108 ]
einen Arbeitsmarkt gegenüberzustellen, der von Regulierungen und Rigiditäten geradezu überzogen ist. Das entspricht sicher nicht der Realität. Wir haben es hier wie dort mit Regulierungen zu tun und hier wie dort mit solchen, die man letztendlich als einigermaßen vernünftig, bzw. überwiegend der Allgemeinheit dienend bezeichnen kann und solchen, für die das entschieden nicht der Fall ist. Unserem eingangs schon eingestandenen Prinzip folgend, das stärker zu betonen, was sonst eher vernachlässigt wird, haben wir die Rigiditäten, die man am Produktmarkt in Deutschland vorfindet, stärker als die Arbeitsmarktrigiditäten betont. Dass Unternehmensberater, die ganz andere Methoden verwenden, zu einem ähnlichen Urteil gelangen, ist sicher noch kein Beweis dafür, dass von uns die richtige Gewichtung vorgenommen wird. Eine Unterstützung unserer Sicht ist das aber schon.
4.5 Exkurs: Die "New Economy"
Der gleichzeitige Rückgang von Arbeitslosenquote und Inflationsrate in den USA, der Anstieg der Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität in den letzten Jahren, sowie das zeitliche Zusammentreffen dieser Vorgänge mit der rasanten Entwicklung im Bereich der Informationstechnologien (und hier wieder insbesondere der geradezu atemberaubende Siegeszug des Internet) haben eine breite Diskussion darüber ausgelöst, ob man sich in den Vereinigten Staaten am Beginn einer neuen Phase der ökonomischen Entwicklung befindet - in einer "new economy". [Fn. 97: Gesprochen wird auch von E-economy, von einer Goldilocks Economy (in Anspielung auf ein angelsächsisches Märchen) oder von „the next economy". Etwas näher als das hier möglich ist, beschäftigen wir uns mit der "New Economy" in Kalmbach, P., Eine neue Wirtschaft im neuen Jahrtausend?, Wirtschaftsdienst, im Erscheinen.] Von den Protagonisten dieser "neuen Wirtschaft" wird die These vertreten, dass es sich bei den genannten Entwicklungen nicht nur um eine vorübergehende günstige Konstellation handelt. Gestützt vor allem auf die neuen Informationstechnologien wird es der Wirtschaft nach ihrer Überzeugung für längere Zeit möglich sein, hohe Produktivitätssteigerungsraten aufrecht zu erhalten und damit einen höheren Beschäftigungsgrad mit einer niedrigeren Inflationsrate als in der Vergangenheit zu verbinden. Euphorisch wird sogar schon vom "Coming Age of Prosperity" gesprochen.
[Seite der Druckausg.: 109 ]
Wenn sich diese Sicht auch nur annähernd als realistisch erweisen sollte, könnte man erwarten, dass schließlich auch Europa von dieser neuen und überaus günstigen Konstellation erfasst wird. Man müsste demnach nur noch etwas Geduld aufbringen, bis sich eben auch das von den Vereinigten Staaten nach Europa verlagert.
Mit dieser sehr optimistischen Sicht der Dinge, für die man in Zeitschriften, Zeitungen und natürlich vor allem im Internet immer mehr Belege findet, ergibt sich ein bemerkenswerter Kontrast zu den Einschätzungen, die noch Ende der achtziger Jahre dominierten. Solow hatte 1987 in einer Buchbesprechung im New York Times Book Review bemerkt: "We see the Computer age everywhere except in the productivity statistics". [Fn. 98: Solow, R.M., The New York Times Book Review, July 12,1987, S. 36 ] Dieses "Produktivitätsparadoxon" ist in der Literatur breit diskutiert worden und hat zahlreiche Erklärungsversuche provoziert. Denn weshalb trotz des Vordringens der Computer in alle Lebensbereiche die Produktivitätszahlen davon keine rechte Kenntnis nehmen wollten, stellte in der Tat ein Rätsel dar.
In den letzten Jahren scheinen die Effekte der Informationstechnologien sich nun auch in den Produktivitätsstatistiken niederzuschlagen. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine geraume Zeit vergeht, bis sich mit neuen Technologien auch die entsprechenden Produktivitätseffekte verbinden. Aber für die in den letzten vier Jahren festzustellende Erhöhung der Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität liegen auch konkurrierende Erklärungen vor. So lässt sich ein Teil durch ein verändertes Deflationierungsverfahren der Nominalgrößen erklären, das im Ergebnis den Zähler der Arbeitsproduktivität stärker steigen lässt. Von Gordon [Fn. 99: Gordon, R.J., Has the 'New Economy' Rendered the Productivity Slowdown Obsolete?, unveröffentlichtes Manuskript 1999] ist überdies festgestellt worden, dass die Produktivitätssteigerungen im wesentlichen durch die bei der Herstellung der Informationstechnologien eingetretenen starken Produktivitätssteigerungen erklärt werden können. Wenn sich das als korrekt erweist, heißt es im Umkehrschluss, dass sich aus der Nutzung dieser Technologien noch immer nicht die davon erwarteten Produktivitätssteigerungen ergeben haben.
Insgesamt wird man sagen müssen, dass es entschieden zu früh ist, bereits ein neues ökonomisches Zeitalter auszurufen. Man kann aber Blinder zustimmen, wenn er sagt: "[I]t does appear that the economy can sustain a higher growth rate than most people
[Seite der Druckausg.: 110 ]
thought plausible just a year or two ago. In that limited respect, at least, we appear to be in a 'New Economy’. [Fn. 100: a.a.O., S. 6]
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juni 2001