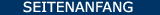![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
-
3. Ein sklerotischer Arbeitsmarkt hier - flexible Arbeitsmärkte da?
3. Ein sklerotischer Arbeitsmarkt hier - flexible Arbeitsmärkte da?
[Seite der Druckausg.: 35 ]
3.1 Empirischer und theoretischer Hintergrund
Bereits einleitend ist darauf hingewiesen worden, dass die günstigere Beschäftigungsentwicklung in den USA von der herrschenden Wirtschaftswissenschaft vor allem dem als wesentlich flexibler angesehenen amerikanischen Arbeitsmarkt zugeschrieben wird. Obwohl sich in den verschiedenen europäischen Ökonomien ja durchaus unterschiedliche Entwicklungen bei Beschäftigung und Arbeitslosigkeit ergeben haben, wird z.T. von einer "europäischen Arbeitslosigkeit" gesprochen [Fn.32: Bean, C.R., European Unemployment: A Survey, Journal of Economic Literature, Vol. 32 (1994), S. 573-619] und damit suggeriert, dass die europäischen Wirtschaften ihre Arbeitslosigkeit einem einheitlichen oder doch zumindest ähnlichen Problem verdanken, nämlich einer nicht ausreichenden Flexibilität ihrer Arbeitsmärkte. Flexibilisierung - was immer das dann genau bedeutet - lautet dann der naheliegende Therapievorschlag. Nicht selten gewinnt man den Eindruck, dass diese Empfehlung im Kern darauf hinaus läuft, sich mehr oder weniger weitgehend an die amerikanischen Verhältnisse anzupassen.
Nun sollten Ökonomen spätestens seit Keynes wissen, dass es durchaus fragwürdig sein kann, wenn man die Ursachen der Arbeitslosigkeit ausschließlich am Arbeitsmarkt sucht und meint, dass auch die Reduktion von Arbeitslosigkeit nur durch institutionelle Veränderungen am Arbeitsmarkt möglich ist. Die von Keynes vermittelte Botschaft war, dass hohe Arbeitslosigkeit durch Fehlentwicklungen an Produkt- und Kapitalmärkten ausgelöst wird, die sich dann auch in einer zu geringen Nachfrage nach Arbeitskräften seitens der Unternehmen niederschlagen. Beschäftigungspolitik hätte demnach bei diesen Fehlentwicklungen anzusetzen, d.h. zunächst an den Produkt- und Kapitalmärkten und erst in zweiter Linie am Arbeitsmarkt.
Dass diese Sicht der Dinge heute nicht mehr die vorherrschende ist, hat mit verschiedenen Umständen zu tun. Zunächst ist ganz allgemein festzustellen, dass vorkeynesianisches Denken seit den siebziger Jahren wieder salonfähig geworden ist. Dazu beigetragen hat zum einen die reale Entwicklung, auf die die Keynesianer
[Seite der Druckausg.: 36 ]
zunächst Antworten gaben, die vielfach als unbefriedigend angesehen wurden. Aber auch auf theoretischer Ebene haben sich für den Keynesianismus Herausforderungen ergeben. Der Monetarismus ist hier zu nennen, später dann die sogenannte Neue Klassische Makroökonomik. Letztere hat, aufbauend auf der Theorie rationaler Erwartungen, die Interventionsstrategie des Keynesianismus ganz grundsätzlich in Frage gestellt und denjenigen etwas anspruchsvollere Argumente verschafft, denen ein intervenierender und in wirtschaftliche Prozesse eingreifender Staat von jeher suspekt war.
Bedeutsam für die Abwendung von Keynes war aber vor allem, dass die Mehrzahl der Ökonomen die Auffassung vertrat, dass die Arbeitslosigkeit, wie sie - nach einer Phase der Vollbeschäftigung - in den siebziger Jahren nach Europa zurück gekehrt ist, von anderer Art ist als diejenige, die von Keynes vorgefunden wurde.
Zwischen verschiedenen Formen von Arbeitslosigkeit zu unterscheiden, war unter Ökonomen schon seit langem eine beliebte und ausdauernd betriebene Beschäftigung. Dass hier nicht nur ein Interesse an Klassifizierung und Systematisierung am Werk ist, wird mit dem schwer abweisbaren Argument begründet, dass schließlich einer geeigneten Therapie die richtige Diagnose voranzugehen habe. [Fn.33: Diesem offenkundig der Medizin gedankten Argument ist man allerdings versucht entgegenzuhalten, dass sich auch Beispiele anführen ließen, in denen es ohne richtige, ja sogar bei falscher Diagnose zu erfolgreichen Therapien gekommen Ist. Darauf sollte man aber natürlich nicht bauen.]
Recht unterschiedliche Typen von Arbeitslosigkeit sind von Ökonomen in der Vergangenheit unterschieden worden. Wir wollen uns hier auf zwei Einteilungen beschränken, die jeweils auf der Gegenüberstellung von zwei Typen beruhen. Die erste Klassifizierung besteht in der Gegenüberstellung von keynesianischer und von klassischer Arbeitslosigkeit [Fn.34: Zum dahinter stehenden theoretischen Ansatz siehe vor altem Malinvaud, E., The Theory of Unemployment Reconsidered, Oxford 1977] . Unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten ist diese Unterscheidung vor allem deshalb interessant, weil Arbeitslosigkeitstypen unterschieden werden, für die die immer wieder genannte Therapie zur Überwindung von Arbeitslosigkeit, nämlich den Reallohn zu senken, sich als sehr unterschiedlich geeignet erweist. Im Falle der keynesianischen Arbeitslosigkeit ist diese Therapie wirkungslos, im Fall der klassischen Arbeitslosigkeit dagegen angebracht. Folgt man
[Seite der Druckausg.: 37 ]
dem theoretischen Ansatz, der zu dieser Unterscheidung führt, wird man zunächst vor allem dem Diagnoseproblem Beachtung schenken, denn die richtige Diagnose der Arbeitslosigkeit entscheidet darüber, ob man die richtigen Mittel zur ihrer Überwindung einsetzt.
Die zweite Einteilung, auf die hier verwiesen werden soll, besteht in der Unterscheidung zwischen konjunktureller und struktureller Arbeitslosigkeit. Statt von konjunktureller ist mitunter auch von keynesianischer oder von nachfragedefizitärer Arbeitslosigkeit (deficient demand unemployment) die Rede. Die Grundidee dieser Einteilung besteht darin, dass nur bei einer in einer allgemeinen Nachfrageschwäche begründeten und sich in Unterauslastung der Kapazitäten niederschlagenden Arbeitslosigkeit die Stimulierung der Nachfrage angebracht ist. Nach weit verbreiteter Überzeugung richtet letztere aber nur Schaden an (höhere Inflationsrate!), wenn die Ursachen der Arbeitslosigkeit struktureller Natur sind. Als "strukturell" wird dabei eine Fülle von Sachverhalten angesehen. Dementsprechend ist es auch nicht immer die Reallohnsenkung, die hier Abhilfe verspricht. Hat man es z.B. mit einem "Mismatch" zwischen angebotenen und nachgefragten Qualifikationen am Arbeitsmarkt zu tun, wird man eine darauf zurückgehende Arbeitslosigkeit weder durch Stimulierung der Nachfrage noch durch Absenkung des Reallohnniveaus beseitigen können.
Zahlreiche Untersuchungen sind mit dem Ziel durchgeführt worden, für einzelne Länder das jeweilige Ausmaß von konjunktureller und struktureller Arbeitslosigkeit abzuschätzen. Die Ergebnisse streuen erheblich, kommen mehrheitlich aber doch zu dem Ergebnis, dass die konjunkturelle Komponente nur den kleineren Anteil der Arbeitslosigkeit erklären kann. Damit scheint es notwendig, sich insbesondere den strukturellen Ursachen der Arbeitslosigkeit zuzuwenden.
Die Abwendung von der Nachfragepolitik wurde aber noch durch eine andere Entwicklung befördert. Bereits 1968 sind von Friedman und von Phelps Argumente vorgetragen worden, die die damals vorherrschende Überzeugung von der Existenz einer stabilen Phillips-Kurve in Frage stellten [Fn.35: Siehe Friedman, M., The Role of Monetary Policy, The American Economic Review 58 (1968), S. 1-17 und Phelps, E., Money-Wage Dynamics and Labor-Market Equilibrium, Journal of Political Economy 76 (1968), S. 678-711] . Von Phillips selbst ursprünglich als Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und Wachstumsrate des Nominallohn-
[Seite der Druckausg.: 38 ]
satzes ermittelt, war die Phillips-Kurve dann zu einer (inversen) Beziehung zwischen Arbeitslosenquote und Inflationsrate umdefiniert worden, die der Wirtschaftspolitik die Wahl offen zu lassen schien, ob sie sich für etwas mehr Inflation oder etwas mehr Arbeitslosigkeit entscheidet.
Dass eine solche Wahl getroffen werden könne, wurde von Friedman und von Phelps bestritten. Sie führten das folgenreiche Konzept der "natürlichen Arbeitslosenquote" ein und versuchten nachzuweisen, dass man durch Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage nur kurzfristig, nicht jedoch auf längere Frist eine niedrigere Arbeitslosigkeit herbeiführen könne. Das Argument beruhte im wesentlichen darauf, dass es zu einer Erhöhung der Beschäftigung nur kommen könne, solange die wirtschaftlichen Agenten Überraschungen erleben. Wenn sich die Erwartungen erst einmal angepasst haben, landet man wieder beim alten Beschäftigungsgrad, muss nun aber eine höhere Inflationsrate als zuvor in Kauf nehmen. Längerfristig betrachtet gibt es, dieser Sicht zufolge, keinen "trade-off" zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation, wie er in der herkömmlichen Phillips-Kurve seinen Ausdruck fand. Die langfristige Phillips-Kurve ist vielmehr eine vertikale Linie durch die "natürliche Arbeitslosenquote".
Diese Position ist dann später von Lucas [Fn.36: Siehe z.B. Lucas, R., Expectations and the Neutrality of Money, Journal of Economic Theory 4 (1972); S. 103-124 ] und anderen Vertretern der sogenannten Neuen Klassischen Makroökonomik weiter radikalisiert worden, indem einer Nachfragepolitik noch nicht einmal kurzfristige Erfolge zugestanden wurden (Politikineffektivitätshypothese). Es ist nicht notwendig, darauf näher einzugehen, zumal es um diese Richtung inzwischen wieder etwas ruhiger geworden ist. Was sich aber erhalten und auch in die Argumente von sogenannten neukeynesianischen Autoren eingeschlichen hat [Fn.37: Siehe die bereits zitierten Lehrbücher von Blanchard und Mankiw.] , ist die Sicht, dass mit Stützung und Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage allenfalls kurzfristig Beschäftigungserfolge zu erzielen sind, während auf längere Frist gesehen damit nur die Inflationsrate nach oben getrieben würde. Fast zwangsläufig trat damit die Frage in den Vordergrund, was denn nun eigentlich diejenige Arbeitslosenquote bestimmt, von der man sich allenfalls kurzfristig, aber nicht auf Dauer entfernen kann, wenn man nur die herkömmlichen Mittel der Makropolitik zum Einsatz bringt. Die "natürliche Arbeitslosenquote" und ihre Bestimmungsgrößen wurden damit zur eigentlich interessanten Frage.
[Seite der Druckausg.: 39 ]
Mehr als die anderen genannten Gründe dürfte diese verbreitete Sicht der Dinge dazu geführt haben, dass eine nachfrageseitig ansetzende Beschäftigungspolitik in Misskredit geraten ist und sich die Aufmerksamkeit ganz auf die in den Angebotsfaktoren vermuteten Ursachen der Arbeitslosigkeit richtete.
3.2 Die NAIRU als Ausdruck der Verfassung des Arbeitsmarkts
Der Versuch, zwischen einer konjunkturellen und strukturellen Form der Arbeitslosigkeit zu unterscheiden, hat insbesondere dazu geführt, dass der Höhe und den Bestimmungsgründen dessen, was von Friedman als "natürliche Arbeitslosenquote" bezeichnet worden war, große Beachtung geschenkt wurde. Dieser von manchen Ökonomen als anstößig empfundene Begriff war von Friedman nicht in dem Sinne verstanden worden, dass eine bestimmte Höhe der Arbeitslosigkeit als ein gleichsam der Natur geschuldetes Schicksal .hinzunehmen sei. Vielmehr sollte damit ausgedrückt werden, dass die vollständige Markträumung des Walrasianischen Gleichgewichtsmodells in der Realität nicht vorliegt und man mit mehr oder weniger großen Abweichungen davon rechnen muss. Da die Abweichungen von den gesellschaftlichen Institutionen abhängen, ist die "natürliche Arbeitslosenquote" durchaus gesellschaftlich bedingt und damit auch Veränderungen unterworfen. Dennoch wird im Grundsatz der Anspruch erhoben, dass für eine bestimmte Periode die "natürliche Arbeitslosenquote" ermittelt werden kann.
Im Verlauf der Debatte hat sich eine gewisse Verschiebung ergeben. Die "natürliche Arbeitslosenquote" ist durch das damit verwandte, aber nicht deckungsgleiche Konzept der NAIRU ersetzt worden, wobei NAIRU für "non-accelerating inflation rate of unemployment" steht. Teilweise wird auch eine NAWRU (für "non-accelerating wage rate of unemployment") verwendet. [Fn.38: Vor allem die OECD verwendet dieses Konzept und spricht diesbezüglich auch von einer Trend unemployment rate". Siehe etwa OECD, Economic Outlook, 65, Paris 1999]
Der Grundgedanke ist dabei, auf ökonometrischem Wege diejenige Arbeitslosenquote zu bestimmen, bei der es in der jeweils betrachteten Ökonomie zu keiner Veränderung - also weder zu einer Erhöhung noch zu einem Rückgang - der Inflations- (bzw.
[Seite der Druckausg.: 40 ]
Lohnsteigerungs-)rate kommt. Eher als der jeweiligen aktuellen Arbeitslosenquote wird der so ermittelten eine wesentliche Indikatorfunktion zugeschrieben: Die Höhe (und zusätzlich eventuell Veränderungsrichtung) der NAIRU - oder auch der NAWRU - soll Aufschluss über den grundsätzlichen Zustand des Arbeitsmarkts geben. Sie soll gleichsam - in einer einzigen Größe zusammengefasst - Auskunft über all die strukturellen und institutionellen Bedingungen angeben, die auf den Arbeitsmarkt einwirken. So gesehen, kann die NAIRU (bzw. die NAWRU) als ein Globalindikator verstanden werden, in dem die Flexibilität - oder mangelnde Flexibilität - des Arbeitsmarkts zum Ausdruck kommt. Da es sich dabei um keine konstante, sondern in der Zeit veränderliche Größe handelt, scheint sie durch ihre Veränderung auch Hinweise darüber zu liefern, ob es im Verlauf der Zeit zu einer Verstärkung oder Verringerung der Inflexibilitäten gekommen ist.
In der folgenden Tabelle sind 23 OECD Länder gemäß der Entwicklung der NAWRU im Zeitraum 1990-96 in drei Gruppen eingeteilt: die erste erfasst diejenigen Länder, in denen diese Größe zugenommen hat, die zweite diejenigen, in denen sie einigermaßen stabil geblieben ist und die letzte schließlich die Gruppe der Länder mit einer abnehmenden NAWRU in diesem Zeitraum.
[Seite der Druckausg.: 41 ]
Tabelle 3.1: Strukturelle Arbeitslosigkeit in 23 OECD Ländern, 1990-96 39
(NAWRU)
- [Fn.39: Basierend auf nationalen Arbeitslosendefinitionen. Strukturelle Arbeitslosendaten basieren auf OECD Schätzungen der NAWRU, veröffentlicht für OECD Economic Outlook, Nr. 60. 1996. Eine Änderung wird als signifikant erachtet, wenn eine Standardabweichung überschritten wird. Letztere wurde berechnet für jede Reihe und jedes Land In der Zeitspanne von 1990-96. Die Länder werden in absteigender Reihe aufgeführt, angefangen vom höchsten relativen Anstieg der strukturellen Arbeitslosenquote (Finnland) bis zur größten Senkung (Irland).]
% der gesamten Arbeitskraft
|
1990 |
1996 |
|
|
Gestiegen: |
|
|
|
Finnland |
8,0 |
15,4 |
|
Schweden |
3,2 |
6,7 |
|
Deutschland |
6,9 |
9,6 |
|
Island |
1,5 |
3,8 |
|
Schweiz |
1,3 |
3,1 |
|
Spanien |
19,8 |
20,9 |
|
Griechenland |
7,0 |
8.0 |
|
Italien |
9,7 |
10,6 |
|
Portugal |
4,9 |
5,8 |
|
Österreich |
4,9 |
5,4 |
|
Frankreich |
9,3 |
9,7 |
|
Ziemlich stabil: |
|
|
|
Norwegen
|
4,2 |
5,1 |
|
Australien |
8,2 |
8,5 |
|
Japan |
2,5 |
2,7 |
|
Türkei |
7,6 |
7,5 |
|
USA |
5,8 |
5,6 |
|
Belgien
|
10,8 |
10,6 |
|
Kanada2 0,9 |
8,5 |
|
|
Dänemark2 |
9,6 |
9,0 |
|
Fallend: |
|
|
|
Niederlande |
7,0 |
6,3 |
|
Neuseeland |
7,3 |
6,0 |
|
Großbritannien |
8,4 |
7,0 |
|
Irland |
16,0 |
12,8 |
|
OECD strukturelle Arbeitslosenrate
|
6,8 |
7,1 |
|
Quelle: eigene Darstellung nach Angaben der OECD | ||
[Seite der Druckausg.: 42 ]
Deutschland ist dieser Tabelle zufolge den USA (und auch zahlreichen weiteren Ländern) gegenüber doppelt im Nachteil. Die NAWRU lag 1996 über dem Durchschnitt der OECD-Länder und noch deutlicher über dem Wert für die USA. Dazu kommt, dass sich von 1990-1996 ein deutlicher Anstieg ergeben hat, nämlich von 6,9 auf 9,6 Prozent. Wenn man NAWRU und/oder NAIRU eine aussagekräftige Indikatorfunktion zuschreibt, muss man also offenbar den Schluss ziehen, dass es um die Flexibilität des deutschen Arbeitsmarkts nicht gut steht und dass es im betrachteten Zeitraum zudem zu einer deutlichen weiteren Verschlechterung gekommen ist.
Nun sollte man allerdings die Aussagekräftigkeit von NAIRU und NAWRU nicht überschätzen. Sie beruhen zum einem auf theoretisch nicht unumstrittenen Konzepten, weisen des weiteren je nach verwendetem Schätzansatz und Datenmaterial nicht unerhebliche Unterschiede auf und schließlich haben die ermittelten Werte teilweise Konfidenzintervalle (90% Niveau), die die ihnen mitunter zugestandene Indikatorfunktion doch erheblich in Zweifel ziehen. Zum Beleg dieser Aussage mag die folgende Tabelle dienen, die für eine Reihe europäischer Länder die NAIRU-Schätzung der Europäischen Gemeinschaft für das Jahr 1993 sowie die Unter- und Obergrenzen der Schätzung ausweist.
Tabelle 3.2: Konfidenzintervalle der NAIRU in den Mitgliedstaaten, 1993
(In % der zivilen Erwerbsbevölkerung)
|
Länder |
Untergrenze |
NAIRU-Schätzung |
Obergrenze (1) |
Beobachtete Arbeitslosenquote (2) |
|
B |
3,1 |
9,1 |
28,5 |
9,4 |
|
DK |
1,8 |
3,5 |
32,0 |
10,4 |
|
WD |
2,2 |
3,9 |
13,0 |
5,6 |
|
GR |
0,3 |
6,4 |
9,7 |
|
|
E |
3,3 |
13,8 |
48,4 |
21,8 |
|
F |
4,4 |
8,0 |
20,4 |
10,8 |
|
IRL |
3,3 |
11,4 |
18,4 |
|
|
| |
3,5 |
8,0 |
24,8 |
11,1 |
|
NL |
3,5 |
7,6 |
17,8 |
8,8 |
|
P |
3,0 |
6,8 |
19,9 |
5,1 |
|
UK |
1,2 |
7,6 |
10,4 |
|
|
(1) In manchen Fällen wird die Obergrenze wegen großer Standardfehler bedeutungslos (>100 %). | ||||
|
(2) Harmonisierte Definitionen von Eurostat | ||||
|
Quelle: Europäische Wirtschaft, Nr. 59 (1995) | ||||
[Seite der Druckausg.: 43 ]
Die großen Abstände zwischen Unter- und Obergrenze zeigen, dass wir es bei der NAIRU (und das gilt entsprechend auch für die NAWRU) mit keinem sehr verlässlichen Indikator zu tun haben. Auch die Tatsache, dass die NAIRU-Schätzung für Deutschland unter den erfassten Ländern nun den zweitniedrigsten Wert aufweist, wohingegen Deutschland in der vorangegangenen Tabelle (in der allerdings die NAWRU das Kriterium abgibt) über dem OECD-Durchschnitt liegt, lässt Zweifel an der Aussagekraft dieses Indikators aufkommen.
Am Beispiel der amerikanischen Wirtschaft lässt sich besonders gut illustrieren, dass ein allzu großes Vertrauen in die NAIRU (oder NAWRU) zu erheblichem Schaden hätte führen können. Diejenigen, die Schätzungen der NAIRU für die US-amerikanische Wirtschaft vorgenommen hatten, sahen diese in den 90er Jahren überwiegend bei etwas über 6 Prozent. Das Unterschreiten dieses Werts von der aktuellen Arbeitslosenquote wäre dementsprechend als ein Zeichen zu verstehen gewesen, dass mit einem Anstieg der Inflationsrate gerechnet werden muss. Eine weitere Reduktion der Arbeitslosenquote hätte insofern mit den Mitteln der Makropolitik verhindert werden müssen.
Das ist bekanntlich nicht geschehen und daran hat man offenkundig gut getan. Ende 1999 lag die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten bei 4,1 Prozent und von einem Anstieg der Inflationsrate war nichts zu sehen. Hätten die für die Geld- und Fiskalpolitik Zuständigen die NAIRU so ernst genommen wie viele Ökonomen, wäre der längste Aufschwung der amerikanischen Nachkriegsgeschichte sicher vorzeitig gekappt worden.
3.3 Verschiedene Dimensionen von Flexibilität und Ihre Beurteilung
Neben den mit Vorsicht zu genießenden Informationen, die von NAIRU oder NAWRU über das strukturell bedingte Ausmaß der Arbeitslosigkeit - und damit angeblich in summarischer Form über Flexibilität oder Inflexibilität einer Ökonomie - geliefert werden, gibt es auch Versuche, die Flexibilität (bzw. Rigidität) von Ökonomien durch differenziertere Betrachtungen bestimmter institutioneller Bedingungen zu beurteilen. Obwohl man zur Beurteilung einer Ökonomie dabei die Produkt- und Kapitalmärkte
[Seite der Druckausg.: 44 ]
sicherlich genauso einzubeziehen hätte wie den Arbeitsmarkt, ist es regelhaft doch so, dass die Aufmerksamkeit fast vollkommen dem Arbeitsmarkt gilt und insofern die Flexibilität einer ganzen Ökonomie danach beurteilt wird, ob ihr Arbeitsmarkt durch mehr oder weniger rigide Strukturen gekennzeichnet ist. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir diese einseitige Konzentration auf den Arbeitsmarkt für ganz und gar verfehlt halten. Ob und in welchem Umfang neue Arbeitsplätze entstehen, hängt u.E. entscheidend davon ab, welche Flexibilität Produktmärkte aufweisen - ob nämlich makro- wie mikroökonomisch solche Bedingungen vorherrschen, die eine schnelle Reaktion auf die Veränderungen der Nachfrage gestatten und damit dafür sorgen, dass Absatzchancen zu Produktionsentscheidungen führen und diese wiederum zu neuer Beschäftigung. Darauf soll jedoch erst im vierten Kapitel eingegangen werden.
Obwohl wir eine fast ausschließlich auf Arbeitsmärkte bezogene Flexibilitätsdiskussion für ganz verfehlt halten, ist die Aufgabe, die sich für uns hier stellt, zunächst einmal die, den Belegen und Argumenten nachzugehen, die für die angeblich deutlich überlegene Fähigkeit des amerikanischen Arbeitsmarkts vorgebracht werden, Jobs zu schaffen - und das noch dazu für eine ungleich schneller steigende Erwerbsbevölkerung als in Deutschland. Die Themen, bzw. Behauptungen, die wir dabei aufgreifen wollen, sind die folgenden:
- Ein weitgehender Kündigungsschutz in Deutschland einerseits, eine geringe Sicherung amerikanischer Arbeitnehmer gegen Entlassung andererseits, trage zur höheren Flexibilität des amerikanischen Arbeitsmarktes bei.
- Überwiegend individuell ausgehandelte Arbeitsverträge in den USA gegenüber einem starren System des Flächentarifvertrags in Deutschland würden für ein deutlich beschäftigungsfreundlicheres Klima in den USA sorgen.
- Größere Lohnunterschiede - insbesondere zwischen unterschiedlich qualifizierten Arbeitskräften - in den USA führe zu mehr Beschäftigung. Insbesondere würden sich dadurch die Beschäftigungschancen der wenig Qualifizierten erhöhen.
- Das gesamte System der sozialen Sicherung in Deutschland, insbesondere aber eine recht großzügig bemessenes Arbeitslosengeld, führe zu Fehlanreizen, die in der Summe eine höhere Arbeitslosigkeit zur Folge hätten als ein
[Seite der Druckausg.: 45 ]
System, das solche Fehlanreize vermeidet oder sogar explizit Anreize zur Aufnahme von Beschäftigung schafft. Letzteres sei in den USA eher der Fall.
All diese Punkte verweisen auf angebotsseitige Unterschiede. Liegt hier das ganze Geheimnis der unterschiedlichen Beschäftigungsentwicklung?
3.3.1 Kündigungsschutz und Beschäftigungsdynamik
Dass ein stärkerer Schutz der Arbeitnehmer vor Kündigung die Beschäftigung negativ beeinflussen soll, muss zunächst als eine recht wunderliche Behauptung erscheinen. Da Kündigungsschutz ja dazu da ist, eine Absicherung gegen jederzeitige Entlassung zu bieten, würde man von einem höheren Kündigungsschutz zunächst die Erhaltung von Beschäftigung und das heißt, einen positiven Effekt im Hinblick auf die Beschäftigung erwarten.
Diejenigen, die einen negativen Zusammenhang zwischen (hohem) Kündigungsschutz und Beschäftigung betonen, haben aber nicht die mehr oder minder ausgeprägte Sicherung gegen Entlassung vor Augen, sondern betonen vor allem die durch einen besseren Kündigungsschutz errichteten Einstellungshemmnisse. Etwas vergröbert gesagt, läuft ihr Argument auf die Behauptung hinaus, dass ein weit ausgebauter Kündigungsschutz die Arbeitgeber dazu bringen wird, nur noch bei sehr sicheren Indikatoren einer nachhaltigen und länger andauernden Absatzausweitung Neueinstellungen vorzunehmen. Ein ausgebauter Kündigungsschutz bedeutet, dass Arbeit zu einem quasi-fixen Faktor wird, von dem man sich bei Änderungen der Nachfrage nicht so ohne weiteres und eventuell nur unter erheblichen Kosten wieder "befreien" kann. Da dies bei Personalplanungen bereits antizipiert werde, wirkt sich, dem Argument zufolge, ein stärkerer Kündigungsschutz negativ auf die Beschäftigung aus.
Sehen wir uns zunächst die Fakten an. Tatsächlich gibt es in der Bundesrepublik Deutschland einen gesetzlichen Kündigungsschutz. Fristen für die einseitige Auflösung eines Arbeitsverhältnisses sind im BGB geregelt, wobei diese Regelungen dann gelten, wenn nicht tarifvertraglich andere Vereinbarungen getroffen wurden. Die
[Seite der Druckausg.: 46 ]
gesetzlichen Vorschriften sehen insbesondere vor, dass mit einer längeren Zugehörigkeit zu einem Betrieb auch eine Verlängerung der allgemeinen Kündigungsfrist einhergeht.
Neben dem BGB spielt das Kündigungsschutzgesetz eine wesentliche Rolle. Es ist vor allem deshalb bedeutsam, weil darin die Zulässigkeit von Kündigungen der Arbeitgeber näher definiert wird. Insbesondere legt das Gesetz auch fest, wann eine Kündigung als "sozial ungerechtfertigt" anzusehen ist. Grundsätzlich werden solche Kündigungen als nicht zulässig angesehen. Wenn sie dennoch erfolgen, bedeutet das in der Praxis allerdings häufig nicht, dass der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz behält. In der Auseinandersetzung vor dem Arbeitsgericht hat dies vielmehr oft nur Einfluss auf die Höhe der Abfindung.
Neben BGB und Kündigungsschutzgesetz wirkt in Deutschland auch das Betriebsverfassungsgesetz auf die zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern bestehenden Rechtsverhältnisse ein. Es legt die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats bei Einstellungen und Kündigungen fest und ist insofern ebenfalls von Bedeutung, wenn die den Arbeitgebern zur Verfügung stehenden Dispositionsspielräume über ihr Personal beurteilt werden sollen.
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass nicht nur Gesetzes- sondern auch Richterrecht über die Flexibilität bzw. Rigidität von Arbeitsmärkten mitentscheidet. Deutschen Arbeitsgerichten, insbesondere auch dem Bundesarbeitsgericht, ist bisweilen der Vorwurf gemacht worden, dass sie die ökonomischen Folgen ihrer Entscheidungen nicht bedenken und dazu beigetragen haben, dass ein durch Gesetzesvorschriften bereits stark regulierter Arbeitsmarkt noch weiter an Flexibilität verloren habe [Fn.43: Zu einer Darstellung und Bewertung solcher Vorwürfe siehe Franz, W., Chancen und Risiken einer Flexibilisierung des Arbeitsrechts aus ökonomischer Sicht, Friedrich-Ebert-Stiftung, Kocheler Kreis (Hrsg.), Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt, Arbeitsinarktpolitik - Reformen bei der Gestaltung und Finanzierung, Bonn 1994, S. 37-59] .
Demgegenüber haben amerikanische Arbeitgeber eine viel freiere Hand, wenn sie Kündigungen aussprechen. Zwar ist es übertrieben, wenn gelegentlich die Situation am amerikanischen Arbeitsmarkt als ein reines "hiring and firing" dargestellt wird. Auch
[Seite der Druckausg.: 47 ]
hier gilt, dass nicht reine Arbeitgeberwillkür herrscht. Die Grenzen sind aber weniger durch Gesetze oder Tarifverträge gezogen, sondern eher durch Verhaltensregeln, gegen die zu verstoßen aber nicht immer folgenlos bleibt. Da die negativen Folgen von Verstößen gegen allgemein akzeptierte Normen in der Regel antizipiert werden, können sie mitunter durchaus eine ähnliche Kraft wie Gesetze oder Verträge entfalten. Dennoch bleibt festzuhalten, dass Arbeitnehmer in Deutschland insgesamt besser gegen Kündigung geschützt sind.
Was folgt daraus? Wie von uns schon angedeutet wurde, muss man der durch einen stärkeren Kündigungsschutz erzielbaren höheren Stabilität der Beschäftigungsverhältnisse die damit möglicherweise errichteten Einstellungshemmnisse gegenüberstellen. Zu welchem Nettoergebnis man dabei kommt, ist nicht so ganz klar. Die folgende Position ist jedoch nicht unplausibel: "Zusammengenommen spricht vieles dafür, dass der Kündigungsschutz zyklische Schwankungen im Beschäftigungsgrad dämpft, hingegen die trendmäßige Beschäftigung auf einem etwas niedrigeren Pfad ansiedelt." [Fn.44: Franz, W., a.a.O., S. 42]
Den Vertretern der Position, dass nur durch entschlossene Deregulierung - im konkreten Fall also durch Stutzung eines "übertriebenen" Kündigungsschutzes - der Beschäftigungsdynamik wieder auf die Sprünge geholfen werden kann, wird mit solchen Einschätzungen keine Argumentationshilfe geboten. Zum einen handelt es sich um eine Einschätzung ("spricht vieles dafür"), für die keine aussagekräftigen Indikatoren geliefert werden. Aber auch wenn sich die Einschätzung als zutreffend erweisen sollte, müssten Größenordnungen (Dämpfung zyklischer Schwankungen vs. Verringerung des Trends) bekannt und zusätzlich in ihrem Einfluss auf die Wohlfahrt abschätzbar sein, um ein Urteil über die richtige Politik abzugeben. Mit mühsamen Überlegungen dieser Art geben sich diejenigen allerdings nicht ab, für die sowieso schon feststeht, dass nur eine entschlossene Deregulierung zu mehr Beschäftigung führen kann.
Als durchaus problematisch muss es auch angesehen werden, wenn geringerer Kündigungsschutz mit größerer Flexibilität gleichgesetzt wird. Worauf es der Sache nach ankommt, ist ja, dass sich Unternehmen an neue Bedingungen anpassen
[Seite der Druckausg.: 48 ]
können. Dabei kann es um recht verschiedene Formen der Anpassung gehen. Wir wollen nur zwei ansprechen: Anpassung an eine verschlechterte Absatzsituation (z.B. wegen einer allgemeinen Rezession); Anpassung an neue Qualifikationsanforderungen.
Bei rückläufigem Absatz werden Unternehmen die Produktion zurückfahren wollen. Dadurch entsteht auch auf der Arbeitseinsatzseite Anpassungsbedarf. Dieser erfordert aber nicht zwingend die Entlassung von Arbeitskräften. Eine andere Form ist die Anpassung der Arbeitszeit, z.B. in Form der Kurzarbeit. Abraham und Houseman [Fn. 45: Abraham, K.G. and Houseman, S.N., Job Security in America. Lessons from Germany, Washington D.C.1993] haben darauf hingewiesen, dass in Deutschland die letztere Form der Anpassung dominiert, in den USA dagegen die Kündigung. Nach ihrer Auffassung ergibt sich aus der anderen Form, in der die Anpassung an Produktionsrückgänge erfolgt, kein Vertust an Flexibilität gegenüber den Vereinigten Staaten.
Nun könnte man einwenden, dass sich eine Anpassung der Arbeitszeit gegenüber der Kündigung als die teurere Variante erweist - wenn nicht für die Unternehmen (sofern staatlicherseits Kurzarbeitergeld bezahlt wird), so doch für die Volkswirtschaft insgesamt. Das ist aber keineswegs notwendigerweise so. In vielen Firmen werden Arbeitskräfte mit betriebsspezifischen Qualifikationen beschäftigt, die erst durch spezielle Schulungen und häufig auch erst im Verlauf einer längeren Betriebszugehörigkeit erworben werden. In solchen Fällen käme es durch Entlassungen zu einem Verlust von Know-how, der nur mühsam und kostenaufwendig wieder kompensiert werden könnte. Die Anpassung der Arbeitszeit kann sich hier auch unter Kostengesichtspunkten als die überlegene Form der Anpassung erweisen.
Auch bei neuen Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten - hervorgerufen etwa durch neue Produktionstechniken oder Veränderungen der Produktpalette - gibt es in der Regel Alternativen. Man kann versuchen, durch Kündigung und Neueinstellung das neue Qualifikationsprofil herbeizuführen; man kann aber auch durch innerbetriebliche Umsetzung und/oder Schulung der Belegschaft die notwendigen Anpassungen erreichen. Obwohl das statistische Material über die letztere Form der Anpassung dürftig ist, gibt es Hinweise, dass die damit erzielbare
[Seite der Druckausg.: 49 ]
Flexibilität in der Bundesrepublik Deutschland eine größere Rolle als in den USA gespielt hat.
Insgesamt sollte man also festhalten, dass man in einem stärkeren Kündigungsschutz nicht ein Element der Rigidität und in einem geringen Schutz gegen Kündigung nicht einen Indikator der Flexibilität des Arbeitsmarkts sehen sollte. Die notwendigen quantitativen und qualitativen Anpassungen der Beschäftigung an veränderte Umstände sind auf verschieden Wegen zu erreichen, deren Vor- und Nachteile jeweils gegeneinander abzuwägen sind.
Hinzuweisen ist schließlich auch noch auf folgendes. Auch diejenigen, die den in Deutschland bestehenden gesetzlichen Kündigungsschutz für beschäftigungshemmend halten, werden nicht bestreiten, dass der starke Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland eher mit einem rückläufigen Schutz gegen Kündigung einhergegangen ist. So ist z.B. mit dem 1985 in Kraft getretenen Beschäftigungsförderungsgesetz die Möglichkeit geschaffen worden, auch befristete Arbeitsverträge abzuschließen. Wäre das wesentliche Einstellungshemmnis wirklich der Kündigungsschutz, hätte man eine massive Inanspruchnahme erwarten müssen. Das scheint jedoch nicht eingetreten zu sein. [Fn. 46: Siehe, Büchtemann, C.F. Kündigungsschutz als Beschäftigungshemmnis? Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 23 (1990), S. 394-409]
3.3.2 Individuell ausgehandelte Arbeitsverträge und Flächentarifvertrag
Mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik ist das deutsche System der Lohnfindung verstärkt in die Diskussion und in die Kritik geraten. Das ist insofern wenig verwunderlich als für neoklassisch orientierte Ökonomen Arbeitslosigkeit in letzter Instanz immer mit einem zu hohen Lohnsatz zu tun hat. Damit richtet sich der Scheinwerfer ganz automatisch auf diejenigen, die die Löhne aushandeln und dabei wieder besonders auf die Seite, die dafür verantwortlich gemacht wird, dass diese -wie durch die vorliegende Arbeitslosigkeit ja belegt zu sein scheint - mit Vollbeschäftigung nicht verträglich sind: die Gewerkschaften.
[Seite der Druckausg.: 50 ]
Nun lassen sich sicher in der Literatur auch Autoren finden, die die höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland (bzw. in Europa) gegenüber den USA auf die unterschiedliche Stärke der Gewerkschaften zurückführen. Dabei wird unterstellt, dass stärkere Gewerkschaften auch höhere Lohnforderungen zu stellen und durchzusetzen in der Lage sind, die dann aber eine verringerte Arbeitsnachfrage zur Folge haben. Zusätzlich wird oft auch das Argument vorgebracht, dass von Gewerkschaften eine auf Lohnnivellierung gerichtete Politik betrieben wird, an der auch festgehalten wird, wenn diejenigen, die davon eigentlich begünstigt werden sollen, damit einem verstärkten Arbeitslosigkeitsrisiko ausgesetzt werden. Starke Gewerkschaften wären demnach nicht nur für das Niveau, sondern auch für die Struktur der Arbeitslosigkeit (überproportionale Betroffenheit der geringer Qualifizierten, bzw. derjenigen aus den niedrigeren Lohngruppen) verantwortlich.
Wir wollen uns mit dieser besonders simplen Sicht der Dinge nicht weiter auseinandersetzen. Dass es zwischen der Stärke der Gewerkschaften und der Höhe der Arbeitslosigkeit keinen klaren Zusammenhang gibt, wird durch international vergleichende Studien belegt. Worauf wir hier aber etwas näher einzugehen haben, ist der Vorwurf gegenüber dem in Deutschland praktizierten System der Lohnfindung, dass es heutigen Erfordernissen nicht mehr entspreche. Im Mittelpunkt der Kritik steht dabei der Flächentarifvertrag. Nach Auffassung seiner Kritiker nimmt er keine Rücksichten auf die Unterschiede, die in ein und demselben Tarifbereich tatsächlich bestehen und erweist sich damit als ein Hemmnis für das Entstehen von neuen Beschäftigungsverhältnissen.
Worum geht es? Tarifverträge sind Kollektivverträge und werden zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen geschlossen. Im Prinzip gelten die Verträge nur für die jeweiligen Mitglieder, also für die Mitglieder der jeweiligen Gewerkschaft einerseits, die Mitglieder des Arbeitgeberverbandes andererseits. Da die Arbeitgeber kein Interesse daran haben können, den Gewerkschaftsmitgliedern Vorzugsbedingungen zu verschaffen, werden getroffene Vereinbarungen in aller Regel auch für nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer gelten. Auf Seiten der Arbeitgeber sind dadurch jedoch nur die Mitglieder des jeweiligen Verbandes gebunden. Nur wenn es zu einer sogenannten - von staatlicher Seite ausgesprochenen - Allgemeinverbindlichkeitserklärung kommt, ist das anders. In
[Seite der Druckausg.: 51 ]
diesem Fall werden auch die nicht dem Arbeitgeberverband angehörigen Unternehmen der betreffenden Industrie der jeweiligen Regelung unterworfen.
Ein Flächentarifvertrag gilt mithin für alle im jeweiligen Arbeitgeberverband organisierten - bei Vorliegen einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung aber auch für die dort nicht organisierten - Unternehmen. Das damit verbundene Problem zeigt sich insbesondere bei so heterogenen Bereichen wie dem, der von der IG Metall organisiert wird. Dort sind recht kleine, aber auch sehr große Unternehmen angesiedelt, Unternehmen, die z.B. Automobile herstellen und andere, die z.B. feinmechanische Geräte erzeugen. In der Tat ist es schwierig sich vorzustellen, dass in solchen Bereichen eine Lohnsteigerungsrate gefunden werden kann, die allen gleichermaßen gerecht wird. Was die einen sehr leicht akzeptieren können, wird für andere mitunter existenzbedrohend. Der jeweilige Arbeitgeberverband ist damit in einer Zwangslage. Gutverdienende Unternehmen wollen vor allem einen Streik vermeiden und sind zu - auch größeren - Lohnzugeständnissen bereit. Firmen, die in scharfem Wettbewerb stehen, keine Preiserhöhungen durchsetzen und auch kurzfristig keine weiteren Rationalisierungsmaßnahmen vornehmen können, sehen sich nicht in der Lage, weitere Kostensteigerungen zu verkraften.
Die daraus gezogenen Folgerungen sind mehr oder weniger radikal. Am weitesten gehen diejenigen, die Kollektivverträge ganz beseitigen und durch individuelle Arbeitsverträge ersetzt sehen wollen. Nicht ganz soweit gehend ist der Vorschlag, zwar am Tarifvertrag festzuhalten, den Betrieben aber wesentlich größere Gestaltungsspielräume zu geben. Wieder andere wollen grundsätzlich an Tarifverträgen festhalten, die für alle gelten, von denen dann aber unter besonderen Umständen abgewichen werden kann (Öffnungsklauseln).
Es ist interessant zu beobachten, dass bei den Diskussionen über veränderte Formen der Lohnfindung die Fronten keineswegs eindeutig sind. Äußerungen der Arbeitgeberverbände, aber auch von einzelnen Arbeitgebern zeigen, dass sie - anders als viele neoliberale Ökonomen - in Tarifverträgen keineswegs nur ein überholtes, sie in ihrer Flexibilität beschränkendes Instrument sehen. Für Arbeitgeberverbände mag das noch aus ihrem Organisationsinteresse erklärbar sein - wozu noch einen Verband, wenn alles auf betrieblicher Ebene geregelt wird? Dass sich aber auch einzelne
[Seite der Druckausg.: 52 ]
Arbeitgeber für das System kollektiver Arbeitsverträge aussprechen, muss andere Gründe haben. Man kann davon ausgehen, dass sie dabei die mit diesem System für sie verbundenen Vorteile im Auge haben. Diese bestehen nicht zuletzt darin, dass Verteilungsauseinandersetzungen auf einer anderen als der betrieblichen Ebene stattfinden. Aber auch die Gewissheit, dass die Konkurrenten an den gleichen Tarifvertrag gebunden sind, an den man selbst gebunden ist, spielt eine Rolle. Man hat dadurch eine größere Sicherheit, dass man nicht mit Konkurrenten rechnen muss, die durch niedrigere Löhne einen Wettbewerbsvorteil erringen.
Auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist fraglich, ob die Vorteile, die sich aus der von der herrschenden Ökonomie immer wieder angeforderten größeren betrieblichen Lohndifferenzierung ergeben, so groß sind, dass die damit verbundenen negativen Auswirkungen überkompensiert werden. Sicher ist richtig, dass es Betriebe gibt, die überleben könnten, wenn sie nicht gezwungen wären, Löhne zu bezahlen, die angesichts ihrer spezifischen Situation nicht tragbar sind. Man darf umgekehrt aber nicht übersehen, dass Löhne, die ausschließlich am jeweiligen ökonomischen Erfolg der Unternehmen orientiert wären, dazu führen müssten, dass diejenigen Firmen ihre Beschäftigten (oder jedenfalls diejenigen mit den besten Chancen am Arbeitsmarkt) verlieren, die keine Lohnerhöhungen mitmachen könnten, wie sie in anderen Bereichen der Ökonomie zustande kommen. Umgekehrt würde in den prosperierenden Bereichen durch die überdurchschnittlichen Lohnerhöhungen die Entwicklung der Gewinne begrenzt und damit die Expansion der erfolgreichen Firmen möglicherweise beschnitten. Ob die ökonomische Entwicklung dadurch gefördert oder gehemmt wird, ist zunächst eine offene Frage.
Gegen die Kritik am deutschen System der Lohnfindung, das sich vor allem am Flächentarifvertrag festmacht, ist aber auch zu sagen, dass dabei oft übersehen wird, dass zwischen Tarif- und Effektivlöhnen erhebliche Unterschiede bestehen. Die von den Kritikern bei den Tariflöhnen vermisste Berücksichtigung der am Arbeitsmarkt vorliegenden Knappheitsverhältnisse finden bei den Effektivlöhnen viel stärker Beachtung und die gerügte Gleichmacherei bei den Löhnen kann man bei den Effektivlöhnen jedenfalls nicht feststellen. Obwohl auf die Frage der Lohndifferenzierung und ihre Bedeutung für die Beschäftigungsfrage erst im nächsten Abschnitt eingegangen werden soll, muss schon hier festgestellt werden, dass durch
[Seite der Druckausg.: 53 ]
die Möglichkeit, die Effektivlöhne zu differenzieren, dem Flexibilitätsbedarf der Ökonomie stets eine Möglichkeit zur Verfügung stand. Die Kritik am Tarifsystem läuft damit im wesentlichen darauf hinaus, dass mit ihm ein zu hoher Sockel festgelegt wurde, von dem aus erst der notwendige Differenzierungsbedarf stattfinden konnte.
3.3.3 Mangelnde Lohndifferenzierung als Beschäftigungshemmnis?
Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass Ökonomen - der von den meisten verinnerlichten Theorie folgend - Arbeitslosigkeit als die Folge eines zu hohen Lohnniveaus anzusehen gewillt sind. Im Vergleich zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland stößt dieses traditionelle Erklärungsmuster aber auf Schwierigkeiten. Zwar ist in der Bundesrepublik der durchschnittliche Reallohn in dem Zeitraum, in dem sich die Arbeitslosigkeit deutlich erhöht hat, gestiegen, während in den Vereinigten Staaten, sieht man von der jüngsten Entwicklung einmal ab, eine Reduktion zu verzeichnen war. Die Ökonomen sind sich aber darin einig, dass man nicht allein auf die Reallohnentwicklung schauen darf. Entscheidend ist vielmehr zunächst das Verhältnis von Nominallohn- und Produktivitätsentwicklung, d.h. die Entwicklung der sogenannten Lohnstückkosten und dann die Entwicklung der Lohnstückkosten im Verhältnis zur Veränderung des Preisniveaus. In der jeweiligen Währung ausgedrückt, sind die Lohnstückkosten in den USA stärker als in der Bundesrepublik gestiegen, wofür vorrangig die geringen Produktivitätserhöhungen in den USA verantwortlich sind. In einer gemeinsamen Währung ausgedrückt, kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, welche Periode man zugrunde legt. Dies hat seine Ursache natürlich in den starken Schwankungen des DM-Dollar-Kurses, zu denen es seit den 70er-Jahren gekommen ist. Sieht man die in der nationalen Währung gemessenen Entwicklungen als entscheidend an, wird man jedenfalls um die Feststellung nicht herum kommen, dass die jeweils durchschnittliche Entwicklung der Lohnstückkosten nicht in der Lage ist, die unterschiedliche Beschäftigungsentwicklung zu erklären.
Für die Beurteilung der Verteilungsentwicklung muss man neben den Lohnstückkosten auch der Preisentwicklung Aufmerksamkeit schenken. Das Urteil wird dadurch nicht revidiert. Zwar ist das Preisniveau in den USA etwas stärker als in der Bundesrepublik
[Seite der Druckausg.: 54 ]
gestiegen; die aus Lohnstückkosten- und Preisniveauveränderung resultierende Veränderung der Lohnquote zeigt aber, dass der rasche Anstieg der Beschäftigung in den USA seine Ursache jedenfalls nicht in einem besonders ausgeprägten Rückgang der Lohnquote haben kann: Seit Beginn der achtziger Jahre weist die Lohnquote in der Bundesrepublik einen eindeutig rückläufigen Trend auf, während ein solcher Trend für die USA nicht festzustellen ist.
Die gängige Vermutung über den Zusammenhang von Lohnquoten- und Beschäftigungsentwicklung nicht bestätigenden Verhältnisse in Deutschland und den USA haben wahrscheinlich dazu geführt, dass das Lohnniveau und dessen Entwicklung kaum einmal als entscheidend für die Fähigkeit der amerikanischen Wirtschaft angeführt werden, in großem Umfang neue Arbeitsplätze zu schaffen. Als eine Ursache oder doch zumindest als eine wesentliche Voraussetzung dafür wird aber immer wieder auf die Verschiedenheit in der Lohnstruktur hingewiesen. Das Argument lautet, dass eine Wirtschaft, die - wie die US-amerikanische - nicht einer auf Nivellierung hin angelegten Tarifpolitik unterworfen ist, gerade im Bereich der weniger qualifizierten Arbeitskräfte sehr viel eher in der Lage ist, für Beschäftigung zu sorgen. Unübersehbar ist es die Grenzproduktivitätstheorie, die hinter dieser Argumentation steht: Wer nur ein geringes Grenzprodukt erzeugt, kann auf Einstellung nur hoffen, wenn sein Lohn diesem niedrigen Grenzprodukt entspricht. Nivellierung der Lohnstruktur bedeutet demgegenüber, dass den weniger qualifizierten und weniger leistungsfähigen Arbeitskräften ein Lohn zugestanden wird, der ihrem Grenzprodukt nicht entspricht. Die Folge ist, dieser Sicht zufolge, dass ihnen zu dem tariflich vereinbarten Lohn kein Arbeitsplatz offeriert wird.
Sehen wir uns zunächst die Fakten an. Um die Differenzierung oder Nivellierung der Löhne auszudrücken, werden in der Literatur recht verschiedenartige Indikatoren verwendet und es wird auf unterschiedliches Material zurückgegriffen, das zudem nicht immer in den betrachteten Ländern nach einheitlichen Kriterien erhoben wird. Insofern kann nicht verwundern, dass man mit verschiedenen Ergebnissen konfrontiert wird. Ohne in die Details zu gehen, soll im folgenden kurz auf zwei repräsentative Untersuchungen eingegangen werden.
[Seite der Druckausg.: 55 ]
Die erste stammt von der OECD [Fn.47: Siehe OECD, Employment Outlook, Paris 1996 ] und hat zum Ziel, Ausmaß und Entwicklung der "earnings inequality", d.h. der Ungleichverteilung des Einkommens aus abhängiger Beschäftigung [Fn.48: Wir sprechen der Einfachheit halber von "Lohnspreizung". Zu berücksichtigen ist, dass damit auch Gehälter gemeint sind und dass "gross cash earnings„ zu Grunde liegen. Zu näheren Angaben siehe OECD, a.a.O.] zu ermitteln. Einem verbreiteten Verfahren folgend, werden für die Einkommensbezieher sogenannte Dezile gebildet, d.h. sie werden nach ansteigendem Einkommen angeordnet und man stellt z.B. fest, welches Einkommen das erste Dezil abschließt, d.h. wie viel jemand maximal verdient, der den unteren zehn Prozent der erfassten Einkommensbezieher angehört. Dieses Einkommen sei mit D1 bezeichnet. Entsprechend bezeichnet z.B. D5 das höchste Einkommen im fünften Dezil. Da fünfzig Prozent aller Einkommensbezieher mit ihrem Einkommen unter dem Einkommen D5 und fünfzig Prozent darüber liegen, ist D5 das sogenannte Medianeinkommen [Fn. 49: Da die Einkommensverteilung nicht symmetrisch sondern üblicherweise linkssteil (bzw. rechts-schief) ist, fallen Median und arithmetisches Mittel nicht zusammen, vielmehr liegt der Median unter dem arithmetischen Mittel. In der Regel wird man den Median hier als die aussagekräftigere Größe ansehen können.] . Schließlich wird häufig auch mit D9 gearbeitet. Bezeichnet wird damit das Einkommen, das nur noch von zehn Prozent der erfassten Einkommensbezieher übertroffen wird.
Um das Ausmaß der Ungleichheit auszudrücken, bzw. die Entwicklung der Ungleichheit, wird nun häufig D9 mit D5 verglichen (kurz: D9/D5) oder D5 mit D1 (D5/D1) [Fn. 50: Selbstverständlich gibt es auch andere Indikatoren der Ungleichheit, wie z.B. den Gini-Koeffizienten. Wir verzichten darauf, andere als die im Text genannten Indikatoren aufzuführen.] . In der folgenden Tabelle sind die von der OECD für Deutschland und die USA ausgewiesenen Ergebnisse aufgeführt [ Fn: 51Die Tabelle, der diese Angaben entnommen sind (Table 3.1)., S. 61f.), enthält - allerdings für unterschiedlich lange Zeiträume - Angaben für 19 Länder.]
Tabelle 3.3: Entwicklung der Lohnspreizung in Deutschland und den USA
[Seite der Druckausg.: 57 ]
Die Tabelle bestätigt zum einen, dass die Lohnspreizung in den USA größer ist. Zum anderen kommt auch eine unterschiedliche Entwicklung zu Ausdruck: In den USA ist im Betrachtungszeitraum für Männer und Frauen sowohl D9/D5 als auch D5/D1 gestiegen - nach beiden Maßen hat somit die Differenzierung zugenommen. Für Deutschland ist das Bild weniger einheitlich. D9/D5 hat sich für Männer und Frauen nur wenig verändert, für D5/D1 zeigt sich dagegen eine nivellierende Tendenz - wesentlich stärker allerdings bei den Frauen. In dem dokumentierten Zeitraum (der leider nur 1983-1993 umfasst) ist es demnach nicht, wie in den USA, zu einer stärkeren Differenzierung der Löhne gekommen. Allerdings auch nicht zu einer Tendenz, die eindeutig in die andere Richtung ging. Die nivellierende Entwicklung ist auf den unteren Bereich beschränkt und fand vor allem bei den erwerbstätigen Frauen statt.
Auf einen weiteren Sachverhalt weist die folgende Graphik hin: Die Differenzierung in den Vereinigten Staaten hat nicht nur zugenommen, vielmehr ist es zu sinkenden Reallöhnen für die unteren und - den hier wiedergegebenen Berechnungen zufolge - bei den Männern sogar der mittleren Einkommensbezieher gekommen. In Deutschland weisen alle erfassten Dezile dagegen Reallohnzuwächse aus - am stärksten bei den Frauen des untersten Dezils.
Bevor wir daraus Schlüsse ziehen, soll die Lohndifferenzierung noch unter einem etwas anderen Blickwinkel betrachtet werden. In der bisherigen Darstellung wurden die aus unselbständiger Arbeit entstehenden Einkommen einfach nach ihrer Größe - von unten nach oben - erfasst. Einkommensbezieher sind demnach nur durch ein einziges Merkmal gekennzeichnet, eben der Höhe ihres Einkommens. Ein anderes Verfahren besteht darin, vorab eine Zuordnung der erfassten Personen zu einer Kategorie vorzunehmen, die nicht das Einkommen betrifft und dann für die unterschiedlichen Personengruppen die Einkommensabstände und ihre Entwicklungstendenz zu erfassen.
[Seite der Druckausg.: 58 ]
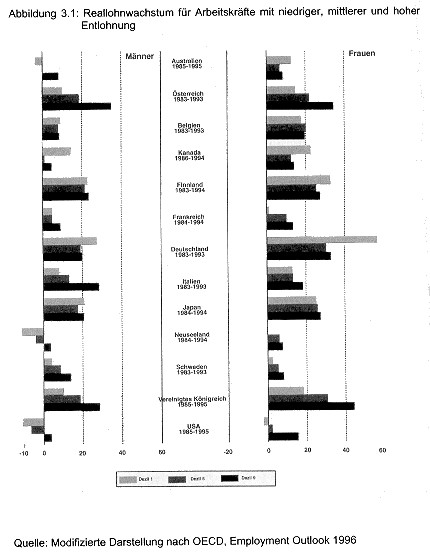
Von besonderem Interesse sind hier Zuordnungen entsprechend der jeweiligen Qualifikation der betrachteten Personen. Die einfachste - wenngleich keineswegs harmlose - Vorgehensweise besteht darin, nur zwischen "qualifiziert" und "unqualifiziert" zu unterscheiden und die Personen der einen oder der anderen
[Seite der Druckausg.: 59 ]
Kategorie zuzuordnen. [Fn.: 52: „Unqualifiziert" bedeutet also nicht, dass die solchermaßen Eingestuften über keinerlei Qualifikationen verfügen. Sie haben vielmehr einen Abschluss unterhalb desjenigen, der die beiden Gruppen voneinander abgrenzt.] Bei Versuchen dieser Art sind es in der Regel Bildungsabschlüsse, die das Zuordnungskriterium abgeben. Man muss kaum darauf hinweisen, dass es sich dabei um einen nicht unproblematischen Qualifikationsindikator handelt. Darüber hinaus wird man wohl nicht besonders betonen müssen, dass es angesichts der großen Unterschiede in den Ausbildungssystemen der verschiedenen Länder kaum möglich ist, einigermaßen verlässlich und vergleichbar die Trennungslinie zwischen "qualifiziert" und "unqualifiziert" zu ziehen.
Dennoch werden solche Versuche vorgenommen. Sie nehmen - oft uneingestanden von denen, die sie vorlegen - in Kauf, dass die Trennungslinie für die verschiedenen Länder nicht direkt vergleichbar ist. Dennoch gehen die Lieferanten solcher Daten davon aus, dass zumindest die Tendenzen richtig beschrieben werden.
Was die Entwicklung des Anteils der "Qualifizierten" anbelangt, wird man dem wohl zustimmen können. Obwohl es sicher kein streng einheitliches Kriterium gibt, für die verschiedenen Länder zwischen "Qualifizierten" und "Unqualifizierten" zu unterscheiden, ist der Trend in den entwickelten Industrieländern ganz unstrittig: Wir haben es mit einem eindeutig ansteigenden Anteil der Qualifizierten zu tun. [Fn. 53: Siehe z.B. Manacorda, M. und Petrongolo, B., Skill Mismatch and Unemployment in OECD Countries, Economica 66 (1999), S. 186 ]
Während dieser Trend sich nicht groß von der jeweiligen Scheidelinie stören lässt, mit der man "Qualifizierte" von "Unqualifizierten" trennt, ist das Verhältnis "Lohn der Qualifizierten zu Lohn der Unqualifizierten" davon natürlich schon stärker abhängig - und darüber hinaus von einer ganzen Reihe anderer Annahmen. Da es unter den "Unqualifizierten" z.B. nur einen geringeren Anteil von Vollzeitarbeitskräften gibt, ist der Lohnabstand zwischen "Qualifizierten" und "Unqualifizierten" geringer, wenn man nur auf Vollzeitarbeitskräfte abstellt gegenüber einem Vergleich, in den alle Arbeitskräfte einbezogen werden.
Ohne die jeweils zu Grunde liegenden Daten genauer zu erläutern [Fn. 54: Wir verweisen dazu auf die angeführte Quelle.] , soll in der folgenden Graphik für einige Länder die Entwicklung des Verhältnisses "Qualifiziertenlohn/Unqualifiziertenlohn" wiedergegeben werden. Tendenziell
[Seite der Druckausg.: 60 ]
entspricht das Ergebnis demjenigen, das wir bei der etwas anders angelegten vorangegangenen Betrachtung erhalten hatten: In (West-)Deutschland ist es in den achtziger Jahren zu einer leichten Nivellierung gekommen. In den USA ist es dagegen auch unter dem hier zu Grunde liegenden Kriterium ("Qualifiziert/Unqualifiziert") zu einem signifikanten Anstieg in diesem Zeitraum gekommen, wobei die Tendenz der fünfziger und sechziger Jahre vollständig umgekehrt wurde.
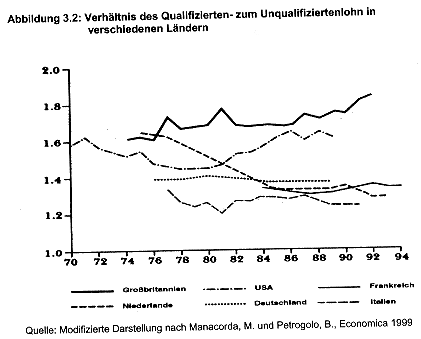
Obwohl die vergleichende Beurteilung der Lohndifferenzierung in den USA und in der Bundesrepublik gewiss eine gründlichere und weitergehende Behandlung erfordern würde, wollen wir zunächst einmal festhalten, dass das besichtigte Material die gängige Einschätzung bestätigt hat: eine auch schon in der Vergangenheit stärkere Differenzierung in den USA hat sich dort weiter verstärkt, während man für die Bundesrepublik eher eine leichte Nivellierungstendenz feststellen kann - mit der Einschränkung, dass dafür vor allem die Entwicklung bei den Frauen verantwortlich ist und dass das Material die jüngste Entwicklung nicht erfasst.
[Seite der Druckausg.: 61 ]
Diese Befunde beziehen sich auf die Entwicklung der Lohnspreizung und lassen zunächst keinerlei weitergehende Schlussfolgerungen zu. Insbesondere ist zunächst vollkommen offen, ob die unterschiedlichen Entwicklungen in der Bundesrepublik und den USA bezüglich der Lohndifferenzierung irgend etwas mit der Verschiedenheit in der Entwicklung der Arbeitslosenquoten in diesen Ländern zu tun hat.
Dass hier ein Zusammenhang besteht, gehört nun aber zur festen Überzeugung vieler Analytiker. Dabei gibt es aber einen wesentlichen Unterschied in der Sichtweise. Der einen Richtung zufolge besteht ein kausaler Zusammenhang in der Weise, dass eine nivellierte Lohnstruktur Arbeitslosigkeit, insbesondere im Bereich der weniger qualifizierten Arbeit hervorruft, und dass umgekehrt eine größere Lohnspreizung einen günstigen Effekt auf die Beschäftigung hat. Die Argumente des Sachverständigenrats in mehreren seiner Gutachten gehen in diese Richtung. Daneben gibt es eine zweite Auffassung, der es nicht darum geht, ein solches Kausalverhältnis zu begründen, die vielmehr betont, dass es sich bei der steigenden Arbeitslosigkeit in Europa und der zunehmenden Ungleichheit in den USA um die zwei Seiten der gleichen Münze handelt [Fn. 55: Siehe Krugman, P., Past and Prospective Causes of High Unemployment, Federal Reserve Bank of Kansas City, Reducing Unemployment: Current Issues and Policy Options, Jackson Hole 1994, S. 25-27] . Dem Argument zufolge sind Europa und die USA der gleichen Tendenz ausgesetzt, nämlich einer Tendenz, die auf eine größere Lohndispersion hin wirkt. Die Auswirkungen sind nach dieser Argumentation deshalb verschieden, weil unterschiedliche institutionelle Gegebenheiten vorliegen. An den regulierteren europäischen Arbeitsmärkten, also auch in Deutschland, verhindern entsprechende Institutionen (z.B. der Flächentarifvertrag), dass ein Auseinanderdriften der Löhne eintritt, wie wir es in den USA beobachten. Da damit die auf Differenzierung hin wirkende Tendenz nicht beseitigt ist, tritt sie aber nur in einer anderen Erscheinungsform auf, nämlich in erhöhter Arbeitslosigkeit bei den gering Qualifizierten, bzw. bei denjenigen, die als Beschäftigte im unteren Bereich der Lohnskala nur Beschäftigung fänden.
Lassen wir für einen Augenblick dahingestellt, ob Evidenzen für eine der beiden Versionen vorliegen und sehen uns zunächst an, wie es um den Zusammenhang bestellt ist. Das folgende Bild [Fn. 56: Wir übernehmen es von Mortensen, D.T. and Pissarides, C.A., Job Reallocation, Employment Fluctuations and Unemployment, in: Taylor, J.B. and Woodford, M. (Eds.), Handbook of Macroeconomics, Vol. 1B, Amsterdam 1999, S. 1171-1228] liefert jedenfalls eine gewisse Unterstützung für diese
[Seite der Druckausg.: 62 ]
Sicht: für den betrachteten Zeitraum (späte siebziger bis späte achtziger Jahre) weisen diejenigen Länder, in denen die Ungleichheit besonders stark zunahm, einen weniger starken Anstieg der Arbeitslosenquote auf. Im Fall der USA ist die Arbeitslosenquote sogar zurückgegangen. Es fällt auf, dass Großbritannien deutlich aus der Reihe tanzt: Im betrachteten Zeitraum ist es gleichzeitig zu einem Anstieg der Ungleichheit und zu einer deutlichen Erhöhung der Arbeitslosigkeit gekommen. In den letzten Jahren hat sich dort die Arbeitslosigkeit jedoch deutlich zurückentwickelt, so dass Großbritannien inzwischen neben den Niederlanden und Dänemark zu den immer wieder genannten positiven Beispielen in Sachen Beschäftigungsentwicklung gehört. Man könnte insofern argumentieren, dass auch Großbritannien - wenngleich in diesem Fall mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung - den inversen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Ungleichheit und dem Anstieg der Arbeitslosenquote bestätigt.
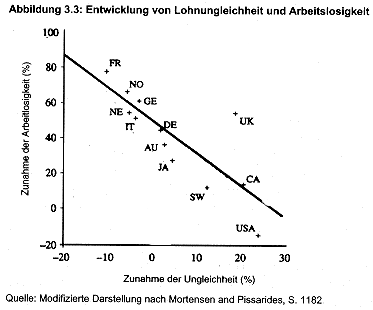
Wenden wir uns nun aber kurz den beiden Begründungen für den Zusammenhang selbst zu. Der ersten zufolge besteht eine direkte kausale Abhängigkeit dergestalt, dass mit einer Zunahme der Lohnspreizung - so nennt dies der Sachverständigenrat - auch eine Erhöhung der Beschäftigung einher geht. Bei den geforderten größeren
[Seite der Druckausg.: 63 ]
Lohnunterschieden wird sowohl an betriebliche, branchenmäßige, regionale wie qualifikationsbedingte gedacht. Die Begründung dafür, dass eine größere Differenzierung zwischen Betrieben, Branchen und Regionen sich günstig auf die Beschäftigung auswirkt, besteht vor allem darin, dass auf diese Weise Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten werden können, die bei Lohnerhöhungen ohne Berücksichtigung der jeweiligen besonderen Verhältnisse wegfallen würden. Ein einheitlicher Lohnanstieg für alle, so das Argument, ist für die einen gut verkraftbar, für andere dagegen bedeutet er das Aus. Wer dieses Aus vermeiden und damit Arbeitsplätze erhalten will, muss einem differenzierten, der jeweiligen ökonomischen Situation entsprechenden Anstieg zustimmen. Oder eben auch mehr als das: einer Lohnkürzung, bzw. besonderen Zugeständnissen, wie etwa der Zustimmung zu Mehrarbeit (Holzmann lässt grüßen).
Bei der Hoffnung, durch größere Lohndifferenzierung zwischen unterschiedlichen Qualifikationsgruppen einen positiven Beschäftigungseffekt zu erzielen, spielt vor allem die Erwartung eine Rolle, damit neue - oder vielleicht auch alte und im Zuge der Entwicklung verloren gegangene - Felder der Beschäftigung (wieder) zu gewinnen. Dabei geht es insbesondere um den Dienstleistungssektor und hier wiederum um dessen weniger qualifiziertes Segment. Größere Lohndifferenziale, so die Erwartung, werden dazu führen, dass die Gutverdienenden stärker als das bei einer eher nivellierten Einkommensstruktur der Fall ist, die Arbeitsleistungen der geringer Qualifizierten - und bei stärkerer Differenzierung eben auch ihnen gegenüber deutlich geringer zu Bezahlenden - in Anspruch nehmen. Dazu kommt, dass größere Lohnabstände in den Betrieben den Rationalisierungsdruck, der sich - zumindest nach den in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen - vor allem gegen die Beschäftigten mit geringen Qualifikationen richtet, abmildern könnte. Wer wenig verdient, ist weniger im Visier der Rationalisierer.
Empirische Unterstützung würde diese Sicht der Dinge vor allem dadurch gewinnen, dass in Ländern mit stark differenzierten Löhnen die Unterschiede in den Arbeitslosenquoten zwischen Qualifizierten und Unqualifizierten zumindest deutlich geringer ausfallen, wenn nicht sogar verschwinden. Das ist nicht der Fall. Wie das folgende, von Manacorda und Petrongolo übernommene Bild belegt, liegen die Arbeitslosenquoten der Unqualifizierten in der Regel deutlich über denen der
[Seite der Druckausg.: 64 ]
Qualifizierten, wobei ein Zusammenhang mit starker Nivellierung oder Differenzierung der Löhne nicht erkennbar ist. Tatsächlich weisen die Graphiken zwei Ausnahmen von der Regel auf, wonach die gering Qualifizierten die höheren Arbeitslosenquoten aufweisen. Die Ausnahmen sind Schweden und Italien und damit zwei Länder, die nicht gerade in dem Ruf stehen, besonders stark differenzierte Löhne aufzuweisen. Wie man sieht, ist in Schweden der Abstand recht gering und in Italien drehen sich die Verhältnisse sogar um. Letzteres erklärt sich vermutlich aus der Altersstruktur der Arbeitslosigkeit. In Italien war im Betrachtungszeitraum die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch und darunter sind Jugendliche mit Schulabschlüssen, die dazu führen, dass sie als "qualifiziert" eingestuft werden, sehr stark vertreten.
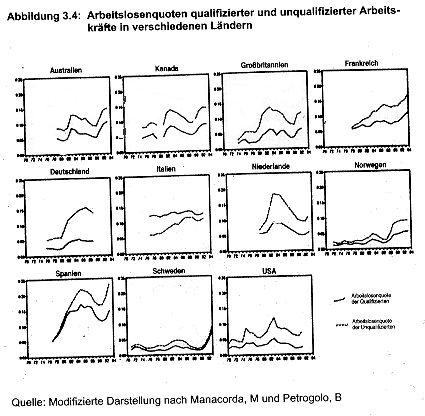
[Seite der Druckausg.: 65 ]
Immerhin deutet die Grafik darauf hin, dass sich in Deutschland im Betrachtungszeitraum die Abstände der Arbeitslosenquoten deutlich vergrößert haben, während sich eine ähnliche Tendenz in den USA nicht vollzogen hat. Mit Blick auf die Entwicklung in Deutschland könnte man also an der Hypothese festhalten, dass Nivellierung (bzw. unzureichende Differenzierung) der Löhne die Arbeitslosigkeit bei denjenigen verschärft, denen man ja eigentlich Gutes tun will. Umgekehrt stützt dann allerdings die Entwicklung in den USA die These nicht, dass die Zunahme der Ungleichheit Arbeitslosigkeit im Bereich der gering Qualifizierten reduziert. Man wird also festhalten müssen, dass das empirische Material jedenfalls keine eindeutige Unterstützung für die These liefert, der zufolge man es mit einem "trade-off" zwischen Arbeitslosigkeit und Gleichheit zu tun habe.
Über die andere Variante ist damit auch bereits das meiste gesagt. Ihr zufolge wirkt (Un-) Gleichheit der Löhne nicht direkt auf die Arbeitslosigkeit, vielmehr sind Zunahme der Arbeitslosigkeit oder Zunahme der Ungleichheit zwei unterschiedliche Formen, mit denen auf die gleiche Tendenz reagiert wird. Welche Tendenz das ist, wird kontrovers beurteilt. Insbesondere zwei Behauptungen stehen einander gegenüber. Der ersten zufolge hat die Globalisierung dazu geführt, dass in hochindustrialisierten Ländern es die wenig qualifizierten Arbeitskräfte sind, die einem verstärkten Wettbewerb durch die (ihnen im Qualifikationsniveau entsprechenden) Arbeitskräfte der Schwellen- und der Entwicklungsländer ausgesetzt sind. Die Folge ist in den Industrieländern entweder ein relatives - und vielleicht auch absolutes - Zurückbleiben der Löhne solcher Arbeitskräfte hinter denen der Qualifizierteren oder eine zunehmende Arbeitslosigkeit in diesem Segment. Konkurrierend mit dieser These behauptet eine zweite, dass die entscheidende Tendenz durch den technischen Fortschritt bestimmt wird. Er weise einen "Bias", also eine Verzerrung, in dem Sinne auf, dass die technische Entwicklung den Einsatz qualifizierter Arbeitskräfte begünstige und umgekehrt den Einsatz unqualifizierter Arbeitskräfte immer weiter zurück dränge. Da sich die Arbeitsnachfrage dadurch immer stärker auf die Qualifizierten und immer weniger auf die Unqualifizierten richte, müsse sich daraus in eher unregulierten Märkten eine zunehmende Differenz in den Lohnniveaus ergeben. Wo dieser Differenzierung Beschränkungen gesetzt sind, wird sich die Tendenz des technischen Fortschritts in einer anderen Erscheinungsformen zeigen, nämlich in höherer und ansteigender
[Seite der Druckausg.: 66 ]
Arbeitslosigkeit der von der Arbeitsnachfrage relativ Vernachlässigten, eben der weniger Qualifizierten.
Einiges spricht dafür, dass dem technischen Wandel bei dieser Tendenz eine entschieden stärkere Bedeutung zukommt als der Globalisierung. Dabei sollte man sich allerdings klar machen, dass einer Gesellschaft nicht nur die Wahl zwischen stärkerer Lohndifferenzierung und Anstieg der Arbeitslosigkeit im Bereich der gering Qualifizierten offen steht. Zum einen haben wir bereits gesehen, dass auch dort, wo es zu stärkeren Lohndifferenzierungen gekommen ist, sich das Problem der überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit für die gering Qualifizierten keineswegs erledigt hat. Zum anderen muss man darauf hinweisen, dass der technische Wandel zwar Einfluss auf Höhe und Struktur der Arbeitsnachfrage hat, dass es aber natürlich nicht die Arbeitsnachfrage allein ist, die über Lohnstruktur und/oder gruppenspezifische Arbeitslosenquoten entscheidet. Selbstverständlich wirken Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot darauf ein. Ein Land, dem es gelänge, sich mit seinem Arbeitsangebot rechtzeitig an eine veränderte Arbeitsnachfrage anzupassen, könnte damit vermeiden, dass ein "einfacharbeitsparender„ technischer Fortschritt sich in stärker differenzierten Löhnen oder in höherer Arbeitslosigkeit für die gering Qualifizierten niederschlägt.
Schließlich muss auch noch auf folgendes hingewiesen werden. Wer empfiehlt, die Löhne in der Bundesrepublik nach dem Vorbild der USA stärker zu differenzieren, um damit mehr Beschäftigung (vor allem bei den gering Qualifizierten) zu erreichen, übersieht eine Besonderheit der in Deutschland vorliegenden Struktur der Arbeitslosigkeit. Zwar gilt auch hier, dass Arbeitslose ohne Ausbildung eine höhere Arbeitslosenquote (und eine höhere Verweildauer in Arbeitslosigkeit) aufweisen. Die Unterschiede zwischen Qualifizierten und Nicht-Qualifizierten sind aber geringer als die zwischen Jüngeren und Älteren. Betrachtet man etwa die Abgänge aus Arbeitslosigkeit in Arbeit, so stellt man fest, dass sowohl für Qualifizierte und Unqualifizierte ganz erhebliche Unterschiede zwischen Personen unter und über 55 Jahren bestehen. Man kann Karr deshalb nur zustimmen, wenn er feststellt: "Die Verhärtung der Arbeitslosigkeit resultiert also weniger aus der geringen Qualifikation als vielmehr aus dem hohen Alter vieler Arbeitsloser". [Fn. 57: Karr, W., Kann der harte Kern der Arbeitslosigkeit durch einen Niedriglohnsektor aufgelöst werden?, IAB Kurzbericht, Nr. 3,1999, S.7]
[Seite der Druckausg.: 67 ]
Auch wenn man natürlich nicht übersehen kann, dass die hohe Repräsentanz Älterer unter den Arbeitslosen etwas mit den in Deutschland vorliegenden institutionellen Verhältnissen zu tun hat (vor allem mit den Voraussetzungen für vorzeitigen Bezug von Ruhegeld), wird man dennoch feststellen können, dass eine eher durch Alter bedingte Arbeitslosigkeit anders zu beurteilen ist als eine, die primär auf Qualifikationsmängel zurückzuführen ist. Wer vom beschäftigungserhöhenden Effekt einer stärkeren Lohndifferenzierung überzeugt ist, müsste z.B. konsequenterweise die zunehmende Differenzierung zwischen Jüngeren und Älteren (mit deutlichen Abschlägen für die Älteren) fordern und nicht so sehr zwischen Qualifizierten und Unqualifizierten. Das hätte aber wiederum erhebliche Folgen für das System der Alterssicherung und ließe sich deshalb nicht installieren, ohne dass gleichzeitig Änderungen in anderen Bereichen vorgenommen würden.
3.3.4 Soziale Sicherung und Fehlanreize
In den Vergleichen zwischen den USA und europäischen Wirtschaften kommt die Rede immer wieder auf das System der sozialen Sicherung. Allzu großzügige Sozialleistungen in den europäischen Ländern, so eine immer wieder zu hörende Ansicht, hätten zur Folge, dass die Anreize (bzw. die Zwänge), einer Erwerbsarbeit nachzugehen, deutlich weniger ausgeprägt als in den USA seien, die nur ein vergleichsweise gering entwickeltes soziales Sicherungssystem haben. Aber nicht nur die Auswirkungen auf das Arbeitsangebot werden als problematisch angesehen. Als beschäftigungshinderlich erscheint auch die Finanzierung dieser sozialen Leistungen, insbesondere, wenn man es mit einem System wie in Deutschland zu tun hat, das die Löhne zur Bemessungsgrundlage der Sozialbeiträge macht, dadurch zu hohen Lohnnebenkosten führt und einen immer größeren Keil zwischen Arbeitskosten und Nettolohn treibt.
Gehen wir zunächst kurz auf die Finanzierungsseite ein. Selbstverständlich gibt es auch in den USA Lohnnebenkosten. Sie spielen aber eine entschieden geringere Rolle als in der Bundesrepublik und sie sind anders strukturiert. In einer auf Mikrodaten beruhenden Untersuchung stellt z.B. Pierce fest, dass 1997 die
[Seite der Druckausg.: 68 ]
durchschnittlichen "nonwage compensation costs" pro Stunde $ 5,26 betrugen. Davon waren aber nur $ 1,64 gesetzlich erforderlich. [Fn. 58: Pierce, B., Compensation Inequality, BLS Working Papers, Working Paper 323, U.S. Department of Labor 1999]
In Deutschland sind nicht nur die Lohnnebenkosten absolut und relativ wesentlich höher als in den USA, viel stärker ist auch das Gewicht der gesetzlich vorgeschriebenen Lohnnebenkosten. Renten-, Arbeitslosigkeits- und Krankenversicherung werden je zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber abgeführt, darüber hinaus hat der Arbeitgeber weitere Versicherungen abzuschließen. Die Kosten einer Arbeitsstunde sind damit natürlich erheblich höher als der Bruttostundenlohnsatz und erst recht als der Nettostundenlohnsatz (das, was der Arbeitnehmer erhält, wenn er seinen verschiedenen Abgabepflichten - an die sozialen Sicherungssysteme wie an den Fiskus - nachgekommen ist).
Die Probleme, die sich aus der für Deutschland typischen Finanzierung des sozialen Sicherungssystems ergeben, sind seit längerem bekannt und Gegenstand einer schon langanhaltenden Diskussion. Zum einen ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass ein großer Abstand zwischen dem Nettolohn für eine Arbeitstunde und den gesamten Kosten einer Arbeitsstunde geradezu zwangsläufig zum Aufblühen einer Schattenwirtschaft führen muss. Da Schwarzarbeit ohne Abführung von Sozialabgaben und Steuern erfolgt, ergeben sich zumindest für einige Bereiche der Ökonomie beträchtliche Abstände in den Stundensätzen, zu denen man offizielle oder inoffizielle Arbeit anheuern kann.
Wer die hohen Lohnnebenkosten mit diesem Argument attackiert, sollte sich allerdings darüber im klaren sein, dass Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit sich nicht zuallererst aus dem deutschen System der lohnbezogenen Sozialabgaben ergeben. Da Schwarzarbeiter Sozialabgaben und Steuern vermeiden wollen, würde man die Schattenwirtschaft vermutlich kaum dadurch eindämmen, dass man die Sozialabgaben reduziert und die Einkommensteuer erhöht. Zumindest unter diesem Aspekt erscheint es sinnvoller, die Gegenfinanzierung einer Reduktion der Sozialabgaben durch die Erhöhung einer indirekten Steuer vorzunehmen.
[Seite der Druckausg.: 69 ]
Es ist aber nicht nur die (ungewollte) Förderung der Schwarzarbeit, die gegen das lohnbezogene System der Sozialabgaben spricht. Da durch die Lohnnebenkosten die Arbeitsstunde für die Unternehmen wesentlich teurer ist als das im Bruttolohnsatz zum Ausdruck kommt, werden für sie Anreize gesetzt, Arbeit durch Kapital zu substituieren. Da Sozialabgaben nur bei Einsatz von Arbeit anfallen, nicht aber für Kapitaleinsatz, ist die Belastung mit Sozialabgaben für sehr kapitalintensiv produzierende Firmen niedrig, für arbeitsintensive dagegen hoch. Das wäre anders, wenn die Wertschöpfung und nicht die Löhne die Bemessungsgrundlage bilden würden. Deshalb ist immer wieder darüber diskutiert worden, ob eine Wertschöpfungsabgabe, d.h. die Orientierung der Sozialabgaben an der Wertschöpfung, nicht die überlegene Alternative wäre.
In der Bundesrepublik Deutschland ist bekanntlich von der derzeitigen Regierungskoalition ein anderer Weg beschritten worden, um einen weiteren Anstieg der Lohnnebenkosten zu verhindern, bzw. deren Anteil zurückzuführen. Um die Beiträge zur Rentenversicherung nicht weiter steigen zu lassen, ist eine schrittweise Erhöhung der Mineralölsteuer beschlossen worden, um aus den Mehreinnahmen das Alterssicherungssystem finanziell zu unterstützen. Durch Entlastung des Faktors Arbeit und Belastung des Faktors Energie erhofft man sich eine beschäftigungsstimulierende Wirkung und gleichzeitig ökologisch gewollte Verhaltensänderungen bei Unternehmen und privaten Haushalten im Umgang mit Energie [Fn. 59: Dabei wird nicht Immer klar gesehen, dass die Beitragssätze zur Sozialversicherung nur bei einem hohen zusätzlichen fiskalischen Ertrag aus der Mineralölsteuer gesenkt werden können, wohingegen das ökologische Ziel erfordert, dass der Energieverbrauch sehr elastisch auf Preiserhöhungen reagiert, wobei dann aber der fiskalische Ertrag gering wäre.] .
Die Beschäftigungseffekte, die sich aus einer Begrenzung der Sozialabgaben und ihrer Gegenfinanzierung durch Erhöhung der Mineralölsteuer ergeben, darf man sich allerdings nicht allzu hoch vorstellen. Das jedenfalls ist das Ergebnis von Simulationsrechnungen, die dazu von verschiedener Stelle durchgeführt wurden. [Fn. 60: Siehe z.B. Klauder, W., Schnur, P. und Zika. G., Wege zu mehr Beschäftigung, Simulationsrechnungen bis zum Jahre 2005 am Beispiel Westdeutschlands, IAB Werkstattbericht, Nr. 5 (1996)] Für diejenigen, die im Sozialstaat selbst die Wurzel des Übels sehen, ist dies Bestätigung dafür, dass sich nur durch ein entschlossenes Zurückstutzen des
[Seite der Druckausg.: 70 ]
sozialen Sicherungssystems wieder eine stärkere Beschäftigungsdynamik gewinnen lässt. Als Beleg wird wieder einmal auf die USA verwiesen.
Doch wenden wir uns von der Finanzierungsseite ab und der Arbeitsangebotsseite zu. Der deutschen Arbeitslosenversicherung, der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe wird der Vorwurf gemacht, dass von ihnen keine ausreichenden Anreize zur Arbeitsaufnahme, mitunter sogar ausgesprochene Fehlanreize ausgehen. In den USA herrsche dagegen ein System, das mit Zuckerbrot und Peitsche die Arbeitsaufnahme fördert. Wem es mit der Aussage ernst sei, dass man besser Arbeit finanziell fördert als Arbeitslosigkeit finanziert, fände dort wesentlich geeignetere Instrumente als in Deutschland vor. Sehen wir näher zu.
Die Arbeitslosenversicherung ist in Deutschland eine Pflichtversicherung, der die "sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer" unterliegen. Wie bei der Rentenversicherung auch, gibt es einen - je 50prozentigen - Arbeitgeber und Arbeitnehmeranteil. Um bei eingetretener Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld beziehen zu können, muss man sich bei der Arbeitsverwaltung als Arbeitsloser registrieren lassen und es müssen die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sein (mindestens ein Jahr sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit). Zudem muss man der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen - wer eine nachgewiesene zumutbare Arbeit ablehnt, muss mit Sperrfristen rechnen.
Dem Charakter einer Versicherung entsprechend, hat man bei Vorliegen der Voraussetzungen Anspruch auf das Arbeitslosengeld, d.h. es ist unabhängig von der Bedürftigkeit des Beziehers. Darin unterscheidet es sich von Arbeitslosenhilfe und von Sozialhilfe. Wie lange man es höchstens beziehen kann, hängt vom Alter und von der der Arbeitslosigkeit vorausgehenden Dauer der Betriebszugehörigkeit ab. Die Höhe hängt vom zuletzt bezogenen Nettoeinkommen und vom Familienstand ab, wobei Höchstbeträge festgelegt sind. Bestenfalls erhält ein Arbeitsloser 67 Prozent seines früheren Nettoeinkommens, für einen Großteil der Arbeitslosen ist die Lohnersatzleistung deutlich niedriger.
Ist die Periode, für die Anspruch auf Arbeitslosengel besteht, abgelaufen, ohne dass es zu einer Arbeitsaufnahme gekommen ist, kann - mit niedrigeren Sätzen - Arbeitslosenhilfe bezogen werden, die allerdings einer Bedürftigkeitsüberprüfung
[Seite der Druckausg.: 71 ]
unterliegt. Da Arbeitslosenhilfe nur erhält, wer zuvor Arbeitslosengeld bezogen hat, gibt es als weitere wichtige Form der Unterstützung bei Bedürftigkeit schließlich noch die Sozialhilfe.
Bleiben wir zunächst beim Arbeitslosengeld, so ist sicher richtig, dass in den USA die Bezugsdauer erheblich kürzer ist und die Ersatzleistungen niedriger sind. [Fn. 61: In international vergleichenden Darstellungen wird allerdings oft Bezug auf das Arbeitsmarktförderungsgesetz genommen, das inzwischen durch das Sozialgesetzbuch III abgelöst Ist. Die heute geltenden Regelungen sind deutlich restriktiver, was die Höchstbezugsdauer anbetrifft. Außerdem ist die "Zumutbarkeit„ einer nachgewiesenen Arbeit inzwischen erheblich weiter gefasst; insbesondere wird bei längerer Arbeitslosigkeit auch eine erheblich niedriger bezahlte als die zuvor ausgeübte Arbeit zumutbar.] So gesehen ist auch der Druck für Arbeitslose höher, möglichst schnell eine neue Stelle zu finden. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass sich daraus mit Notwendigkeit die längere durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit in Deutschland ergibt. Auch hierzulande gibt es für Arbeitslose genügend Anreize, den Zustand der Arbeitslosigkeit rasch zu beenden: Das gegenüber dem Arbeitsentgelt niedrigere Arbeitslosengeld, die mit der Dauer der Arbeitslosigkeit zunehmenden Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden, der oft als stigmatisierend empfundene Zustand der Arbeitslosigkeit, usw. Dazu kommt, dass die Arbeitsvermittlung durch die Bundesanstalt für Arbeit insgesamt gut funktioniert, so dass die institutionellen Voraussetzungen für die Vermittlung von Arbeitsstellen eher günstiger als in den USA sind. Aber selbstverständlich kann nur vermittelt werden, wenn auch in genügender Zahl offene Stellen zur Verfügung stehen. Hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen den USA und Deutschland, nicht in unterschiedlich hohen Lohnersatzleistungen.
In der ökonomischen Theorie wird häufig auch ein Bezug zwischen der Höhe des Arbeitslosengeldes und der Arbeitslosigkeit hergestellt, der auf folgendem Argument beruht: Angesichts unvollkommener Information über die ihnen offenstehenden Alternativen, werden Arbeitnehmer auf der Suche nach einem besser bezahlten Job ihre bisherige Stelle aufgeben und sich der Erkundung des Arbeitsmarktes zuwenden. Der mögliche Ertrag der Informationsbeschaffung ist eine besser bezahlte Stelle, die Kosten bestehen in der Differenz zwischen dem Lohn, den man bei der aufgegebenen Arbeitstelle erzielt hat und den Lohnersatzleistungen, die man erhält, wenn man sich für die Suche entschieden hat. Ein höheres und dem Lohn nahe
[Seite der Druckausg.: 72 ]
kommendes Arbeitslosengeld verringert die Kosten der Informationsbeschaffung und übt insofern einen Anreiz aus, die Suchperiode auszudehnen.
Solche Job-Search-Theorien [Fn. 62: Siehe z.B. Mortensen, D.T. Job Search and Labor Market Analysis, in: Ashenfelter, O. and Layard, R. (Eds.), Handbook of Labor Economics, Vol. 2, Amsterdam 1986, S. 849-919. Zur Kritik siehe vor allem Rothschild, K.W., Arbeitslose: Gibt's die?, Kyklos 31 (1978), S. 21-35] sind zumindest für Deutschland wenig überzeugend. Da sich Personen, die eine Stelle besetzt haben, wesentlich leichter tun als Arbeitslose, eine andere zu finden, werden sie kaum kündigen, um sich auf Arbeitssuche zu begeben. Erfolgversprechender ist es, sich nach einer neuen und besser bezahlten Stelle von der bisherigen aus umzusehen und erst zu kündigen, wenn sie diese gefunden haben. Auch empirisch ist die Theorie recht fragwürdig. Es ist bekannt, dass es vor allem bei guter Konjunkturlage zu Kündigungen durch Arbeitnehmer kommt, während sie in rezessiven Phasen ihre Stelle erhalten wollen. Um die Arbeitslosigkeit (oder jedenfalls einen größeren Teil davon) zu erklären, müsste sich aber jeweils in Rezessionen eine verstärkte Suchaktivität entwickeln.
Die große Beachtung, die auch in Deutschland der sogenannten Sucharbeitslosigkeit geschenkt wurde, erklärt sich u.E. nicht aus deren empirischer Relevanz. Für Theoretiker war sie deshalb interessant, weil der in der Tat bedeutsame Informationsaspekt damit thematisiert wurde: Anders als in der ökonomischen Theorie oft vorausgesetzt, sind Informationen nicht kostenlos und daraus ergeben sich in der Tat bedeutsame Konsequenzen für die herkömmliche Theorie. Für Ideologen der Marktwirtschaft hatte die Theorie aber ein ganz andere, ihnen sehr nützliche Bedeutung: Indem es möglich schien, die statistisch gemessene Arbeitslosigkeit auf freiwillig eingegangene Suchaktivitäten zurückzuführen, war sie als soziales Problem domestiziert, denn eine freiwillig eingegangene Arbeitslosigkeit stellt ja kein ökonomisches Problem dar.
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe in Deutschland unterliegen ebenfalls der Kritik. Wir wollen uns hier auf die Sozialhilfe konzentrieren, da sich hieran das Problem besonders gut verdeutlichen lässt.
Der Idee und Konstruktion nach soll die Sozialhilfe denjenigen, die über keine (ausreichenden) anderen Einkünfte verfügen, die notwendigen Mittel für ihre Existenz
[Seite der Druckausg.: 73 ]
zur Verfügung stellen. Um die Höhe dieser Mittel zu ermitteln, sind für Sozialempfängerhaushalte die jeweiligen Umstände (etwa Kinderzahl) zu berücksichtigen, d.h. wir haben es hier mit einer am Bedarf orientierten Hilfe zu tun. Gerade daraus kann ein Problem entstehen. Zwar erhalten auch Lohnbezieher zum Teil Einkommen, die am Bedarf orientiert sind (das gilt vor allem für das Kindergeld), aber der Lohn ist im Prinzip ein Leistungseinkommen, das nicht nach dem jeweiligen individuellen Bedarf ermittelt wird. Das aber kann dazu führen, dass in Einzelfällen der eigentlich gewollte Abstand zwischen Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Sozialhilfe nicht gewahrt bleibt, ja sogar Einzelfälle gefunden werden können, in denen eine Umkehr der Verhältnisse in der Weise eintritt, dass sich für den Sozialhilfebezieher Vorteile gegenüber vergleichbaren Lohnbeziehern ergeben. Obgleich es sich dabei um quantitativ unbedeutende Ausnahmefälle handelt, ist nicht verwunderlich, dass ihnen eine erhebliche Publizität zukommt und so mitunter der Eindruck entsteht, dass sich für gering Qualifizierte eine Arbeitsaufnahme eigentlich gar nicht lohnt. Wem solche Fälle vor Augen stehen, der wird in der Regel dafür plädieren, dass ganz konsequent am sogenannten "Lohnabstandsgebot" festgehalten wird und dass Sozialhilfe nur zeitlich beschränkt gewährt wird.
Obwohl die Öffentlichkeit vor allem von den Fällen einer (angeblichen) Besserstellung von Sozialhilfeempfängern aufgewühlt wird, ist für die Beurteilung, ob das deutsche System zu Fehlanreizen führt, ein anderer Sachverhalt vermutlich bedeutsamer. Dabei geht es um die Frage, ob ein Sozialhilfeempfänger einen genügenden Anreiz hat, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. Grundsätzlich gilt nämlich in Deutschland, dass Arbeitseinkommen in voller Höhe auf die Sozialhilfe angerechnet wird. Davon ausgenommen ist nach § 76 Absatz 2a BSHG ein Freibetrag "in angemessener Höhe". Ohne auf die Regelungen im einzelnen einzugehen, muss festgehalten werden, dass die Möglichkeiten eines Sozialhilfeempfängers [Fn. 63: Wir sprechen hier selbstverständlich von einem Sozialhilfeempfänger, der auch nach Aufnahme einer Arbeit weiterhin in gewissem Umfang Sozialhilfe bezieht.] , durch Arbeit sein Einkommen zu steigern, begrenzt und zudem wenig attraktiv sind. So stellt z.B. der Sachverständigenrat fest: "Im Ergebnis kann ein Sozialhilfeempfänger unabhängig von seinem Familienstand sein verfügbares Einkommen durch Arbeit nur um höchstens 265 DM je Monat steigern, wobei dieser Betrag schon bei einem Nettozusatzverdienst von etwa 1 000 DM
[Seite der Druckausg.: 74 ]
erreicht ist". [Fn. 64: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wachstum, Beschäftigung, Währungsunion - Orientierung für die Zukunft, Jahresgutachten 1997/98, Stuttgart 1997, S. 212. ] Dies bedeutet, dass die ökonomischen Anreize für einen Sozialhilfeempfänger, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen, in der Tat sehr gering sind. [Fn. 65: Angesichts des Freibetrags ist der marginale Steuersatz auf das Arbeitseinkommen zwar nicht, wie gelegentlich behauptet wird, 100%, aber sicher zu hoch, um einen ausreichend hohen Anreiz zur Arbeitsaufnahme zu entfalten. ] Man wird also festzuhalten haben, dass unter dem Gesichtspunkt, deutliche Anreize für eine Arbeitsaufnahme zu setzen, das deutsche System der Sozialhilfe erheblich verbesserungsfähig ist. Die dazu vorliegenden Vorschläge müssen hier nicht wiederholt werden. Man wird dem Sachverständigenrat auch zustimmen können, wenn er darüber hinaus feststellt: "Der hohe Anspruchslohn, den die Sozialhilfe bestimmt, erschwert die Lohndifferenzierung". [Fn. 66: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Wirtschaftspolitik unter Reformdruck, Jahresgutachten 1999/2000, Stuttgart 1999, S. 171.] Gemeint ist damit, dass durch die Sozialhilfe festgelegt wird, welcher Lohn mindestens bezahlt werden muss und dass deshalb die Lohndifferenzierung von diesem Niveau, bzw. einem entsprechend darüber liegenden, auszugehen hat. Damit ist gleichzeitig darauf verwiesen, dass die im vorangegangenen Abschnitt und die in diesem besprochenen Fragen natürlich nicht unabhängig voneinander sind. In einer Gesellschaft, die Arbeitslosen und Bedürftigen ein vergleichsweise hohes Versorgungsniveau zuerkennt, sind der Lohndifferenzierung nach unten hin Schranken gesetzt, da es sicher nicht durchhaltbar und auch nicht wünschbar ist, Lohnbezieher schlechter zu stellen als Arbeitslose oder Sozialhilfeempfänger. Die sogenannten "working poor" spielen deshalb auch in Gesellschaften, die die "nicht-arbeitenden Armen" relativ großzügig unterstützen, keine große Rolle.
Aber auch wenn man zuerkennt, dass das deutsche System der Sozialhilfe unter Anreizgesichtspunkten sicherlich wenig beschäftigungsfreundlich ist und insofern erheblich umgestaltet werden sollte, darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass die hier sicherlich vorliegenden Fehlanreize kaum in der Lage sind, die hohe Arbeitslosigkeit zu erklären. Zum einen wird häufig überschätzt, wie viele der Sozialhilfebezieher überhaupt arbeitsfähig sind - nur für diese könnte ein anreizkompatibleres System ja zu einer Verhaltensänderung führen. Der Sachverständigenrat hat in seinem jüngsten Gutachten dazu ausgeführt, dass von den 2,9 Millionen Personen, die Ende 1997 Sozialhilfe bezogen haben, etwa eine
[Seite der Druckausg.: 75 ]
Million dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung stehen. [Fn. 67: a.a.O., S. 171] Das relativiert schon einmal entschieden die Vorstellung, dass es eigentlich nur eines intelligent ausgestalteten sozialen Sicherungssystems bedarf, um Sozialhilfeempfänger in Erwerbstätige zu überführen.
Dazu kommt folgendes. Sozialhilfe wird überwiegend von Geringqualifizierten bezogen. Wir haben an früherer Stelle bereits darauf hingewiesen, dass der technische Fortschritt einen Bias aufweist, der sich insbesondere gegen die Beschäftigten aus diesem Segment richtet. Die Prognosen gehen dahin, dass sich das eher noch verstärkt. So schreibt z.B. Karr: "Die Nachfrage nach Geringqualifizierten wird von 1995 bis 2010 um 1,5 Mio. zurückgehen und dann nur noch einen Anteil von 11,4% ausmachen (alle Zahlen für Westdeutschland)". [Fn. 68: Karr, W., Kann der harte Kern der Arbeitslosigkeit durch einen Niedriglohnsektor aufgelöst werden?, IAB Kurzbericht, 3 (1999), S. 3] Daraus darf man folgern, dass auch bei einer sehr intelligenten und beschäftigungsfreundlichen Ausgestaltung der Anreizsysteme es kaum zu massenhafter Arbeitsaufnahme von Sozialhilfeempfänger kommen wird. Das Problem, diese in das Beschäftigungssystem zu integrieren, liegt eben nicht nur an falschen Anreizstrukturen, sondern zum weit größeren Teil daran, dass es angesichts der stattfindenden Änderungen bei der Produktion von Gütern und Dienstleistungen zunehmend schwierig wird, gering Qualifizierte zu integrieren.
Dem wird entgegen gehalten, das sei nur eine Frage der Lohnhöhe und Lohndifferenzierung: Bei entsprechend niedrigen Reallöhnen könnten auch gering Qualifizierte problemlos in die Erwerbstätigkeit eingegliedert werden. Dabei wird auf ökonometrische Studien verwiesen, die in der Tat zu dem Ergebnis kommen, dass die Elastizität der Arbeitsnachfrage bezüglich des Reallohns im Bereich der gering Qualifizierten höher als bei der Nachfrage nach Qualifizierten ist.
Damit ist man aber wieder am Ausgangspunkt. Stark differenzierte und sehr niedrige Reallöhne für die wenig Qualifizierten und ein relativ hohes Sozialhilfeniveau passen wegen der damit verbundenen Fehlanreize nicht zusammen. Wer das Beschäftigungsproblem der gering Qualifizierten mit niedrigen Löhnen lösen möchte, muss deshalb konsequenterweise auch für sehr niedrig angesetzte Sozialhilfesätze
[Seite der Druckausg.: 76 ]
plädieren und wird oft darüber hinaus einer Arbeitspflicht für Sozialhilfeempfänger und/oder einer zeitlichen Begrenzung der Sozialhilfe das Wort reden. Das ist zwar eine konsequente, wenngleich auch beschränkte Sicht. Zum einen wird dabei übersehen, dass nur ein Teil der Sozialhilfebezieher für eine Arbeitsaufnahme in Frage kommt. Nur um diese kann es aber gehen, wenn man über stärkere Arbeitsanreize nachdenkt. [Fn. 69: Das sauber zu trennen, ist natürlich nicht immer einfach. Z.B. beeinflusst die Sozialhilfe für minderjährige Kinder das Verhalten der erwachsenen Bezugsperson.] Zum anderen sollte man sich darüber im klaren sein, dass hier auch Wertentscheidungen im Spiel sind, darüber nämlich, wie eine Gesellschaft mit denjenigen ihrer Mitglieder umgeht, die - aus welchen Gründen auch immer - in eine Notlage geraten sind.
Wir wollen diesen Abschnitt nicht beschließen, ohne auf den Earned Income Tax Credit (EITC) einzugehen, der in jüngerer Zeit in Deutschland verstärkt Aufmerksamkeit gefunden hat, [Fn. 70: Siehe z.B. Wilke, U., The Earned Income Tax Credit - Hat Amerika es besser?, Wsi-Mitteilungen, 4/99 (1999), S. 255-261; Werner, H., Der "Earned Income Tax Credit" soll Armut bei Arbeit lindern, IAB Kurzbericht 12 (1999), S. 1-3] nicht zuletzt deshalb, weil es sich dabei um eine Regelung mit einem außerordentlich starken Anreiz zur Aufnahme von Erwerbsarbeit zu handeln scheint. Bereits 1973 eingeführt, danach mehrfach modifiziert, ist dieses Programm insbesondere 1993 stark ausgeweitet und dann 1998 finanziell noch einmal kräftig aufgestockt worden. Der CounciI of Economic Advisers schätzt, dass 1998 rund 20 Millionen Beschäftigte auf Grund dieser Regelung Ansprüche geltend gemacht und im Durchschnitt $ 1 584 erhalten haben, Familien mit Kindern - die weit überwiegende Zahl der Anspruchsberechtigten - sogar durchschnittlich $ 1 870.
Worum geht es dabei? Der EITC will durch eine Steuergutschrift, die aber auch eine "negative Steuer", also eine Transferzahlung sein kann, vor allem das Problem der "working poor" bekämpfen. Familien, in denen zumindest eine Person einer Erwerbstätigkeit nachgeht, dabei aber nur ein niedriges Einkommen erzielt, erhalten Steuerermäßigungen oder - bei entsprechend niedrigem Einkommen - zusätzlich zu ihrem Lohn einen Sozialtransfer. Von der negativen Einkommensteuer, wie sie herkömmlicher Weise vorgeschlagen wurde, unterscheidet sich der EITC durch seinen noch rigoroser auf eine möglichst weitgehende Beteiligung am Erwerbsleben insistierende Ausgestaltung. Die negative Einkommensteuer üblichen Zuschnitts versucht, eine Grundsicherung mit ausreichenden Anreizen zur Arbeitsaufnahme zu
[Seite der Druckausg.: 77 ]
verbinden. Personen ohne jedes Einkommen erhalten also die Grundsicherung (negative Einkommensteuer), all diejenigen, die einer Arbeit nachgehen, in jedem Fall mehr, aber zunächst immer noch, mit steigendem Arbeitseinkommen allerdings dann abnehmende, Transferzahlungen. Bei einem bestimmten Einkommen ist dann der Punkt erreicht, bei dem man weder ein Transfereinkommen erhält noch eine Einkommensteuer bezahlt. Bei höheren Einkommen wird man steuerpflichtig.
Bereits bei diesem System ist gewährleistet, dass ein Anreiz besteht, einer Erwerbsarbeit nachzugehen und diese auch auszuweiten, da das Einkommen damit in jedem Fall gesteigert werden kann. Der EITC geht aber insofern noch wesentlich über die Arbeitsanreizwirkung einer normalen negativen Einkommensteuer hinaus, als es sich zum einen überhaupt nur um ein Programm für Erwerbstätige handelt: Ansprüche kann nur geltend machen, wer einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Zum anderen ist das System so ausgestaltet, dass nicht derjenige einen besondere hohen "tax credit" erhält, der ein besonders niedriges Einkommen hat. Um das zu erläutern, kommentiert man am besten die folgende Graphik.
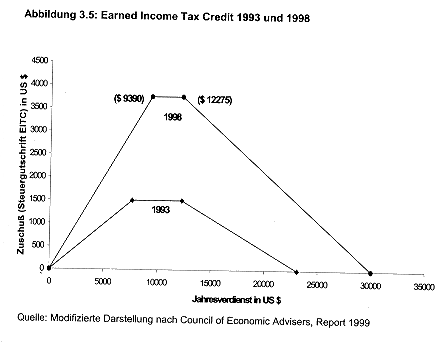
[Seite der Druckausg.: 78 ]
Das Bild bezieht sich auf eine Familie mit zwei oder mehr als zwei Kindern (für eine Familie mit einem Kind gelten andere Regelungen, ebenso für Einzelpersonen, für die das Programm wesentlich geringere Beträge vorsieht). Zunächst sieht man, dass 1998 gegenüber 1993 die Höchstsumme des EITC erheblich zugenommen hat und außerdem das Höchsteinkommen, das zum Bezug berechtigt, beträchtlich gestiegen ist. Bemerkenswert ist aber vor allem die in diesem Bild zum Ausdruck kommende Konstruktion: Nach der für 1998 geltenden Regelung ist der Höchstbetrag ($ 3 756) für diejenigen Haushalte reserviert, die einen Jahresverdienst zwischen $ 9 390 und $ 12 275 erzielen. Diejenigen, die ein niedrigeres Einkommen haben und damit in der sogenannten "phasing-in-Region liegen, erhalten ebenso einen niedrigeren tax credit wie diejenigen die darüber ("phasing-out"-Region) liegen. Die Absicht ist offenkundig: Man möchte vermeiden, dass durch geringfügige Erwerbsbeteiligung hohe Ansprüche auf Transferzahlungen entstehen. Wer möglichst viel vom tax credit profitieren will, der darf zwar nicht zu viel mit seiner Erwerbsarbeit verdienen, sollte sich aber doch möglichst schon als Vollzeitarbeitskraft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Es ist insofern ziemlich offensichtlich, dass das Programm eine zwar gering verdienende, aber als Vollzeitarbeitskraft wirkende Person mit Familie vor Augen hat. Beabsichtigt ist insbesondere, mit dem tax credit dazu beizutragen, dass so charakterisierte Geringverdiener, die sonst unterhalb der Armutsgrenze lägen, über diese Grenze zu schieben.
Man könnte aus dem Ausgeführten schließen, dass es sich beim EITC vor allem um ein Programm handelt, das darauf zielt, die Zahl der "working poor" zu reduzieren. Da es sich dabei um ein primär amerikanisches Problem handelt, liegt natürlich auch die Folgerung nahe, dass für europäische und speziell für deutsche Verhältnisse so etwas wie der EITC wenig Sinn gibt.
Bevor man diese Folgerung zieht, sollte man sich aber schon darüber im klaren sein, dass es sich beim EITC nicht nur um ein Unterstützungsprogramm für die "working poor" handelt. Als solches kann es für die Bundesrepublik nur ein geringes Interesse beanspruchen. Es ist daneben aber eben auch ein Programm, mit dem man recht gut verdeutlichen kann, was es bedeutet, wenn "workfare statt welfare" gefordert wird. Die hinter dem EITC stehende Philosophie ist, dass vor allem derjenige die staatliche
[Seite der Druckausg.: 79 ]
Unterstützung verdient, der seine - wenngleich vom Markt nur gering honorierte - Arbeitskraft der Gesellschaft zur Verfügung stellt. Diese Grundeinstellung wird in den USA nicht nur durch das Zuckerbrot des EITC verfolgt, sondern auch durch die Peitsche der 1996 erfolgten Sozialreform. Danach ist der Bezug von Sozialhilfe (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) generell auf fünf Jahre während des gesamten Lebens beschränkt und zudem darf die Unterstützung nicht länger als zwei Jahre ohne Unterbrechung gewährt werden.
EITC und TANF ergänzen sich, indem beide zusammen natürlich die Wirkung haben, eine Arbeitsaufnahme außerordentlich zu befördern - im einen Fall mit Zuckerbrot, im anderen mit Peitsche. Wer in Deutschland "workfare" einen größeren Stellenwert und "welfare" einen etwas geringeren als bisher zuerkennen möchte, wird sicher weder EICT noch TANF unmodifiziert übernehmen können. Gründlich abgewogen werden müsste zum einen, ob eine solche Schwerpunktverlagerung wünschenswert ist und zum anderen - wenn man sich entscheiden sollte, in diese Richtung zu gehen - mit welchen Mitteln man sie herbeiführen will.
3.4 Ein weiteres Zwischenfazit
Wir haben uns in diesem Kapitel mit einigen der tatsächlichen oder vorgeblichen Unterschieden befasst, die immer wieder genannt werden, wenn die größere Fähigkeit zur Arbeitsplatzschaffung der US-amerikanischen Ökonomie zur Debatte steht. Selbstverständlich werden noch andere Faktoren genannt, z.B. eine höhere Arbeitszeitflexibilität in den Staaten, eine deutlich höhere Mobilitätsbereitschaft der dortigen Bevölkerung, deren Bereitschaft, auch nicht ihrer Qualifikation entsprechende Arbeiten zu übernehmen, eine insgesamt, aber ganz besonders am Arbeitsmarkt geringere Regulierungsdichte, usw. Wir verzichten darauf, den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen zu überprüfen. Tatsächlich geht es nämlich gar nicht so sehr darum, ob sich in diesen oder bei den zuvor behandelten Sachverhalten Unterschiede zwischen den USA und Deutschland feststellen lassen. Das ist bei einigen ziemlich offenkundig, bei anderen weniger deutlich.
[Seite der Druckausg.: 80 ]
Man sollte sich aber klar darüber sein, dass nicht die Unterschiede als solche, sondern nur eine deutliche Verstärkung in diesen Unterschieden ein ernsthafter Erklärungskandidat für die unterschiedliche Entwicklung in der Arbeitslosigkeit abgeben kann. Wie an früherer Stelle deutlich gemacht wurde, lag die Arbeitslosigkeit in den USA lange Zeit über der in Deutschland, z.T. sogar recht beträchtlich. Die Unterschiede, auf die immer wieder zur Erklärung der höheren Arbeitslosigkeit in Deutschland hingewiesen wird, gab es aber auch schon zu der Zeit, in denen die Bundesrepublik eine entschieden niedrigere Arbeitslosigkeit aufwies.
In den neunziger Jahren ist das anders, die Arbeitslosenquote in Deutschland ist höher. Der Gegenläufigkeit der Entwicklung bei der Arbeitslosigkeit in beiden Ländern entspricht in der Regel aber nicht eine Verstärkung der Unterschiede bei den genannten Sachverhalten. Was die Kritiker an Inflexibilitäten in Deutschland beklagen, ist z.T. abgemildert oder sogar beseitigt worden. So ist z.B. die Möglichkeit von Zeitarbeitsverträgen eingeführt worden, Härte- bzw. Öffnungsklauseln haben mögliche negative Auswirkungen des Flächentarifvertrags ausgemerzt, Betriebs- und Arbeitszeiten sind voneinander entkoppelt worden und haben den Betrieben erhebliche Flexibilitätsspielräume eröffnet. Mit dem neuen Arbeitsförderungsgesetz (Sozialgesetzbuch III) ist auf weitere, zuvor vielfach kritisierte Punkte reagiert worden. So ist z.B. für die Zumutbarkeit nicht mehr die erworbene Qualifikation maßgeblich und sie wird mit der Dauer der Arbeitslosigkeit ausgedehnt. Auch ist im neuen Gesetz ausdrücklich festgehalten, dass ein Arbeitsloser verpflichtet ist, sich aktiv um eine neue Stelle zu bemühen. Insgesamt wird man also festhalten müssen, dass es in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren eher zu einer Beseitigung als zu einem weiteren Ausbau der Sachverhalte gekommen ist, die gemeinhin als beschäftigungshemmend genannt werden. Und im Vergleich zu den USA wird man feststellen können, dass sich seit den Jahren, in denen die Bundesrepublik noch eine niedrigere Arbeitslosenquote aufwies, bei den immer wieder genannten Sachverhalten insgesamt keine weitere Auseinanderentwicklung ergeben hat - eher sogar eine gewisse Annäherung.
Gerade das stellt aber all die Erklärungsversuche der unterschiedlichen Arbeitsmarktsituation in Frage, die darauf hinauslaufen, dem amerikanischen Arbeitsmarkt
[Seite der Druckausg.: 81 ]
eine wesentlich höhere Flexibilität zuzuerkennen. Ihre Schwachstelle ist, dass sie eigentlich einen fortschreitenden Prozess der Flexibilisierung in den USA und einen gleichermaßen fortschreitenden Prozess der Rigidisierung in Deutschland aufzeigen müssten. Das ist aber nicht zu belegen. Damit ergibt sich die Notwendigkeit, nach überzeugenderen Erklärungen Ausschau zu halten. Dem dient das folgende Kapitel.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juni 2001