

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 20]
1. Konjunktur und Beschäftigung
Hans-Jürgen Krupp
Was kann die Geldpolitik für die Beschäftigung tun?
Eine der drängendsten Aufgaben der Wirtschaftspolitik ist die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Dies gilt nicht nur für Deutschland (West wie Ost), sondern - mit Ausnahme weniger Staaten - auch für die anderen Länder der Europäischen Währungsunion. In Deutschland beträgt die Zahl der registrierten Arbeitslosen zur Zeit rund 4 Millionen. Immerhin geht die Zahl der Arbeitslosen seit einiger Zeit im Trend zurück.
Inzwischen dürfte weitestgehende Einigkeit darüber bestehen, daß es keine Patentrezepte zur Überwindung der Beschäftigungsprobleme gibt. Die Arbeitslosigkeit weist starke strukturelle Komponenten auf, deren Bekämpfung auf den Güter- und Arbeitsmärkten ansetzen muß, und eine konjunkturelle Komponente, die im Rahmen einer gesamtwirtschaftlichen Stabilisierungspolitik, zu der auch die Geldpolitik zählt, verringert werden kann. In Deutschland hat in der Vergangenheit auch die Währungspolitik eine bedeutende Rolle gespielt. Nicht zuletzt hat die Aufwertung der D-Mark 1995 zu einer deutlichen Wachstumsverlangsamung und damit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit beigetragen. Die Europäische Währungsunion hat die Wechselkursabhängigkeit des deutschen Außenhandels stark verringert und damit auch die Bedeutung der Währungspolitik für die binnenwirtschaftliche Stabilisierung. Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht daher die europäische Stabilisierungspolitik.
Schätzungen des strukturellen Anteils der Arbeitslosigkeit kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Nach Schätzungen der OECD lag die strukturelle Arbeitslosigkeit in Deutschland 1998 bei 7,9%, insgesamt belief sie sich auf 9,4%. Danach waren also rund 85% der Arbeitslosigkeit strukturell. Für Westdeutschland errechnete das ifo-lnstitut für 1997, daß etwa zwei Drittel der Arbeitslosigkeit struktureller Art waren. Ein Grund für den Unterschied zwischen beiden Schätzungen mag darin liegen, daß in den OECD-Zahlen Ostdeutschland mit seiner hohen strukturellen Arbeitslosigkeit enthalten ist. Letztlich ist aber die Frage, wie hoch der Anteil der strukturellen Arbeitslosigkeit genau ist, gar nicht so entscheidend. Wesentlich ist die grundsätzliche Aussage dieser Untersuchungen: Auch bei Zugrundelegung der zurückhaltenderen Schätzung der OECD waren 1998 rund 15% der Arbeitslosigkeit in Deutschland gesamtwirtschaftlich bedingt. Die inzwischen eingetretene Verbesserung ist sicher insbesondere mit einer Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erklären.
Wenn in diesem Beitrag die Möglichkeiten, mit stabilisierungspolitischen Mitteln zur Lösung der Beschäftigungsprobleme beizutragen, diskutiert werden, reden wir über den kleineren Teil der Arbeitslosigkeit. Geht man von den OECD-Zahlen aus, würde die Arbeitslosenquote auch bei Vollauslastung der vorhandenen Produktionskapa-
[Seite der Druckausg.: 21]
zitäten bei etwa 8% verharren. Etwas vereinfacht wird häufig argumentiert, daß der Versuch, die Arbeitslosigkeit mit stabilisierungspolitischen Mitteln unter dieses strukturell bedingte Niveau zu senken, nur vorübergehend erfolgreich sein kann und immer mit einem Anstieg der Inflationsrate verbunden wäre. Nicht zuletzt wäre eine solche Politik nicht mit der Vorgabe der Europäischen Zentralbank vereinbar, deren primäres Ziel die Preisstabilität ist.
Tatsächlich spricht vieles dafür, daß sich der mögliche Beschäftigungsbeitrag der Geldpolitik unter diesen eher kurzfristigen Gesichtspunkten in dieser Größenordnung bewegt - manche Aufgeregtheit in der Diskussion der Beschäftigungseffekte, die zinspolitische Maßnahmen der EZB auslösen, mag daher überzogen scheinen. Allerdings ist angesichts der noch immer schwierigen Arbeitsmarktsituation jeder Beitrag zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit etwas, wofür es sich einzusetzen lohnt.
Außerdem entsteht ein anderes Bild, wenn man den Zeithorizont erweitert und die längerfristige Entwicklung der Arbeitslosigkeit über mehrere Konjunkturzyklen betrachtet. Um zunächst auf die bereits zitierte OECD-Untersuchung zurückzukommen: Für das Jahr 1990 schätzt man, daß die gemessene Arbeitslosigkeit von 6,1% in Deutschland ausschließlich strukturelle Gründe hatte. Mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland ist also auch die strukturelle Arbeitslosigkeit gestiegen. In den USA hat sich in diesem Zeitraum die entgegengesetzte Entwicklung abgespielt (vgl. Schaubild). Gleichzeitig ist dort der Sockel an struktureller Arbeitslosigkeit gesunken. Demnach hängen also die Entwicklungen von struktureller und insgesamt zu beobachtender Arbeitslosigkeit zusammen.
Für Deutschland läßt sich dieser Zusammenhang noch weiter präzisieren. Seit 1970 hat sich der Anstieg auf das hohe Niveau an Arbeitslosigkeit, mit dem wir heute konfrontiert sind, nicht in einem gleichmäßigen Prozeß vollzogen, sondern schubweise. Dabei fallen die Phasen stark ansteigender Arbeitslosigkeit immer in Rezessionsphasen. Der systematische Anstieg ergibt sich, weil nicht alle der in einer Rezessionsphase freigesetzten Arbeitskräfte in den darauffolgenden Phasen stärkeren Wachstums wieder in den Produktionsprozeß integriert werden konnten. Im Zeitablauf scheinen die Entwicklungen der durch den Trend angedeuteten strukturellen und der konjunkturellen Arbeitslosigkeit also durchaus zusammenzuhängen. Wenn sich das gesamtwirtschaftliche Wachstum verlangsamt, dann führt dies zunächst dazu, daß der Nachfragerückgang zu einem Rückgang der Beschäftigung führt. Neu entstehende Arbeitslosigkeit erscheint also ganz überwiegend zunächst als konjunkturelle Arbeitslosigkeit. Der nach einer Rezession zu verzeichnende Anstieg des Sockels an Arbeitslosigkeit hängt dabei ganz entscheidend von der Länge der Rezession ab. Die vergleichsweise langen Rezessionen in Deutschland haben regelmäßig zu einer Erhöhung des Arbeitslosensockels geführt. Demgegenüber haben die kurzen Rezessionen zum Beispiel in den USA nicht zu diesem trendmäßigen Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt.
[Seite der Druckausg.: 22]
Arbeitslosenquoten im EWU-Raum, in Deutschland und in den USA 1970 - 1999
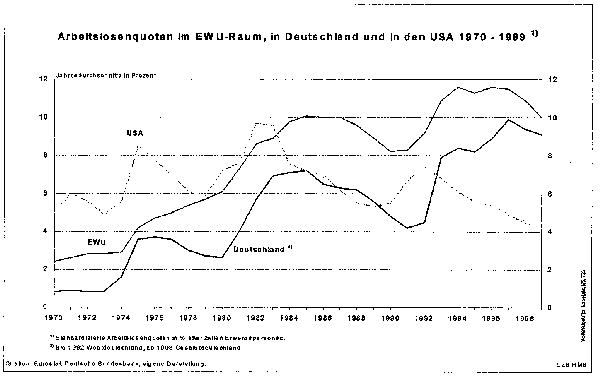
[Seite der Druckausg.: 23]
Kennzeichnend für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland ist aber vor allem, daß das Tempo, mit dem Arbeitslosigkeit in der Rezession entsteht, weit höher ist als das, mit dem sie im konjunkturellen Aufschwung abgebaut wird. Dafür gibt es unterschiedliche Erklärungen: Möglich ist, daß der konjunkturelle Abschwung den ohnehin stattfindenden Strukturwandel verstärkt. Die Arbeitsplatzverluste im konjunkturellen Abschwung betreffen dann andere Sektoren als die zusätzliche Nachfrage nach Arbeitskräften im Aufschwung. Die neuen Arbeitsplätze bzw. die Qualifikationsanforderungen unterscheiden sich dann vermutlich erheblich von den weggefallenen. Dies kann aber auch innerhalb eines Produktionssektors der Fall sein, weil bei einem Produktionsrückgang zunächst unrentable Produktionstechnologien stillgelegt werden und bei der anschließenden Ausweitung der Produktionskapazitäten gleichzeitig auf modernere Produktionsverfahren umgestellt wird.
Außerdem muß man davon ausgehen, daß die durch starke Absatzschwankungen ausgelöste Verunsicherung auf Seiten der Unternehmen dazu beiträgt, daß eine Erhöhung der Produktion im Aufschwung erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung zu einer Kapazitätsausweitung führt, also zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen.
All diese Argumente sprechen dafür, daß starke konjunkturelle Schwankungen die mit dem Strukturwandel ohnehin verbundenen Probleme am Arbeitsmarkt noch verstärken. Langfristig tragen ausgeprägte konjunkturelle Schwankungen also zu einer Erhöhung des Sockels an struktureller Arbeitslosigkeit bei. Für die Einschätzung der Wirksamkeit geldpolitischer Maßnahmen hat dies wichtige Konsequenzen: Auch wenn es kurzfristig nicht möglich ist, mit konjunkturpolitischen Maßnahmen die Beschäftigungsprobleme in Deutschland und Europa zu lösen, spricht doch alles dafür, daß auf lange Sicht auch das Niveau an struktureller Arbeitslosigkeit durch stabilisierungspolitische Maßnahmen beeinflußt werden kann. Dann kann auch die Geldpolitik dazu beitragen, Auslastungsschwankungen, die gravierenden Beschäftigungsrückgängen immer vorausgehen, gering zu halten. Auf längere Sicht ist es demnach durchaus möglich, mit geldpolitischen Mitteln zur Beschäftigungssicherung beizutragen.
2. Wirkungsmechanismen der Geldpolitik
Wie sehen aber der Handlungsrahmen der Geldpolitik und die konkreten Möglichkeiten, mit geldpolitischen Mitteln die Beschäftigung zu beeinflussen, aus? Das Grundproblem einer Zentralbank besteht ja darin, daß sie heute zur Verfolgung ihrer Ziele faktisch nur ein einziges Instrument zur Verfügung hat, das kurzfristige Zinsniveau am Geldmarkt. Im Rahmen ihrer Basis- und Hauptrefinanzierungsgeschäfte kann die EZB den Tagesgeldsatz am Geldmarkt relativ genau steuern. Abgesehen von Ausreißern an einzelnen Tagen hat sich der Tagesgeldsatz in der Währungsunion inzwischen nahe dem durch die Leitzinsen der EZB vorgegebenen Niveau von derzeit (März 2000) 3,5% eingependelt.
Veränderungen des kurzfristigen Zinsniveaus wirken übrigens gleichzeitig auf mehreren Wegen auf Wachstum und Preise. Man spricht von den Transmissionskanälen der Geldpolitik. Am bekanntesten ist der traditionelle Investitionskanal: Man geht
[Seite der Druckausg.: 24]
davon aus, daß der langfristige Zinssatz die Investitionen beeinflußt, wie wir das zum Beispiel vom Eigenheimbau kennen. Niedrige Zinsen fördern die Investitionen. Der langfristige Zins wiederum wird vom kurzfristigen beeinflußt. Der sogenannte Kreditkanal betont, daß zinspolitische Maßnahmen zudem unmittelbar zu einer Verknappung der von den Banken gewährten Kredite führen. Bei steigenden Zinsen verschlechtert sich die Risikoposition der Banken, so daß sie ihr Kredit-Angebot reduzieren. In offenen Volkswirtschaften ist außerdem der Wechselkurskanal von Bedeutung. Er behauptet, daß sich eine Veränderung der internationalen Zinsdifferenzen auch auf die Wechselkurse auswirkt. So führt ein niedrigeres Zinsniveau in Europa tendenziell dazu, daß Kapitalanlagen zum Beispiel in den USA attraktiver sind. Der Kapitalabfluß führt zu einer Abwertung des Euro, die das Wachstum stützt. Ein relativ höheres Zinsniveau begünstigt eine Aufwertungstendenz, welche das Wachstum bremst.
Ein aktuelles Beispiel für den Einfluß, den internationale Zinsdifferenzen auf Wechselkursentwicklung und reale Entwicklung haben, dürfte übrigens das Verhältnis des Euro zum Dollar sein. Die Zinsen in den USA liegen im langfristigen Bereich noch immer rund einen Prozentpunkt oberhalb des europäischen Niveaus. Im kurzfristigen Bereich sind es sogar zwei Prozentpunkte. Internationale Anleger nutzen diesen Zinsvorteil aus. Die dadurch ausgelöste Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar hat das Einsetzen des Aufschwungs in den Ländern der Währungsunion zweifellos begünstigt - für die Akzeptanz des Euro ist sie freilich nicht unproblematisch.
Auch wenn es also vielfältige Einflüsse der Geldpolitik auf die Beschäftigung gibt, ist grundsätzlich zu klären, inwieweit eine Beschäftigungsorientierung der Notenbank mit ihren Zielvorgaben vereinbar ist. In den USA ist diese Frage relativ einfach zu beantworten, da dort Preisstabilität und Beschäftigung gleichwertige Ziele der Geldpolitik sind. Die Situation in Europa ist anders. Ähnlich wie dies in Deutschland der Fall war, räumt der Maastricht-Vertrag dem Inflationsziel Priorität für die Geldpolitik der EZB ein. Nur soweit es ohne Beeinträchtigung dieses Ziels möglich ist, soll die Geldpolitik auch Beschäftigungseffekte berücksichtigen.
Die Erfahrungen mit der EZB in den ersten 15 Monaten ihres Bestehens haben gezeigt, daß die EZB diese Verpflichtung, bei ihren Entscheidungen auch die reale Entwicklung zu berücksichtigen, durchaus ernst nimmt. Gleich nachdem sie die Verantwortung für die Geldpolitik in der Währungsunion übernommen hatte, nahm sie im April letzten Jahres den hohen Grad an Preisniveaustabilität in der Währungsunion und die sich damals verschlechternden Konjunkturperspektiven zum Anlaß für eine deutliche Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt. Dieser Entscheidung war eine koordinierte Zinssenkung der nationalen Notenbanken im Dezember 1998 vorausgegangen.
Gerade in Deutschland ist diese Entscheidung - vor allem mit dem aus Bundesbank-Zeiten gewohnten Blick auf das Geldmengenwachstum - heftig kritisiert worden. Von verschiedenen Seiten wurde in diesem Zusammenhang die Position vertreten, daß die Sicherung einer möglichst niedrigen Inflationsrate der beste Beitrag ist, den die Zentralbank zur Beschäftigungssicherung leisten kann. Ergänzt wird diese Position häufig durch die Behauptung, die EZB verfolge eine mittelfristige Strategie, so
[Seite der Druckausg.: 25]
daß sich auch aus diesem Grund eine Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung oder gar der Beschäftigung verbiete.
Hier liegen gleich mehrere Mißverständnisse vor. Der Zusammenhang zwischen Inflationsrate und Beschäftigung ist keineswegs so klar, wie er hier behauptet wird. Früher glaubte man eher das Umgekehrte. Mit etwas Inflation könne man etwas Arbeitslosigkeit abbauen. Dies läßt sich allerdings genauso wenig nachweisen, wie die neue These, daß weniger Inflation zu mehr Beschäftigung führe.
Schwerwiegender ist aber die letzte dieser Behauptungen: Der mittelfristige Charakter der EZB-Strategie bezieht sich auf die Sicherung der Preisniveaustabilität und das Strategieelement eines mittelfristigen Geldmengenwachstums, das die EZB zur Zeit mit 4,5% ansetzt. Beide stehen aber nur in mittelbarem Zusammenhang zum eigentlichen Instrument der Geldpolitik, dem kurzfristigen Zinsniveau. Bei der Inflationsrate geht man davon aus, daß sie erst mit einer Verzögerung von ungefähr zwei Jahren auf geldpolitische Maßnahmen reagiert. Der Zusammenhang zum Geldmengenwachstum war zumindest zeitlich sehr viel enger - einer der Gründe, warum Geldmengenziele sich lange Zeit großer Popularität erfreut haben.
3. Zinspolitik im Konjunkturzyklus
Weder eine Verstetigung der monetären Rahmenbedingungen noch der Inflationsentwicklung ist aber gleichbedeutend mit einer Verstetigung des Zinsverlaufs in dem Sinne, daß der Zins möglichst lange konstant gehalten werden sollte. Im Gegenteil: Ohne eine aktive Zentralbankpolitik, die Variationen der kurzfristigen Zinsen herbeiführt, würde der Bedarf an Zahlungsmitteln im Konjunkturverlauf starken Schwankungen unterliegen: In dem Maße, wie Produktion, Preisniveau und damit der Wert der in einer Periode umgesetzten Güter im Konjunkturzyklus schwanken, verändert sich auch der Geldbedarf einer Volkswirtschaft. Verstetigen kann man diese Entwicklung nur, indem man die mit Kreditgewährung und Geldhaltung verbundenen Kosten entsprechend variiert: Die Zinsen müssen im konjunkturellen Abschwung sinken und im Aufschwung steigen. Nur so können die monetäre Expansion verstetigt und dauerhaft Preisstabilität gewährleistet werden. Bezogen auf die konjunkturelle Entwicklung ist eine solche Politik aber neutral. Auch eine mittelfristig verstetigende Geldpolitik erfordert also diskretionäre Zinsschritte der Zentralbank, weil die Notenbankzinsen eben nicht automatisch schwanken. Dazu bedarf es aktiver Entschlüsse der Zentralbank. Eine Geldpolitik, die dies übersieht und Verstetigung als Tatenlosigkeit in der Zinspolitik mißversteht, verstärkt die konjunkturellen Schwankungen: Im Boom ist das Zinsniveau zu niedrig und wirkt damit zusätzlich expansiv, in der Rezession ist es zu hoch und bremst damit die Stabilisierung.
Die Bundesbank hat dies in ihrer Politik berücksichtigt: Seit dem Ende des Bretton Woods-Systems, das den Übergang von einer rein wechselkursorientierten zu einer unabhängigen Geldpolitik in Deutschland kennzeichnete, ist ein deutliches Schwanken der kurzfristigen Zinsen im Konjunkturzyklus erkennbar - niemand wird der Bundesbank deswegen vorwerfen, eine zu sehr an der Beschäftigung orientierte Geldpolitik betrieben zu haben.
[Seite der Druckausg.: 26]
Leider zeigt ein Vergleich mit dem Kurs der amerikanischen Geldpolitik über den gleichen Zeitraum, daß die Bundesbank die Aufgabe einer dem Konjunkturzyklus angemessenen Zinspolitik nur mit Verzögerungen erfüllt hat: Die Zinssenkungen erfolgten immer erst nach dem Einsetzen eines konjunkturellen Abschwungs und nicht, wie im Fall der USA, gleich zu Beginn. Nun muß man davon ausgehen, daß eine Zinssenkung erst mit einer Verzögerung auf die wirtschaftliche und monetäre Entwicklung wirkt, so daß eine die monetäre Entwicklung versteigende Geldpolitik das Ziel haben müßte, eine dem Konjunkturzyklus vorauseilende Zinsentwicklung herbeizuführen - andernfalls verstärkt sie die Entwicklung an konjunkturellen Wendepunkten. Die nominalen Zinsen müßten bereits vor dem Einsetzen einer wirtschaftlichen Abschwächung zu sinken beginnen, und müßten ihren Tiefpunkt durchschritten haben, bevor die Wachstumssohle erreicht ist.
Gemessen an diesem Maßstab hat die Bundesbank mit ihrer Politik vor allem in der beginnenden Rezession oft zu langsam reagiert. Diese verzögerte Politik der Bundesbank könnte einer der Gründe sein, warum die Rezessionen in Deutschland in der Regel länger anhielten als in den USA. Konjunkturstabilisierend wirkt die Geldpolitik also nur, wenn die Zinsentwicklung der konjunkturellen Entwicklung vorauseilt und ihr nicht folgt. Beispielhaft widerlegt dies die Behauptung, daß sich keine gesamtwirtschaftlichen Nachteile aus einer Vernachlässigung der konjunkturellen Situation bei geldpolitischen Entscheidungen ergeben.
Umso mehr ist daher das rechtzeitige Handeln der EZB zu begrüßen. Und inzwischen hat sie ihre Entschlossenheit ja auch bei Zinsschritten in die andere Richtung unter Beweis gestellt. Frühere Anzeichen eines konjunkturellen Aufschwungs nahm sie im November letzten Jahres zum Anlaß für eine Zinserhöhung, der inzwischen (März 2000) zwei weitere gefolgt sind. Dabei hatte sie sicher auch zu berücksichtigen, daß vom Kurs des Euro insgesamt eine konjunkturstützende Wirkung ausgeht.
Fragt man vor diesem Hintergrund nach einer Gesamtbeurteilung der bisherigen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, kann diese nur positiv ausfallen. Die Zwei-Säulen-Strategie, welche einerseits die Entwicklung der Geldmenge und andererseits die Inflationsperspektiven zur Beurteilung der Situation heranzieht, hat sich als sinnvoll erwiesen. Wenn Geldmengenentwicklung und Inflationsperspektive nicht immer Signale in dieselbe Richtung gaben, ist dies kein Fehler der Strategie, sondern ein Hinweis darauf, daß es sinnvoll ist, mehr als einen Indikator zu betrachten. Geldmengenaggregate unterliegen in vielfältiger Weise Störeinflüssen. Auch ist ihre Messung nicht einfach, was die häufigen Revisionen zeigen. Schon die Bundesbank mußte immer wieder Entscheidungen, die nicht mit der Geldmengenentwicklung begründbar waren, mit Sonderentwicklungen erklären. Andererseits gibt es auch viele Unsicherheiten bei der Darstellung der Inflationsperspektiven. Eine Punktprognose für die Inflationsrate in zwei Jahren wäre auch wissenschaftlich fragwürdig. Zur Analyse der Inflationsgefahren sollten möglichst differenzierte Indikatoren, auch aus den verschiedenen Ländern, herangezogen werden.
Die teilweise auf den Märkten vorhandene Erwartung, man könne eine geldpolitische Entscheidung quasi automatisch aus der Strategie ableiten, hat sich als nicht zu-
[Seite der Druckausg.: 27]
treffend erwiesen. Falsch war an dieser Stelle nicht das Verhalten der EZB, sondern die Erwartungen der Märkte.
Was Einzelentscheidungen der EZB anbetrifft, mag man an der einen oder anderen Stelle Kritik anbringen. Insgesamt zeigt die EZB aber, daß sie bereit ist, die Zinsen mit der konjunkturellen Entwicklung schwanken zu lassen. Deutlich ist auch die Absicht, der konjunkturellen Entwicklung vorherzulaufen.
Bei der Beurteilung der Politik der EZB ist auch die Wechselkursentwicklung zu beachten. Zwar hat die Währungsunion dazu geführt, daß die Außenhandelsabhängigkeit gesunken ist. Ohne Zweifel kommt aber der jetzige Euro-Wechselkurs einem expansiven Impuls gleich, der die Exporte fördert und die Importe bremst. Dieses ist bei der Bemessung einer angemessenen Zinsrate zu berücksichtigen. Dazu kommt, daß eine Vergrößerung der Zinsdifferenz zu den USA mit einer weiteren Abschwächung des Kurses verbunden sein könnte, welche die Akzeptanz des Euro beeinträchtigen würde. Insofern ist die Kursentwicklung für die Geldpolitik der EZB eine durchaus zweischneidige Angelegenheit.
Eine andere Zinspolitik wäre sicher angesagt, wenn es zu einer Aufwärtsentwicklung des Euro-Kurses käme. In diesem Falle wäre es die Aufgabe der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank auszuloten, welche Beschäftigungszuwächse ohne eine Verletzung des Zieles der Preisstabilität möglich sind.
4. Die Rolle der Geldpolitik im europäischen Policy-Mix
Damit sich die Geldpolitik aber in dieser Weise an der Konjunktur orientieren kann, muß eine wesentliche Voraussetzung erfüllt sein. Das bislang Gesagte gilt unter der Prämisse, daß die Inflationsrate nur konjunkturbedingten, geringfügigen Schwankungen unterliegt. Insbesondere heißt das, daß die Finanz- und die Lohnpolitik bei ihren Entscheidungen auch deren Effekte auf die Inflationsrate berücksichtigen müssen. Überzogene Lohnabschlüsse bergen die Gefahr, daß die Unternehmen die damit verbundenen zusätzlichen Kosten auf die Preise überwälzen. Die Geldpolitik kann dem nur entgegenwirken, indem sie die Zinsen über das konjunkturneutrale Maß erhöht. Dadurch wird ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage herbeigeführt, der die Preisüberwälzungsspielräume der Unternehmen begrenzt. Der Anstieg der Inflationsrate kann in diesem Fall also nur um den Preis dämpfender konjunktureller Effekte verhindert werden. Ähnliches gilt natürlich für inflationäre Effekte fiskalpolitischer Maßnahmen.
Etwas vereinfacht kann man also sagen, daß die Geldpolitik zwar in der Lage ist, langfristig alle anderen Einflüsse auf die Preisentwicklung zu korrigieren - daher die vorrangige Orientierung an der Inflationsrate. Impulse der Finanz- und der Lohnpolitik übertragen sich aber sehr viel schneller auf die Preisentwicklung und müssen daher eventuell um den Preis dämpfender Effekte auf das Wachstum durch die Geldpolitik korrigiert werden.
[Seite der Druckausg.: 28]
Diese Verflechtungen von Zielen und Instrumenten der Politikbereiche sprechen dafür, daß das in Deutschland seit den achtziger Jahren vorherrschende Rollentrennungsmodell der Wirtschaftspolitik, in dem die Finanzpolitik allein für das Wachstum verantwortlich ist, die Lohnpolitik für die Beschäftigung und die Geldpolitik für die Preisniveaustabilität keine optimalen Ergebnissen erbringen kann.
Schon auf nationaler Ebene konnte das in diesem Rollentrennungsmodell implizit gebilligte Gegeneinander von Geld-, Finanz- und Lohnpolitik viel Schaden anrichten. Noch dringlicher wird die Abstimmung im gemeinsamen Währungsraum: Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den Teilnehmerländern sind eng. Impulse durch die Wirtschaftspolitik machen deshalb nicht an den Landesgrenzen halt. Damit stellt sich aber automatisch die Frage nach einem geeigneten Policy-Mix und der Rolle der Geldpolitik im Europa der Währungsunion.
Da die Geldpolitik in der Währungsunion als nationales Stabilisierungsinstrument ausscheidet, gewinnt die Finanzpolitik für die einzelstaatliche Konjunkturpolitik an Bedeutung. Diese kann sie aber nur ausfüllen, wenn in Abschwungphasen ein genügend großer „Puffer" in Form staatlicher Kreditaufnahme möglich ist, um konjunkturbedingte Mindereinnahmen und zusätzliche Ausgaben aufzufangen. Und das heißt, daß das öffentliche Budgetdefizit in Phasen „normaler konjunktureller Entwicklung" - und noch mehr in Aufschwungphasen - deutlich unter dem Referenzwert von 3% des Bruttoinlandsproduktes liegen sollte.
Inzwischen liegen die Defizitquoten der öffentlichen Haushalte in allen Ländern unterhalb dieses Referenzwertes. Dennoch sind in nahezu allen Staaten weitere Konsolidierungsbemühungen nötig, weil der Schuldenstand nach wie vor in mehreren Ländern oberhalb der Grenze von 60% des BIP liegt. Das gilt auch für die „großen Vier" Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Durch eine mittel- und langfristige Konsolidierungsstrategie muß die Gestaltungsfähigkeit der öffentlichen Hand wiedergewonnen werden. Denn wenn ein hoher Teil der Ausgaben für Schuldendienst geleistet werden muß, so fehlen Mittel für die eigentlichen Aufgaben. Die Finanzpolitik kann dann weder ihren Stabilisierungsbeitrag leisten noch durch ausreichend hohe öffentliche Investitionen zum Wachstum beitragen.
Die Lohnpolitik steht im Zeichen der hohen Arbeitslosigkeit in Europa. Vor diesem Hintergrund sind maßvolle Tarifabschlüsse erforderlich, welche die voraussichtliche Preisentwicklung und den Produktivitätsfortschritt berücksichtigen. In der für Europa gegebenen Situation einer starken Unterbeschäftigung kann die Rate des Produktivitätsfortschritts nur die Obergrenze des Lohnanstiegs sein. Die statistisch gemessene Arbeitsproduktivität - und nur diese kennt man in der Praxis - steigt auch dann an, wenn ein Teil der Beschäftigten aufgrund zu hoher Kosten entlassen wird. Bei Rationalisierungen fallen unterdurchschnittlich produktive Arbeitsplätze weg. Infolgedessen steigt die durchschnittliche Arbeitsproduktivität. Gäbe man diese Art von Produktivitätszunahme über die Löhne an die Arbeitnehmer weiter, so würde der Druck zu Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau anhalten.
Die Aussichten für eine zurückhaltende Lohnpolitik steigen, wenn die Finanzpolitik bei Steuern und Abgaben Entlastungen vornimmt und so die verfügbaren Einkom-
[Seite der Druckausg.: 29]
men der Arbeitnehmer stützt. Allerdings sind dem Niveau einer Nettoentlastung durch die angespannte Haushaltslage Grenzen gesetzt.
Ein richtiger Ansatzpunkt ist daher, durch Umschichtungen bei Steuern und Abgaben hin zum Faktor Umwelt und zum Verbrauch den Faktor Arbeit zu entlasten. Auf diese Weise können die Lohnnebenkosten gesenkt werden, ohne daß es bei den verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmer oder bei den Sozialleistungen zu einschneidenden Abstrichen kommt. Für die Unternehmen wird über die Kostendämpfung ein Anreiz gegeben, neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Und auch zwischen Lohn- und Geldpolitik bestehen Verbindungen. Eine Geldpolitik, die davon ausgeht, daß die Tarifparteien auf die Preisentwicklung keine Rücksicht nehmen, sieht anders aus als eine Geldpolitik, die darauf setzt, daß die Lohnpolitik Rücksicht auf die Preisentwicklung nehmen wird. Umgekehrt gehen auch von der Geldpolitik Signale für die Lohnpolitik aus: Eine vornehmlich auf das Ziel der Preisstabilität verpflichtete Strategie zeigt den Tarifparteien, daß sie nicht damit rechnen können, daß negative Beschäftigungswirkungen expansiver Lohnabschlüsse durch Inflationierung korrigiert werden.
Im Europa der Währungsunion ist zusätzlich zu beachten, daß dies freilich ohnehin nur bei einer gemeinsamen europäischen Lohnpolitik möglich wäre, die in hohem Maße unwahrscheinlich ist. Da das Preisniveau auf europäischer Ebene bestimmt wird, kommt es bei über der Produktivität liegenden Löhnen in einzelnen Ländern nicht zu Preis-, sondern nur zu Kostenerhöhungen, die nur in dem betroffenen Land zum Verlust der Wettbewerbsfähigkeit und damit zu Arbeitslosigkeit führen. In kleinerem Maßstab haben wir einen solchen Prozeß in Ostdeutschland erlitten.
Insofern entstehen mit der Einführung der gemeinsamen Währung in Europa neue Beschäftigungsrisiken, allerdings nur bei falscher Tarifpolitik. Damit ist die Frage nach der beschäftigungspolitischen Dimension der Währungsunion aufgeworfen. Die Währungsunion setzt ganz neue ökonomische Rahmenbedingungen. Nicht zuletzt stellt sich die Frage nach den direkten Wirkungen des gemeinsamen Geldes auf die nationalen Arbeitsmärkte. Sie sind allerdings nur schwer abzuschätzen. Auf jeden Fall beseitigt der Wegfall der Wechselkurse innerhalb des EWU-Raumes ein erhebliches Störpotential, das früher von Währungsturbulenzen ausging und in der Vergangenheit viele Arbeitsplätze gekostet hat. Für den Arbeitsmarkt ist schon viel dadurch gewonnen, daß solche unnötigen Arbeitsplatzverluste nunmehr entfallen. Man kann aber auch damit rechnen, daß die Intensivierung der ökonomischen Verflechtung innerhalb Europas Wachstumspotentiale eröffnen wird. Schließlich entfallen von nun an die Transaktionskosten, die mit dem Umlauf mehrerer Währungen verbunden waren. Allerdings werden sich hieraus positive Beschäftigungswirkungen erst mittelfristig ergeben.
Dies gilt auch für den Einfluß der zu erwartenden Wettbewerbsintensivierung. Andererseits verliert der Wechselkurskanal der Geldpolitik an Bedeutung, weil der neue Währungsraum weniger außenhandelsabhängig ist. Hierin liegt zugleich ein Stück Zunahme von Autonomie, insbesondere im Verhältnis zum Dollar. Der Kurs des Euro
[Seite der Druckausg.: 30]
zum Dollar ist heute weniger bedeutsam, als es früher der Kurs der DM zum Dollar war. Von daher ist die Aufgeregtheit über den Eurokurs nicht verständlich.
5. Grenzen der Geldpolitik in Europa
In dem Maße, wie die konjunkturellen Positionen der Teilnehmerstaaten der Währungsunion voneinander abweichen, beeinträchtigt dies natürlich die Möglichkeiten der gemeinsamen Geldpolitik, konjunkturstabilisierend zu wirken. Der zinspolitische Kurs der Europäischen Zentralbank kann sich nur an der durchschnittlichen wirtschaftlichen Entwicklung in der Währungsunion orientieren. Konkret heißt das, daß auch im Idealfall das Zinsniveau etwas zu hoch sein wird für Länder mit schwachem Wachstum und zu niedrig für solche mit kräftigeren Wachstumsraten. Zu Beginn der Währungsunion unterschieden sich vor allem die konjunkturellen Positionen Irlands, Spaniens und der Niederlande von denen der restlichen Staaten. Diese Länder befinden sich weiterhin in einer kräftigen Aufschwungphase. Auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland und vor allem in Frankreich, zeigt die Entwicklung inzwischen deutlich nach oben. Wahrscheinlich werden die Intensivierung der Handelsbeziehungen und die gemeinsame Währung weiterhin dazu beitragen, daß es zu einem zunehmenden Gleichlauf der nationalen Konjunkturzyklen kommt. Dies würde die Effektivität der Geldpolitik in Europa verstärken und damit auch die Möglichkeiten, auf lange Sicht mit geldpolitischen Mitteln zu einer Rückführung der Arbeitslosigkeit in Europa beizutragen.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Oktober 2002