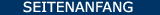![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 42]
2. Hemmnisse und Entwicklungspotentiale
2.1. ... aus unternehmerischer Sicht
Das verarbeitende Gewerbe - traditionell vor allem die Bereiche Industrieproduktion und Handwerk umfassend - nimmt seit rund drei Jahrzehnten in allen Industrieländern an gesamtwirtschaftlicher Bedeutung ab. Gleichzeitig wachsen der tertiäre bzw. der quartäre Sektor [Der sog. quartäre Sektor wird hier im wesentlichen auf der Basis des Produktionsfaktors Informa tion definiert (Informationserstellung, -verarbeitung, -verteilung) ] , wobei in der Gesamtbilanz einem stetigen Plus bei der Wertschöpfung regelmäßig ein Defizit bei den Arbeitsplätzen gegenübersteht. Diese Veränderungen - gemeinhin als Strukturwandel bezeichnet - sind Krise und Chance zugleich: Krise, weil in der Regel bestimmte Branchen und Regionen konzentriert betroffen sind und weil vergleichbare neue Potentiale nur ausnahmsweise zeitgleich aufgebaut werden können. Chancen ergeben sich vor allem deshalb, weil knappe Ressourcen in produktivere Bereiche gelenkt werden können. Aus Sicht des Hauptgeschäftsführers der Industrie- und Handelskammer (IHK) Essen sind hier vor allem folgende Eckpunkte zu beachten:
- Die Rolle der Politik. Strukturpolitik, wie sie letztlich Ende der 60er Jahre erstmals definiert worden sei, müsse sich im marktwirtschaftlichen Rahmen bewegen. Sie sei aber legitimiert, bei regionalen arbeitsmarktlichen bzw. sozialen Härten mildernd - nicht verhindernd - einzugreifen. Dementsprechend fänden auch die an den deutschen Steinkohlebergbau gezahlten und noch zu zahlenden Subventionen hier dem Grunde nach ihre Berechtigung.
- Das Bewußtsein für übergeordnete Entwicklungen. Die für die OECD-Staaten insgesamt aufgezeichneten Trends gälten auch für Deutschland. Der Anteil der Dienstleister an den Erwerbstätigen und am BIP wachse ständig, die Landwirtschaft verliere weiter, die Industrie habe bis in die Mitte der 70er Jahre im Mittel noch gewinnen können, zeige aber seitdem mehr oder minder gleichmäßige Verluste.
- Die Grenzen einer klassischen sektoralen Betrachtung. So verstelle beispielsweise der durchaus interessante Vergleich zwischen dem Rückgang des verarbeitenden Gewerbes gegenüber dem Anstieg der Dienstleistungen bei insgesamt steigendem Bruttosozialprodukt den Blick auf den Produktionsfaktor Information, der vor allem bei globalen und komplexeren wirtschaftlichen Tätigkeiten ungleich wichtiger werde.
Aus Sicht eines modernen, zukunftsträchtigen Dienstleistungsunternehmens des „quartären" Sektors hingegen stellt sich der Strukturwandel vor allem als Konse-
[Seite der Druckausg.: 43]
quenz menschlicher Verhaltensweisen und Entscheidungen dar: Erfolg bezieht die Inhaberin und Geschäftsführerin der erfolgreichen Neugründung „assistenz business centers gmbh" [Die Assistenz Business Centers GmhH bietet in mittlerweile vier Städten in NRW ihre Dienste an. Im wesentlichen handelt es sich um Dienstleistungszentren für Büro- bzw. Verwaltungsaufgaben, in denen zeitlich befristete Rundumangebote von der Anmietung von Büroräumen über Sekretariats dienst leistungen (einschließlich Rufumleitung und Bearbeitung von Anfragen in Zeiten der Abwesen heit der sonst dafür Zuständigen) über Krankheits- oder Schwangerschaftsvertretungen bis hin zu virtuellen Geschäftsadressen im Mittelpunkt stehen.] weniger auf so abstrakte Dinge wie etwa die Einführung moderner Wirtschaftsstrukturen als vielmehr darauf, inwieweit Menschen in dieser Gesellschaft in der Lage seien, serviceorientiert zu denken, u.a. um attraktiver für ihre Kunden zu werden. Der vielzitierte Bezug zur produktorientierten Dienstleistung anstelle des Produktes gehe hier nicht weit genug. Statt dessen müsse der Mensch selbst in den Mittelpunkt aller wirtschaftlichen Überlegungen gestellt werden. So kauften Menschen letztlich von denjenigen Mitmenschen, die sie mögen - häufig spiele der Preis erst danach eine Rolle, sofern er in einem vertretbaren Rahmen bleibe. [Anm.: Diese Sicht erscheint attraktiv, jedoch auch idealisiert. Es wird nicht berücksichtigt, wie sehr in einer einseitig an Konkurrenz orientierten Gesellschaft geldwerte Vorteile mit darüber bestimmen, wen man mag.]
Schließlich und endlich sei das eigene Gehirn nach ihrer festen Überzeugung die wichtigste Instanz in der Gestaltung oder besser im Zustandekommen der wirtschaftlichen Entwicklung. Ein solcher Denkansatz wirke sich in dramatischer Weise nicht nur auf die Geschäftsbeziehungen zu anderen Unternehmen und Privatkunden aus, sondern verändere auch die Arbeitsbedingungen entscheidend zum Positiven. Die üblichen, von Unternehmern als Hemmnisse ins Feld geführten Aspekte wie z.B. die Fülle an Gesetzen und Verordnungen bzw. Bürokratie im allgemeinen, Unstetigkeit in politischen Entscheidungen, die Haltung von Gewerkschaften, Medien etc. seien letztendlich in hohem Maße auf menschliches Verhalten, auf Ängste ebenso wie auf Lust, auf den Willen zur Verbesserung von Zuständen bei allen Beteiligten zurückzuführen. Erfolg hänge dementsprechend nicht nur vom „Faktor" Mensch im Sinne des fakturierbaren Menschen bzw. der Einführung einer vollständigen Monetarisierung ab, sondern vom Wohlgefühl des Einzelnen, das wiederum auf der Attraktivität des gesellschaftlichen und damit auch des wirtschaftlichen Miteinander basiere.
Oft sei z.B. innovative Technik benutzerunfreundlich, bzw. die Betreuung dieser Technik lasse zu wünschen übrig. Als Beispiel nennt die Unternehmerin aus ihrer Sicht unzureichende Dienstleistungen der Deutschen Telekom rund um die bei ihr eingesetzten Telefonanlagen. Diese Anlagen seien für jeden nachvollziehbar von zentraler Bedeutung für ihre Unternehmen – so sei es unerläßlich, daß man flexibel in der Schaltung sei und bestimmte Veränderungen für die Kunden sehr schnell umsetzen könne, z.B. die Umlegung einer Nebenstelle, die Schaltung einer neuen Ruf-
[Seite der Druckausg.: 44]
nummer oder die Einrichtung eines neuen Geschäftszweiges. Hier hätten sie und ihre Mitarbeiterinnen häufig Probleme mit den zuständigen Stellen, und offenbar sei dies kein Einzelfall, denn über derartige Hemmnisse könne man leider fast jeden Tag etwas in der Zeitung lesen.
Immer häufiger müsse man feststellen, daß der Mensch nicht in der Lage sei, sich den ständig steigenden Anforderungen des Marktes anzupassen. Technik entwickle sich weiter, unser Gehirn aber könne mit der Beschleunigung nicht länger Schritt halten. Aus diesem Grund hätten die meisten Unternehmen mit wachsenden Schwierigkeiten in Bezug auf ihre menschlichen Ressourcen zu kämpfen. Im Grunde sei bereits die klassische Einteilung des Wirtschaftens in Bereiche wie Produktion und Dienstleistung problematisch bzw. werfe ein falsches Licht auf die Dinge: Ertrag, egal in welchem Bereich, werde letztlich von Menschen für Menschen erbracht. In diesem Sinne betreibe eigentlich jeder Mensch sein eigenes Dienstleistungsunternehmen.
Folgt man der Sicht der Unternehmerin, daß sich alle als Dienstleister verstehen sollen, wäre Dienstleistung als statistisch zu erfassender Sektor in letzter Konsequenz natürlich zwangsläufig in Auflösung begriffen.
[Die Unschärfe des Begriffes Dienstleistung und der Tätigkeiten, die aus verschiedenen Sicht weisen darunter subsummiert werden, wird auch an anderer Stelle deutlich. So weist der Vorstands vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Techno logie- und Gründerzentren (ADT) darauf hin, daß in dieser Hinsicht auch die Statistik überaltert sei: Begriffe wie Dienstleistung stimmten nicht mehr, wenn z.B. ein Unternehmen mit insgesamt 400 Mitarbeitern im Sektor "Entwicklung und Produktion von cmos-Technologie" bei der IHK als Dienstleister geführt würde, obwohl 250 Mitarbeiter in der Produktion beschäftigt seien.]
Eine solcher Denkansatz ist aber nach ihrer eigenen Einschätzung noch weit von einer breiten Realisierung entfernt. Die meisten dächten immer noch, daß sie für irgend jemand Anderes als sich selbst arbeiteten, z.B. für denjenigen, der ihr Gehalt am Monatsende bezahle. Diese Einstellung trage wesentlich dazu bei, daß Deutschland immer noch eine Dienstleistungswüste sei.
In Ergänzung zu den weitgehend selbstverständlichen Investitionen in technische Funktionalität muß daher nach Ansicht der Unternehmerin mindestens ebenso sehr in die Wartung und Optimierung der fachlichen und persönlichen Fähigkeiten von Mitarbeitern investiert werden. Dies sei eine grundlegende Leitlinie in ihrem eigenen Unternehmen [mit mittlerweile 60 Beschäftigten, davon 58 Frauen und 2 Männer (Stand August ‘ 99)] , denn das Entwicklungspotential von Mitarbeitern werde immer entscheidender, weniger ihre Funktion, die sich zunehmend rasch ändern könne. Es komme darauf an, den aus dem Marketing bekannten Begriff der „unique selling proposition" auf jedes einzelne „Dienstleistungszentrum", d.h. jeden Mitarbeiter bzw. jede Mitarbeiterin herunterzubrechen.
[Seite der Druckausg.: 45]
Um diese Einzigartigkeit, die jedes Unternehmen im Wettbewerb von den anderen abhebe, auch für die Menschen unmittelbar nachvollziehbar zu machen, sei eine offene Kommunikation unbedingte Voraussetzung, die allerdings strukturiert geführt werden müsse. In ihrem Unternehmen gebe es daher außer einem Jahresgespräch, in dem Ziele für die kommenden 12 Monate festgelegt würden, auch wöchentliche Rücksprachen, möglichst mit jedem einzeln, sowie monatliche Teamsitzungen, die jeweils strukturiert und zeitlich begrenzt stattfänden. Darüber hinaus seien selbstverständlich Fortbildungen und Trainings zu Themen wie Organisation, Kommunikation, Vertrieb und EDV eine ebenso entscheidende Grundlage, um die eigene Verantwortlichkeit und die Eigenmotivation zu fördern.
Die Folgen dieses Ansatzes für die Qualität der Dienstleistung seien, daß die Mitarbeiterin lerne, nicht nur Kunden als Kunden zu verstehen, sondern sogar Kollegen und ihre Chefin als Kunden zu betrachten. Erfahrene Coaches, die ihre Akteure spielerisch in die Umsetzung einbezögen, täten ein übriges, damit alle Beteiligten ihre jeweilige Rolle bewußt leben und mögen könnten. Damit werde für den Einzelnen „Jobfähigkeit" (employability) erreicht, beziehe man aber diese klaren Vorgaben auf die Makrowelt, so seien letztlich noch sehr viel weitergehende Ziele zu erreichen, von einer Verringerung der Arbeitslosenzahlen über eine Senkung der staatlichen Alimentierung und eine Erhöhung der Steuereinnahmen bei steigender Kaufkraft bis hin zur Steigerung der sozialen Zufriedenheit bzw. einer allgemeinen Verbesserung der Stimmung im Land.
Auf die Frage des Veranstalters, was sie politisch am meisten störe, antwortet die Unternehmerin, die Arbeitnehmerüberlassung stoße auf zu viele Hemmnisse, vor allem auch in den Köpfen, dementsprechend säßen Vorurteile tief. Zeitarbeit sei mittlerweile der größte Arbeitgeber weltweit, und die Gesetze in Deutschland würden dieser Entwicklung nicht gerecht. Beispielsweise seien sie zu eng in Bezug auf die Beschäftigungsdauer gefaßt, die maximal ein Jahr betrage. Zwischen traditionellen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hingegen dürften zeitlich befristete Verträge längerer Dauer abgeschlossen werden, und jedes „normale" Unternehmen bekomme zudem mit Leichtigkeit 60 - 70% staatliche Förderung für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Die von der Unternehmerin ins Zentrum ihrer Betrachtungen gerückten Aspekte unterscheiden sich deutlich von den übrigen Darstellungen. Sogar nach Ansicht des Vertreters von ZENIT, das sich als Institution nachvollziehbar einem modernen Personalmanagement verschrieben hat, sind letztlich etablierte Ansätze einer vorbereitenden Marktforschung bis hin zur operativen Marketing-planung die entscheidenden Kriterien für den Erfolg eines Unternehmens. Dementsprechend stehen in der Regel angebotsorientierte Instrumente wie Marktrecherchen oder Vertriebskonzeptionen im
[Seite der Druckausg.: 46]
Vordergrund. Diese Sicht mag auf die stärkere Technologieorientierung zurückzuführen sein und kommt auch in der Einstellung zur Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologien zum Ausdruck. So liegt nach Darstellung des Referenten von ZENIT neben den allgemein üblichen Aktivitäten wie Förderung des Internet-Gebrauchs etc. ein wesentlicher Schwerpunkt darauf, auch die Wissensressourcen der Mitarbeiter besser nutzbar zu machen. Die Wissens- und Erfahrungswerte der Kunden hingegen bzw. die Optimierung der Beziehung Anbieter-Verbraucher finden offenbar keine besondere Berücksichtigung. [Die Rolle des Verbrau chers, der als intelli genter, gleichwertiger Partner in die Lage versetzt wird, sich im allgemeinen Infor ma tions überfluß ein sinnvolles Bild von den wichtigsten globalen Konse quen zen seiner Kaufent scheidung machen zu können, kommt in keinem der vorgestellten Ansätze adäquat zur Geltung.]
Auch in den Betrachtungen aus kommunalwirtschaftlicher Sicht spielen derartige Aspekte in der Regel keine Rolle. Hier dominieren ebenfalls klassische Indikatoren, z.B. Arbeitslosenzahlen im Vergleich zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in bestimmten Branchen, einschließlich eines Multiplikationsfaktors zur Erfassung der Wirkung auf andere Branchen, oder die erwarteten finanziellen Effekte durch Kaufkraftbindung infolge neuer Kommerzzentren in den Innenstädten. So soll beispielsweise die UFO genannte Überbauung des Dortmunder Hauptbahnhofs mit einem solchen Wirtschaftszentrum jährlich rund 330 Mio. DM einzelhandelsrelevanten Umsatz binden. Davon sollen allein 125 Mio. DM aus dem Dortmunder Umland in dieses Zentrum gelenkt werden. Die Folgen für die dort betroffenen Einzelhandelsstandorte bleiben aus Sicht des Vertreters der Dortmunder Wirtschaftsförderung - eines städtischen Eigenbetriebs - in einem verträglichem Rahmen.
[Diese Einschätzung wird seitens des RWI-Vertreters indirekt unterstützt, indem er darauf hinweist, daß sich die Krise der Montanindustrie mittlerweile zu einer Krise der Stadt entwickelt habe, in der es Randgebieten in der Regel besser gehe, vor allem in Hinsicht auf Arbeitsplätze.]
Insgesamt sei aber für Dortmund seit dem Niedergang des klassischen sog. „Dortmunder Dreiklangs"
[Das Bild bezieht sich auf die drei im Mengenausstoß fast gleichwertigen Bereiche Kohle, Stahl und Bier, die für viele Jahre das Gesicht und die Identität der Stadt Dortmund prägten. So hatte Dortmund in den besten Jahren dieses „Dreiklangs„ einen Ausstoß von ca. 7,4 mio. t Steinkohle, 7,5 Mio. Hektoliter Bier und 7 Mio. t Stahl. ]
vor allem die Hinwendung und Förderung zu zwei Wirtschaftssektoren vorrangig: Erstens die Kommunikations- und Medienwirtschaft mit Schwerpunkten in Software-Entwicklung und e-commerce). Hier gehöre Dortmund mit über 17.500 Arbeitsplätzen und über 5.000 Studierenden bundesweit zur Spitze. Zweitens die Logistik, in dem Dortmund für den Bereich Forschung, Entwicklung und Lehre nach Einschätzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG bundesweit Spitze sei. Als weitere Schwerpunkte mit deutlichen Synergieeffekten zu den beiden genannten Sektoren seien die Bereiche Robotik und Mikrosystemtechnik in raschem Aufbau begriffen.
[Seite der Druckausg.: 47]
Mit dem Ausbau entsprechender Aktivitäten in Dortmund sei man zuversichtlich, einen substantiellen Beitrag zur Reduzierung der Arbeitsmarktlücke zu leisten. [Betrieben wird der gesamte Prozeß der Wirtschaftsförderung weitgehend in kommunaler Regie, konsequent ist die Wirtschafts- und Beschäftigungs förde rung Dortmund keine GmbH, sondern ein Eigen betrieb der Stadt – der aber im Sinne eines sozialverträglichen Wirtschaftens konsequent unter neh me ri sche Gesichtspunkte zur Grundlage seiner Aktivitäten macht. Aus diesem Grund wird das Beispiel an dieser Stelle und nicht im Teil 2.2 „ ... aus politischer Sicht„ abgehandelt.]
Angesichts ähnlicher Darstellungen aus anderen Ruhrgebietsstädten stellt der Moderator Dr. Frech die Frage, inwieweit es Sinn macht, daß mehrere Standorte konkurrierend die gleichen Aktivitätsfelder zu Schwerpunkten ihrer wirtschaftlichen Entwicklung respektive Wirtschaftsförderung machen.
[In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, inwieweit die staatliche bzw. kommunale Wirtschaftsförderung überhaupt noch an Standortentscheidungen der zumeist privaten Investoren mitwirken kann. Hierzu vergleiche Kap. 2.2 „ ... aus politischer Sicht„.]
So legt z.B. Duisburg ebenso wie Dortmund einen besonderen Schwerpunkt auf das breite Aktivitätsfeld rund um das Thema Logistik, und fast alle großen Ruhrgebietsstädte einschließlich der angrenzenden Städte wie Düsseldorf, Köln oder Bonn haben das Thema Information und Kommunikation für sich entdeckt. Hier werden bei den Referenten unterschiedliche Einschätzungen deutlich: Die Stellungnahmen reichen von Appellen zur stärkeren Kooperation bis zu der Einschätzung, daß es falsch sei, gleichzeitig vier bis fünf Medienstandorte etablieren zu wollen.
Im einzelnen wird gefordert, die lokalen Akteure besser zu vernetzen, z.B. die Kompetenzen in der Förderung enger zusammenzubringen. Dazu müsse allerdings, so der Hauptgeschäftsführer der IHK Essen, ideologiefrei über Interessen(-gruppen) hinweg agiert werden - eine Forderung, die angesichts der immer noch vorherrschenden traditionellen Strukturpolitik beinahe idealistisch erscheine. Es seien grundlegend neue Ansätze erforderlich, um das zu initiieren, und einige Symbolprojekte, z.B. die Zeche Zollverein in Bochum, ließen hoffen. Den Erfolg derartiger Projekte hätte vor 15 Jahren noch niemand für möglich gehalten. Der Vertreter des RWI gibt darüber hinaus zu bedenken, daß in diesem Zusammenhang auch die Arbeitsteilung zwischen Kommunen, Ländern, dem Staat und der EU neu überdacht werden müsse. Insgesamt habe eine kooperative Arbeitsteilung wie sie häufig gefordert werde, im Gegensatz zu einer eher thematischen Arbeitsteilung wie in den USA schon rein zahlenmäßig ihre Grenzen.
Nach Ansicht des Geschäftsführers der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Technologiezentren ist es grundsätzlich richtig, wenn im produktiven Bereich klare regionale Schwerpunkte innerhalb des Ruhrgebietes gesetzt werden. So habe es sich z.B. als gut erwiesen, das Stahlgeschäft auf Duisburg zu konzentrieren, ähnliches müsse nun auch für die Kohle etc. bedacht werden. Zur Rolle der in dieser Hinsicht umstrit-
[Seite der Druckausg.: 48]
tenen Regionalkonferenzen äußert er sich im Prinzip positiv, lediglich viele der dort diskutierten Inhalte seien nicht zielführend. Im übrigen glaube auch er daran, daß mit einer besseren Vernetzung der Standorte und der unterschiedlichen Akteure viel erreicht werden könne. Dies trage u.a. dazu bei, daß Kompetenzen gestrafft werden könnten und sich entscheidungsorientierte Strukturen herausbildeten, die nicht an der Kommunalgrenze haltmachten. Als Projekt mit besonderem Potential erwähnt der Geschäftsführer des KVR in diesem Zusammenhang die hunderte Kilometer zusammenhängendes Schienennetz der Montanwirtschaft, die das gesamte Ruhrgebiet durchzögen und die weitgehend brachlägen. Ein anderes Beispiel ist nach Auffassung des Vertreters des RWI die besondere Situation in Gelsenkirchen, daß bei über 18% Arbeitslosen selbst quasi keine Flächen zur Verfügung habe, so daß hier eine enge Zusammenarbeit mit dem angrenzenden Kreis Recklinghausen und die Berücksichtigung von Pendlerstrukturen unerläßlich sei. Dennoch könne man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Kooperationsbereitschaft gering sei, obwohl das Ruhrgebiet nicht mehr recht wisse wohin - die Tagung reflektiere gewissermaßen die schlechten Zustände.
Ein Blick nach Pittsburgh zeigt nach übereinstimmender Auffassung aller Diskutierenden, daß die Region dort sehr viel homogener gegenüber potentiellen Investoren auftritt. Um auf der globalen Bühne eine erfolgreiche „Außenpolitik" im Sinne einer durchdachten und auf Nachhaltigkeit geprüften Akquisition von unternehmerischen Aktivitäten zu betreiben, hält der Vertreter der Pittsburgh Regional Alliance (PRA) ein breites und gut koordiniertes Spektrum an Dienstleistungen für unerläßlich. Das Spektrum reiche von Online-Angeboten über Werbung hinsichtlich der regionalen Vorzüge bis zu einem maßgeschneiderten Consulting für Unternehmen, die z.B. eine Gewerbefläche suchen. Nach innen wirke die PRA als Koordinator und Mediator zwischen so verschiedenen Akteuren wie der kommunalen Infrastrukturplanung, der Tourismusagentur, der Handelskammer und anderen Beteiligten.
Um dieses komplexe Tätigkeitsspektrum strukturieren zu können und um allen Beteiligten eine gemeinsame Richtschnur vorzugeben, hatte sich die PRA im Jahr 1997 entschlossen, mit Unterstützung von McKinsey einen Aktionsplan für die Region zu erarbeiten, mit dessen Hilfe sie die wirtschaftliche Entwicklung dramatisch zu beschleunigen hoffte. Der ursprünglich auf fünf Jahre angelegte Aktionsplan unter dem Namen „A Marketing Strategy and Action Plan to Accelerate Economic Growth in Southwestern Pennsylvania" war und ist nach Einschätzung des Vertreters der PRA ein großer Erfolg, mit dessen Hilfe bis heute geschäfts- bzw. imagefördernde Maß-
[Seite der Druckausg.: 49]
nahmen umgesetzt werden.
[Die PRA hat sich mittlerweile entschlossen, ihre Programme aufgrund besserer Controlling-Möglichkeiten jährlich fortzuschreiben und hat den geographischen Fokus auf ein Gebiet rund um Pittsburgh eingeschränkt.]
Eines der zentralen Ziele war die Schaffung von 77.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Region, in Ergänzung zu den ohnehin aufgrund des allgemeinen Wirtschaftswachstums prognostizierten 43.000 neuen Arbeitsplätzen. Als wichtigste Instrumente werden die Förderung von Humankapital und einer regionalen „Corporate Identity" gesehen.
Seitens eines Zuhörers wird darauf hingewiesen, daß eine derart homogene Corporate Identity wohl kaum auf das Ruhrgebiet übertragbar sei - die Städte ständen wie geschildert in erheblicher Konkurrenz zueinander. Der Vertreter der PRA antwortet, natürlich sei das auch in Allegheny County und Umgebung nicht ganz problemlos, aber zuvorderst gehe es doch darum, potentiellen Investoren ein erstes attraktives Bild zu vermitteln, und da sei die Pittsburgher Skyline eben ein gemeinsames Symbol, hinter dem sich alle versammeln könnten. Weitergehend gibt er zu bedenken, daß, wenn man die Phase der reinen Überlebensstrategien hinter sich lassen wolle oder hinter sich gelassen habe, eine positive Sicht der Dinge entscheidend an Wert gewinne. In der Regel sei ein zu lange andauerndes Festhalten an alleiniger Hemmnis- bzw. Problembewältigung zu beobachten. Dies müsse ergänzt bzw. ersetzt werden durch Betrachtungen, wohin die Region bzw. die Individuen gerne gehen möchten, zu was sie werden möchten.
Aus dem Publikum heraus wird in diesem Zusammenhang weiter kritisiert, daß bei den gängigen technologie- oder faktenorientierten Betrachtungen häufig die emotionale Seite zu kurz komme. Es sei lange nicht alles so rational, wie es gemeinhin dargestellt werde, und u.a. sei entscheidend, welche Schlüsselpersonen mit welchem Erfahrungs- und Lebenshintergrund hinter bestimmten Entscheidungen stünden. Diese Kritik bezieht der Referent für die Region Lille auf die häufig diskutierte Rolle der französischen Regierung als dirigistisch-planerischer Institution und antwortet, daß zwar die Idee ursprünglich von der Regierung kam, daß aber nach über 20 Jahren die Region selbst zum tragenden Faktor geworden sei.
[Er geht dabei allerdings nicht auf die Rolle des Bürgermeisters von Lille ein, der in diesem Zusammenhang als Schlüssel person beschrieben wird. So heißt es im Economist (a.a.O.): „The city’s renaissance owes much to the craftiness of Pierre Mauroy, mayor and political baron of Lille since 1973, who, at hefty public cost, persuaded his socia list friends to lay the TGV track from Paris to the Channel Tunnel along a dog-legged detour through Lille.„]
Der Vertreter der Universität Jena weist darauf hin, daß für ihn die Frage der Strategiefähigkeit von Parteien und Verbänden im Vordergrund stünde, deren Bereitschaft zum Reagieren oft erst angesichts massiver Krisen gegeben sei. Darüber hinaus seien naturgemäß persönliche Faktoren wichtig. Entscheidend seien jedoch die Rahmenvorgaben. Stimme der Rahmen nicht, könnten auch die besten Leute nichts machen. Auch der
[Seite der Druckausg.: 50]
Direktor von CEPS/INSTEAD äußert sich zurückhaltend zur Bedeutung der Schlüsselpersonen. Natürlich gebe es wichtige Personen, es sei aber Vorsicht geboten, ihnen zuviel Einfluß zuzuschreiben. Weil sich Wirkungen immer auf viele verteilten, sei letztlich die allgemeine Stimmung ebenso entscheidend.
Unter dem Strich bleibt festzustellen, daß die Dynamik der tertiären bzw. quartären Sektors nicht ausreicht, um die Verluste der Industrie bei den Arbeitsplätzen auszugleichen. Dies, ebenso wie die Ungleichgewichte in den Eignungs- und Anforderungsprofilen und auch ein geändertes Erwerbsverhalten erklärt nach Einschätzung des Vertreters der IHK Essen die hohe Arbeitslosigkeit in den vom Strukturwandel besonders betroffenen Hochburgen der industriellen Produktion. Fest stehe, daß der Sektor der industriellen Produktion sowohl in Hinsicht auf die Wertschöpfung als auch in Hinsicht auf die Arbeitsplätze weiter auf dem Rückzug sei. Man dürfe allerdings daraus keine falschen Schlüsse ziehen und z.B. nicht die Aktivposten übersehen: Nach wie vor sei die Industrie der Exportmotor Nummer Eins: Seit über 25 Jahren liege der Anteil der Güter des produzierenden Gewerbes am gesamten Export bei rund 90%. Ebenso werde nach wie vor fast die Hälfte aller Auszubildenden in gewerblich-technischen Berufen ausgebildet. Diese Tatsachen dürfen in Zeiten wachsender Märkte in Schwellenländern wie z.B. China zweifellos nicht vernachlässigt werden, und auch der Vertreter des RWI kommt zu dem Schluß, daß die Beibehaltung und Förderung industrieller Kerne unerläßliche Voraussetzung für ein Prosperieren des Dienstleistungssektors sei.
[Seite der Druckausg.: 51]
2.2 ... aus politischer Sicht
Strukturpolitik für das Ruhrgebiet ebenso wie für die anderen Regionen steht vor einem Paradigmenwechsel - darüber sind sich im Grundsatz alle Referenten einig. So weist der Vertreter des Arbeits- und Stadtentwicklungsministeriums in NRW zu Recht darauf hin, daß sich im Rahmen des allgemeinen Strukturwandels derzeit auch Theorie und Praxis der Raumwirtschaftspolitik neu definieren. Sowohl die Zielsysteme als auch die organisatorischen und methodischen Rahmenbedingungen der regionalen Entwicklungspolitik befänden sich im Wandel. Offensichtliche wie scheinbare Widersprüche seien bereits auf der Leitbildebene vielfältig, z.B. gebe es:
- Die soziale Stadt. Anspruch ist es hier, die zunehmende sozialräumliche Differenzierung auszugleichen, um den Aufbau räumlicher Barrieren in den Städten zu verhindern. Positiv gesehen bedeute dies, die Funktionsfähigkeit der „Integrationsmaschine Stadt" aufrecht zu erhalten.
- Die freizeitorientierte Stadt. Die Zielkonzeption setzt vorrangig darauf, die derzeit ausgesprochen große Dynamik im Freizeitsektor für Ziele der Stadtentwicklung zu nutzen, insbesondere im Sinne einer Wiederbelebung der Stadtzentren. Dabei wird naturgemäß angestrebt, städtische Entwicklungspolitik mit wirtschaftlichen Entwicklungen zu synchronisieren.
- Die technologieorientierte Stadt. Impulse des technologischen Wandels sollen stadt- bzw. regionalverträglich nutzbar gemacht werden. Dazu werden vor allem technologische Leitprojekte unterstützt.
- Die kommunikative/virtuelle Stadt. Dieses Leitbild zeigt erhebliche Überschneidungen mit der technologieorientierten Stadt, wobei hier die Auswirkungen auf das soziale Gefüge im Vordergrund stehen. Zum einen entwerten neue IuK-Techniken den herkömmlichen öffentlichen Raum, zum anderen aber führen sie zur Herausbildung neuer Qualitäten, die auch erhebliche Potentiale für städtische bzw. regionale Qualitäten aufweisen. Ziel ist es hier, die Dezentralisierungspotentiale der IuK-Techniken für ein neues Urbanitäts- bzw. Regionenverständnis zu nutzen.
- Die ökologische Stadt. Analog zur Diskussion um das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung stehen Begriffe wie „Ressourcenschonung", „Kreislauforientierung", „Rückholbarkeit" und „Integration von Umweltaspekten in soziales und wirtschaftliches Geschehen" im Vordergrund dieses Ansatzes.
Diese vielfältigen Leitbilder entwickeln sich räumlich wie zeitlich versetzt. Charakteristisch ist, daß bislang keines der älteren Leitbilder zugunsten eines Neuen vollstän-
[Seite der Druckausg.: 52]
dig aufgegeben wurde, sondern daß sich in der Regel lediglich Handlungsschwerpunkte verschoben haben. Insofern hat zumindest bis heute ein echter Paradigmenwechsel noch nicht stattgefunden, denn schließlich impliziert er zwangsläufig einen Bruch mit alten Ansätzen. Weitergehend ist nach Ansicht des Referenten das Leitbild „Die Stadt der Internationalen Bauausstellung". Der zentrale Denkansatz dieses Leitbildes liege darin, durch eine neue Form des Managements von Veränderungen vor allem punktuelle Entwicklungsimpulse geben zu können, die sich bei weitestmöglichem Erhalt von Eigendynamik zu einer Gesamtstrategie der Innovation verbinden lassen. Die bisherigen Leitbildmodifikationen spiegelten sich naturgemäß auch in den stetig wechselnden Programmen der Politik. Hemmnisse und Potentiale dieser Entwicklung könnten beispielhaft an den Schwerpunktsetzungen der Landesregierung NRW im Laufe der Jahre verdeutlicht werden:
- So folgte etwa dem Ruhrprogramm von 1968 das Nordrhein-Westfalen-Programm von 1975, denn jedes für das Ruhrgebiet gedachte Programm weckte Begehrlichkeiten im Rest des Landes, und die Politik mußte darauf eine Antwort finden. Politische Machtverhältnisse und die Bewußtseinslage der Bevölkerung kommen nach Einschätzung des Vertreters des Wirtschaftsministeriums NRW in vielen Diskussionen um die Strukturpolitik für alte Industrieregionen zu kurz.
- Die nächste programmatische Veränderung setzte mittels des Aktionsprogramms Ruhrgebiet ab 1979 einen stärkeren Schwerpunkt auf den Technologietransfer, denn infrastrukturelle Verbesserungen wie z.B. der Bau von Hochschulen erwiesen sich als nicht hinreichend für die Diffusion von Forschungsergebnissen in die Unternehmen. Damit wurde auch der erste Schritt weg von der vorrangigen Steuerung harter Faktoren wie Baumaßnahmen, Bereitstellung von Gewerbeflächen etc. hin zu einer Förderung weicher Standortfaktoren wie z.B. Vernetzung getan.
- Der Beginn der 80er Jahre war nach Einschätzung des Vertreters des Wirtschaftsministeriums NRW vor allem von einem Bewußtseinswandel in der gesamten Region gekennzeichnet. Die Konzentration auf das Neue stand im Vordergrund, und über die Politik hinausgehende Initiativen wie der Unternehmensverband Pro Ruhrgebiet oder die „Expertenkommission Montanregionen" waren zeittypisch. Dieser qualitative Sprung sei letztlich zur Grundlage für die ab 1987 durchgeführte Zukunftsinitiative Montan-Regionen oder die 1989 ins Leben gerufene IBA-Emscherpark geworden.
Für jede Diskussion, jeden Prozeß zur Entscheidungsfindung muß dabei nach Aussage des Vertreters des Arbeits- und Stadtentwicklungsministeriums NRW berück-
[Seite der Druckausg.: 53]
sichtigt werden, daß sich nicht nur die inhaltlichen Rahmenvorgaben, sondern auch das Selbstverständnis der Regionalplanung weitgehend verändert hätten:
- Die finanziellen Handlungsspielräume der öffentlichen Hände seien eng begrenzt. Somit würden die Entwicklungspfade der Stadtentwicklung in erster Linie durch private Investoren bestimmt, und kommunale bzw. regionale Politik wandelt sich zwangsläufig von der Ordnungsinstanz zur Moderatorenfunktion. Damit verliere auch die traditionelle Arbeitsmethodik der öffentlichen Planung ihren Rahmen. Die Produktion von raumbezogenen Plänen weiche ebenfalls dem Bedarf nach Moderation und Mediation, und parallel zur Verlagerung der Investitionsdynamik vom öffentlichen in den privaten Sektor gewinnen Strategien des Public-Private-Partnership an Bedeutung.
- Die für eine nachhaltige Entwicklung zwingend erforderliche Langfristorientierung stehe angesichts der mittlerweile weltweit postulierten ökonomischen Flexibilität unter Druck. Stadtentwicklungspläne mit mehrjährigen Zielfestlegungen würden zunehmend als unflexible und den wirtschaftlichen Notwendigkeiten nicht angepaßte Selbstbindungen interpretiert, die der Wettbewerbsfähigkeit schaden.
- Einem allgemeinen Trend folgend werde auch der Erfolg kommunaler bzw. regionaler Steuerungsmodelle zunehmend an konkret meßbaren, zumeist wirtschaftlichen Indikatoren gemessen. Wesentliche Produkte der Regionalplanung wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperation und Wohlergehen der Bürger ließen sich allerdings quantitativ nur bedingt nachweisen.
Als Folge der mit auf diesen Entwicklungen beruhenden populären Kritik an Bürokratie und Politik höre man immer häufiger die Forderung nach der Abschaffung von Planungsämtern. Deregulierung, mehr Entscheidungsfreiheiten für Bürger und Investoren, das seien Forderungen, von denen man annehmen dürfe, daß sie mittlerweile eine breite Zustimmung in der Bevölkerung finden. Derartige Forderungen sind aber nach Einschätzung des Vertreters des o.g. nordrhein-westfälischen Ministeriums in der Regel zu pauschal und berücksichtigen vor allem nicht, daß sich durch die genannten Veränderungen nicht nur Restriktionen ergeben, sondern daß im Gegenteil die Chance zur Neugestaltung ebenso darin ruht. So könne Stadtentwicklungspolitik vor dem Hintergrund der neuen Anforderungen nunmehr dynamischer, in neuen Handlungsfeldern, fachlich integrativer und in neuen Akteurskonstellationen agieren. Wesentliche Eckpunkte der regionalen bzw. Stadtentwicklungspolitik des Landes NRW stellen sich demzufolge wie folgt dar:
[Seite der Druckausg.: 54]
- Kleinräumige Strukturen (also z.B. Stadtteile, Nachbarschaften etc.) scheinen zu den großen Verlierern der Globalisierung bzw. der neuen Entwicklungen auf der Basis von Informations- und Kommunikationstechniken zu gehören. Gleichsam als unvermeidliche Gegenentwicklung wird aber das konkrete Bedürfnis nach Nachbarschaft durch das Gefühl einer zunehmenden Abhängigkeit von gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen und Kontrollverlust gestärkt. So dürfte es beispielsweise kaum zufällig sein, daß Diskussionen um kommunitaristische Ansätze in der Bundesrepublik derzeit eine Renaissance erleben.
- Das Dezentralisierungspotential der neuen Kommunikationstechnologien bietet zweifellos auch die Chance zu neuen Formen der Öffentlichkeit z.B. in Ballungsrandgebieten, es bleibt aber abzuwarten, welche Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens sich infolge der technologischen Möglichkeiten letztlich konkretisieren. Zur Zeit stehen isolationistische Tendenzen bzw. soziale Fragmentierung im Vordergrund. So zeigt die Erfahrung, daß sich auch im Ruhrgebiet immer größere zusammenhängende Gebiete in einer Wechselwirkung zwischen infrastrukturellen Defiziten, wirtschaftlichen Ungleichgewichten und sozialen Problemen zu einer Abwärtsspirale aggregieren. Unter dem Stichwort „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf" sind derartige Bereiche notwendigerweise zu einem Schwerpunkt der Stadterneuerungspolitik geworden.
- Als wesentlichster Handlungsansatz gilt diesbezüglich in NRW die Zusammenführung bzw. das Synchronisieren der unterschiedlichen staatlichen Politik- und Subventionsbereiche mit dem Ziel, die Abwärtsspirale aufzuhalten und durch die Wiederherstellung eines Mindestmaßes an positiven Zukunftsoptionen die Handlungsfähigkeit der dort lebenden Menschen zu aktivieren. Stadterneuerungspolitik steht damit zunehmend im Zeichen einer räumlichen Ausgleichspolitik, die im Interesse einer Gesamtstabilisierung marktbedingte Differenzierungsprozesse in Gewinner und Verlierer ausbalanciert. Es muß betont werden, daß es dabei nicht um planerische Restriktionen auf Mikroebene geht, sondern darum, durch geeignete Rahmenvorgaben und Mindeststandards großräumig zu verhindern, daß sich an einzelnen Brennpunkten die beschriebenen Abwärtsspiralen in Gang setzen.
- Die Strategie der Synchronisierung verschiedener staatlicher wie kommunaler Handlungsansätze bestimmt auch die Politik auf der räumlichen Ebene der Städte im Ruhrgebiet. Akute wie chronische Probleme der Großstädte im Ruhrgebiet sind ausgiebig beschrieben worden und daher im Kern bekannt: Hohe Arbeitslosigkeit, Verarmung, Defizite der lokalen Infrastrukturen, finanzielle Restriktionen der öffentlichen Hände, Hilflosigkeit traditioneller Instrumente der
[Seite der Druckausg.: 55]
öffentlichen Steuerung von Stadtentwicklungsprozessen sind nur einige Stichworte. Andererseits ist aber unverkennbar, daß sich im Zusammenhang mit der europäischen Integration und dem wirtschaftlich-technologischen Strukturwandel neue Optionen insbesondere für Großstädte bzw. Ballungsräume ergeben.
Kennzeichnend für diese „Renaissance der Metropolen" seien Standortentscheidungen großer, dynamischer Unternehmen der IuK-Branche, der Logistik und der Medienwirtschaft ebenso wie Hochschulen und Forschungsinstitute, die die Großstadtregionen zu Wissenszentren machten. In diesem Zusammenhang verfügt nach Ansicht des Vertreters des Arbeitsministeriums NRW das Ruhrgebiet auch im internationalen Vergleich über hervorragende Optionen. Dementsprechend habe sich das Investitionsvolumen in Bereichen wie Infrastruktur und Logistik, Finanzdienstleistungen und „Entertainmentwirtschaft" in den vergangenen Jahren deutlich vergrößert. Um diese Entwicklungen aufzugreifen und im Sinn einer nachhaltigen Entwicklung für das Ruhrgebiet zu verstetigen, gelte es aus strategischer Sicht, zentrale Leitlinien zur Weiterentwicklung der Städte im Ruhrgebiet vor allem im Bereich der Profilierung und der regionalen Arbeitsteilung zu verfolgen und vorrangig auf die Bereiche Kultur, Medien, Kommunikationstechnologie und Freizeit anzuwenden.
Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang der eingangs bereits erwähnte KVR, dessen Vertreter ein überwiegend kritisches Bild der Gesamtlage und der Handlungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene bzw. auch im Rahmen eines Kommunalverbundes zeichnet. Im Gegensatz zu Pittsburgh etwa ergebe sich besonderer regionaler Handlungsbedarf durch den ausgeprägten polyzentrischen Charakter der Region. Im hochverdichteten Raum Ruhrgebiet lebten rund 5,5 Mio. Menschen nicht in einer oder nur mit Bezug zu einer Metropole, sondern verteilt auf elf kreisfreie Großstädte und vier Kreise mit insgesamt 42 Kommunen. Ein gleichberechtigtes Nebeneinander ebenso wie gemeinsame Zieldefinitionen müßten deshalb mühsam und immer wieder neu erarbeitet werden, und es sei vor allem die Verantwortung des Landes, dem Ruhrgebiet eine dafür geeignete administrative Struktur an die Hand zu geben. Anstelle wechselnder Tagesparolen von aufzulösendem KVR bis zur Schaffung von Regionaldirektorenposten oder neuer Agenturen sei es entscheidend, dem Ruhrgebiet ein schlagkräftiges Dienstleistungsinstrument zur Seite zu stellen, das die Kommunen auf regionaler Ebene entlaste und voranbringe. Ein solches Instrument müsse nicht KVR heißen, entscheidend sei jedoch die angemessene Berücksichtigung des regionalen Know-How und die Zubilligung größerer formaler Kompetenzen durch das Land. Statt dessen sei zu befürchten, daß die Ruhrgebietskommunen im Rahmen des derzeit auf Landesebene diskutierten Reformmodells künftig für weniger regionale Leistung lediglich mehr bezahlen sollten.
[Seite der Druckausg.: 56]
Die Kritik wird im Grundsatz auch von anderen Referenten geteilt, es wird jedoch generell bemängelt, daß der Kritik offenbar zu wenig eigene zugkräftige Alternativkonzepte gegenüberstehen. So wird insbesondere das Fehlen von Angeboten einer gemeinsamen „Außenpolitik" im Sinne einer für die übrige Welt nachvollziehbaren und attraktiven Darstellung der besonderen Ruhrgebietsqualitäten vermißt. Kritische Stimmen aus dem Publikum weisen darauf hin, daß die Internet-Darstellung des KVR üblichen Marketingstandards nicht genüge – vor allem seien nicht einmal englischsprachige Seiten als erste Voraussetzung für die Wahrnehmung durch potentielle ausländische Investoren oder Besucher vorhanden. Desweiteren wird gefragt, welche Strukturen geschaffen werden müßten, um „Frühwarnsysteme", proaktive Information und Dialog zu fördern, und welche Akteure in diesem Zusammenhang identifiziert worden seien. Die Antwort lautet, daß die vorhandenen neun Verwaltungsebenen zu kompliziert seien. Viele Akteure wüßten nichts voneinander respektive von den jeweiligen Aktivitäten der anderen, insgesamt seien auch zu viele verschiedenen Kompetenzen vorhanden. Allein aus diesem Grund erscheine es attraktiver, anstelle des bisherigen KVR mit seinen wenigen Kompetenzen Dienstleistungszentren analog dem altem SVR-System [als Vorläufer des KVR existierte der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk SVR.] mit planerischen und Entwicklungskompetenzen einzurichten.
Allein aus finanziellem Druck heraus gebe es hier erheblichen Handlungsbedarf. So sind sich mehrere Referenten einig, daß beispielsweise die regionalpolitischen Fördermittel auf EU-Ebene spätestens mit der EU-Osterweiterung dramatisch abnehmen würden. Derartigen Entwicklungen kann nach Aussagen der Duisburger Oberbürgermeisterin letztlich nur durch ein eigenes, integriertes Konzept begegnet werden, mit dem Sachverstand und Handlungsfähigkeit unter dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung zusammengeführt werden könnten. Integration meine auch, daß in Zukunft noch stärker als bislang schon seit Jahrzehnten unter dem Schlagwort Public-Private-Partnership (PPP) diskutierte Konzepte zum Zuge kämen. Dies bedeute keinen Rückzug der Politik als gestaltende Kraft, sondern sei als Bekenntnis zu standortspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten in einer Zeit zu verstehen, die keinen Platz für Patentlösungen mehr biete. Ein typisches Beispiel für eine Einbeziehung der individuellen Standortqualitäten ist nach Auffassung der Duisburger Oberbürgermeisterin z.B. die Tatsache, daß trotz einer insgesamt nachlassenden Bedeutung des Montansektors die Stahlproduktion dennoch ein wichtiges Standbein für die individuelle Duisburger Situation bleibe.
Ein andere, auch im Ruhrgebietsverband individuelle Stärke von Duisburg sei zweifellos Europas größter Binnenhafen mit rund 15.000 Arbeitsplätzen. Nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt, daß in 200 km Umkreis 60 Mio. Europäer lebten, sei Duis-
[Seite der Druckausg.: 57]
burg prädestiniert als Logistikzentrum, zumal die Branche in Europa rund 175 Mrd. DM p.a. mit zweistelligen Wachstumsraten umsetze. Aufgrund der Lage des Hafens sei er überdies von zentraler Bedeutung für die Innenstadtentwicklung, so daß hier vielfältige Aktivitäten der kommunal- und regionalpolitischen Unterstützung bedürften. In diesem Zusammenhang sei z.B. die Förderung der Vernetzung mit den Aktivitäten der Mercator-Universität bzw. des Technologietransfers, z.B. in Form des Mikroelektronikparks in Duisburg-Neudorf mit seinem sehenswerten Zentralgebäude des Architekten Norman Foster, erwähnenswert. Um den Rhein respektive das Hafengelände mit der Innenstadt zu verbinden, sei u.a. auf einem Gelände von ca. 89 ha eine Mischbebauung mit Freizeitbezug geplant. Insgesamt gehe man soweit, ein ganzes Walzwerk zu verlagern, um im Stadtteil Duisburg-Hochfeld Raum für Tertiärfunktionen und einen ansprechenden Zugang zum Rhein zu schaffen. Damit finde der ideell ausgeprägte Rheinbezug – mit den Städten der Rheinachse wie Düsseldorf oder Krefeld verbinde Duisburg ohnehin mehr als mit dem klassischen Ruhrgebiet – auch verstärkt seinen räumlichen bzw. materiellen Ausdruck.
Positive Aspekte in der Bereitstellung von Gewerbeflächen sieht auch der Vertreter des Wirtschaftsministeriums NRW. Hier folge die Landesregierung schon seit vielen Jahren erfolgreich dem Grundsatz „Brache vor Freiraum" (vgl. auch Umweltaspekte unter Kap. 1.1). Um die vorhandene Infrastruktur nicht zu entwerten und vor allem den gewaltigen Ballungsraum von über 4.300 km2 nicht weiter ausufern zu lassen (vgl. auch den „urban sprawl" in Pittsburgh, Kap. 2.3), werde es auch weiterhin Aufgabe der Landesregierung bleiben, alte Industriebrachen mit gehörigem Mitteleinsatz so aufzubereiten, daß sie für neue Nutzungen zur Verfügung stünden. Beispiele in diesem Zusammenhang seien das CentrO in Oberhausen oder die geplante Überbauung des Dortmunder Hauptbahnhofs. Auch die Referenten aus anderen Städten des Ruhrgebiets nennen vergleichbare Umnutzungen: So stehe z.B. das Casa-Zentrum mit Einzelhandel, Spielbank und Stadion in der Nähe des Duisburger Hauptbahnhofs gleichermaßen unter dem Anspruch des direkten wirtschaftlichen Erfolgs wie auch einer Wiederbelebung der Innenstadt. Essen habe in diesem Zusammenhang in den vergangenen fünf Jahren in unveränderten kommunalen Grenzen rund 60.000 m2 Bürofläche neu errichtet.
An diesen kommunalen Beispielen mag die Vielschichtigkeit deutlich werden, an der Entscheidungen zur Standortförderung nach individuellen Vorgaben orientiert werden müssen. Trotz dieser vielfältigen und überwiegend auch erfolgreichen Maßnahmen weist das Ruhrgebiet allein aufgrund seiner Wirtschaftsgeschichte bis heute aber dennoch einige erhebliche Defizite auf, die nach Einschätzung des Vertreters aus dem Wirtschaftsministerium NRW ursächlich für eine trotz vieler Erfolge nach wie vor unbefriedigende Lage sind und somit zu den größten Herausforderungen
[Seite der Druckausg.: 58]
gehören: So sei beispielsweise die Zahl der Handwerksbetriebe im Ruhrgebiet besonders gering: In Bayern gebe es rund 100 Betriebe pro 10.000 Einwohner, in NRW durchschnittlich nur 70, im Ruhrgebiet sogar nur 60 Betriebe.
[Nach Aussage des RWI-Vertreters ist dieser Zustand weit über das Handwerk hinaus charak teristisch für die traditionell geringe Verflechtung des großindustriellen Montansektors mit klein- und mittelständischen Unternehmen. In den Montanunternehmen habe es immer einen besonders hohen Grad an Selbsterstellung von Leistungen gegeben.]
In diesem beschäftigungsintensiven Sektor seien die Potentiale noch nicht ausgeschöpft. Ähnlich schlecht sehe es mit den Bereichen Bildung und Ausbildung aus: So liege heute insbesondere im nördlichen Ruhrgebiet, z.B. in Gelsenkirchen mit 23,9% der Anteil der Abiturienten und Abiturientinnen deutlich niedriger als der Landesdurchschnitt von 27,0%, der bundesweit zurückgehende Anteil an Hauptschulabgängern dagegen entsprechend höher (26.6% statt 24.2% im Landesdurchschnitt).
Dies konterkariere die ansonsten für NRW positive Entwicklung, bei der sich von 1980 bis 1998 der Anteil der Schulabgänger mit Abitur von 16,9% auf 27% gesteigert habe. Der Anteil der Hauptschulabsolventen hingegen sei von 36,7 auf 24,2% gesunken. Und auch im Dualen Ausbildungssystem, in dem Berufsschulen und Unternehmen gemeinsam die berufliche Ausbildung der Arbeitskräfte betreiben, sei die Situation im Ruhrgebiet schwieriger als anderswo in NRW. Sowohl durch demografische Entwicklungen, aber auch durch den Rückgang der Industrie habe sich in den letzten Jahren eine ernstzunehmende Schieflage auf dem Markt für Ausbildungsstellen eingestellt. Nicht alle Bewerber hätten daher einen Ausbildungsplatz erhalten können.
Aus diesem Grund habe die Landesregierung seit 1996 besondere Schwerpunktprogramme und Initiativen unter dem Dach des „Ausbildungskonsens NRW" ins Leben gerufen, von deren Erfolgen das Ruhrgebiet in gleichem Maß wie die anderen Landesteile habe profitieren können. Besonderer Wert werde in diesem Zusammenhang auch auf die Ausbildung in neuen Berufsbildern gelegt, vor allem unter dem Gesichtspunkt der überall durchschlagenden Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnik.
Ungleich schwieriger erscheint jedoch die Situation der Langzeitarbeitslosen bzw. allgemein derjenigen Beschäftigten, die bislang vergleichsweise einfache Tätigkeiten ausüben oder ausgeübt haben. Auch hier können nach Ansicht des Referenten aus dem Wirtschaftsministerium NRW letztlich nur Qualifizierungsmaßnahmen helfen, eine weitere Subventionierung wie heute stelle keine Lösung dar, statt dessen seien Kombilohn-Experimente ein denkbarer Ansatz.
[Seite der Druckausg.: 59]
Als weitere, dringlich zu ändernde politische Rahmenbedingungen ergänzt die Vizepräsidentin des Landtages NRW noch folgende Aspekte:
- Die Förderrichtlinien für Unternehmen müßten stärker auf lokale bis regionale Aktivitäten ausgerichtet werden. Derzeit würden z.B. Unternehmen gefördert, wenn sie mehr als 50 km transportierten (Exportförderung).
- Es sei ein weiteres Umdenken erforderlich von der autogerechten zur menschengerechten Stadt, worunter eine Vielzahl von Maßnahmen aus den Bereichen ÖPNV, Arbeiten und Wohnen, Wiederbelebung von Stadtvierteln etc. subsumiert werden könnten. Sog. Factory Outlets auf der grünen Wiese seien hier nicht der richtige Weg.
- Insgesamt sei die politischen Schwerpunktsetzungen im Sektor Mobilität kritisch zu hinterfragen, allein vor dem Hintergrund daß es heute bereits mehr Arbeitsplätze im Umweltschutz als im Automobilbau gebe. [Hier stellt sich allerdings die Frage, ob die Zahl der Arbeitsplätze ein sinnvoll gewählter Indikator ist: Erstens bleibt unklar, wieviel Arbeitsplätze hier zum Umweltschutz hinzugerechnet werden (z.B. im umstrittenen Entsorgungsbereich), zweitens werden die Wertschöpfung bzw. indirekte Arbeits platzwirkungen pro Arbeitsplatz nicht berücksichtigt, und drittens erscheint es nicht unwahrscheinlich, daß bei hohem Automatisierungsgrad mit einer vergleichsweise geringen Zahl von Arbeitsplätzen sehr viele Autos produziert werden, deren unerwünschte Nebenwirkungen (Unfälle, Krankheiten, Umweltbelastungen) dann mit einer sehr viel höheren Zahl von Arbeitsplätzen auch im Umweltschutz zu beseitigen wären – eine sicherlich nicht erwünschte Wirkung.]
[Seite der Druckausg.: 60]
2.3 ... aus wissenschaftlicher Sicht
Aus wissenschaftlicher Sicht stellt sich nach Einschätzung des Vertreters des RWI Essen erst einmal die grundsätzliche Frage, inwieweit die Bezeichnung Ruhrgebiet überhaupt eine sinnvolle Betrachtungseinheit darstelle. Zwar könne das Ruhrgebiet wirtschaftshistorisch über die Standorte der Montanindustrie abgegrenzt werden, versuche man aber, diese Abgrenzung aus heutiger Sicht nachzuvollziehen [Etwa mittels Verflechtungsanalysen] , so zerfalle die Region in wenigstens drei Teilräume, die zum einen über die traditionellen Grenzen deutlich hinausgehen, zum anderen aber auch innerhalb dieser Grenzen große Unterschiede aufwiesen. So habe beispielsweise eine Region wie Hagen heute nur noch sehr wenig mit dem Ruhrgebiet gemeinsam (vgl. hierzu auch die Äußerungen der Duisburger OB in Kap. 2.2). Trotz dieser Brüche bezeichne man heute pragmatisch jene Kreise als Ruhrgebiet, die im gleichnamigen Kommunalverband zusammengeschlossen sind, und im allgemeinen Bewußtsein werde trotz oder gerade wegen der Vielzahl quer dazu liegender Verwaltungsgliederungen, wirtschaftlicher und kultureller Unterschiede an der historisch gewachsenen Abgrenzung mit all ihren Unschärfen festgehalten. Im Einzelfall, etwa bei raumplanerischen Entscheidungen in einem Ballungsraum von über 5 Millionen Menschen, dürfen diese Differenzen natürlich nicht aus dem Auge verloren werden.
Bedenklich stimmen nach Ansicht des RWI-Vertreters vor allem die Tatsachen, daß a) sich der Dienstleistungssektor weitaus schwächer als im Landesdurchschnitt entwickelt habe und b) die Arbeitslosenquote auch nach Jahrzehnten immer noch erheblich über dem Landes- und Bundesdurchschnitt liege (September 1998: 16%, im Landesdurchschnitt ohne Ruhrgebiet dagegen nur 11%, im Bundesdurchschnitt rund 10%). Diese Zahlen sprächen bei oberflächlicher Betrachtung dafür, daß die regionale Wirtschaftspolitik ein Fehlschlag gewesen sei, bei differenzierter Betrachtung hingegen sei diese These in mehrfacher Hinsicht zu widerlegen. Dazu seien als erstes wesentliche Ursachen der Krise zu benennen:
- Die geologischen Bedingungen im Kohlenbergbau des Ruhrgebiets ebenso wie im Braunkohlenbergbau angrenzender Gebiete benachteiligten die entsprechenden Grundstoffindustrien gegenüber der globalen Konkurrenz. Diese Benachteiligung nimmt bis heute zu. Zudem ging die Nachfrage aufgrund der Substitution dieser Energieträger, i.w. durch Erdöl, Erdgas und Kernenergie erheblich zurück.
- Auch die Stahlindustrie stand durch verschiedene Faktoren unter erheblichem Kostendruck. Stellvertretend seien hier nur Wechselkursprobleme, ein hohes
[Seite der Druckausg.: 61]
- Die Krise des Montansektors wirkte sich in vielfältiger Weise auch auf die anderen Branchen aus: Eine Vielzahl von Zulieferern waren betroffen, und der Montansektor wies eine geringe Verflechtung mit kleinen und mittleren Unternehmen aus, so daß u.a. viele handwerkliche Leistungen von den Großunternehmen in Eigenleistung erbracht wurden. Das wiederum hatte einen geringen Besatz mit Handwerksbetrieben zur Folge, die heute zu den Positivposten im Arbeitsmarkt gehören.
- Die funktionale Trennung von Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit, wie sie als stadtplanerischer Anspruch z.B. in der Charta von Athen verankert ist, ist im Ruhrgebiet häufig nicht vorhanden. Klassischerweise waren Wohngebiete unmittelbar rund um Zechen oder Stahlwerke angeordnet, so daß eine aufgegebene Produktionsfläche nicht ohne weiteres einer neuen wirtschaftlichen Nutzung offenstand.
- Die Qualifizierung der arbeitenden Bevölkerung war vergleichsweise hoch [gemessen am Facharbeiteranteil] , jedoch sehr spezifisch. So geht die Qualifikation eines Hüttenfacharbeiters mit dem Stahlwerk unter. Für viele neue Branchen hingegen, z.B. die Mikroelektronik oder die Biotechnologie waren keine qualifizierten Kräfte vorhanden. Angesichts des allgemeinen Trends zur Rezession während des Aufkommens dieser Technologien war auch an die Ansiedlung junger Betriebe, die entsprechend qualifizierte Arbeitskräfte ins Ruhrgebiet hätten ziehen können, kaum zu denken. Zudem waren vielfach Standortbedingungen nicht attraktiv genug.
Lohnniveau inklusive hoher Lohnnebenkosten, schwankende Nachfrage und Umweltauflagen genannt. Insbesondere die Beendigung der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg, der Aufbau großer Kapazitäten in Süd- und Osteuropa sowie der Verlust von Marktanteilen an andere Werkstoffe, i.w. Kunststoffe und Nichteisenmetalle setzten die Stahlindustrie unter erheblichen Anpassungsdruck.
Hinzu komme, daß oft übersehen werde, daß Teilregionen des Ruhrgebiets zu unterschiedlichen Zeiten von den Montankrisen erfaßt wurden und bis hinunter auf die Ebene einzelner Stadtteile sehr verschiedene Ausgangsbedingungen für die Krisenbewältigung hatten. So wurden die klassischen Bergbaustandorte entlang des Hellwegs (v.a. Dortmund, Bochum, Essen) zu einem Zeitpunkt betroffen, als auf Westdeutschland bezogen noch Vollbeschäftigung herrschte. Bereiche wie Duisburg oder der Kreis Recklinghausen hingegen wurden von der Stahlkrise zu einer Zeit erfaßt, als Arbeitslosigkeit schon ein beherrschendes Thema für ganz Westdeutschland
[Seite der Druckausg.: 62]
war. Typisch für diesen Zeitraum sei auch der generelle Trend zur Deindustrialisierung von Ballungsräumen gewesen, der auch vor Köln oder Düsseldorf nicht haltgemacht habe. Die Regionalpolitik der Gebietskörperschaften, von der EU über den Bund bis zum Land NRW habe angesichts dieser gesamtwirtschaftlichen Umstände nur begrenzte Wirksamkeit entfalten können. In Zeiten, in denen starke und schwache Regionen lediglich nach dem Grad des Anstiegs der Arbeitslosigkeit unterschieden würden, sei eine aktive Sanierung von Regionen nahezu unmöglich. Neue Perspektiven für das Ruhrgebiet sieht der Vertreter des RWI im wesentlichen entlang der generellen Entwicklungslinien für qualifizierte Tätigkeiten in Zusammenhang mit neuen Technologien. Das zeigten nach seiner Ansicht die sich herauskristallisierenden Schwerpunkte Softwareindustrie in Dortmund, Telekommunikation in Essen und Logistik in Duisburg. Dazu trügen entscheidend die politischen Vorgaben bei, die von einer Rekultivierung der Montanflächen über den systematischen Aufbau der dichtesten Universitätslandschaft Europas bis zur Verbesserung der Umweltbedingungen reichten.
Der ehemalige Rektor der Universität Duisburg gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, daß die alleinige Veränderung institutioneller Strukturen, z.B. in Form einer technologieorientierten Förderung von Universitätseinrichtungen etc. keinesfalls ausreiche. Der Strukturwandel müsse in den Köpfen der Betroffenen beginnen, ansonsten drohe z.B. die Universität ein Fremdkörper zu bleiben. Drastisch gesprochen müßten die Verantwortlichen statt an akademischen Erfolgen (z.B. invited lectures) mehr an Erfolgen vor Ort interessiert sein – ein ungleich schwieriger zu vermittelnder Bereich. Die Universität könne wohl durch Gründungshilfe für High-Tech-Unternehmen 1000 Arbeitsplätze schaffen, gleichzeitig gingen aber am Stahlstandort Rheinhausen 15.000 traditionelle Arbeitsplätze verloren, und die Universität beteilige sich zwangsläufig durch F&E im Bereich Automatisierung daran. Um solche Entwicklungen wenigstens teilweise auffangen zu können, müsse über Parteigrenzen hinweg gedacht und gearbeitet werden, müsse sich die Universität von der reinen Wissenschaft in die Region entwickeln. Entsprechende Schwerpunktsetzungen seien dringlich, denn Duisburg habe heute rund 16% Arbeitslosigkeit, 1992 seien es erst 12% gewesen. Aus Sicht des ehemaligen Rektors der Universität darf es nicht darum gehen, die Verhältnisse schönzureden, sondern in offener Auseinandersetzung gemeinsam herauszufinden, wie man die Zustände frei von ideologischer Voreingenommenheit ändern könne.
Nach Ansicht des Referenten von der Universität Jena bleibt aber dennoch nur der Weg, in Richtung Hochqualifizierung weiterzugehen. Arbeitsplatzabbau werde ohnehin in der Regel primär über Migration und nicht über Strukturwandel gelöst. Diese Erfahrung sei nicht auf amerikanische Verhältnisse beschränkt (vgl. Pittsburgh),
[Seite der Druckausg.: 63]
auch die von der Strukturkrise betroffenen neuen Bundesländer zeigten dies mit einem Bevölkerungsverlust von über 10%. Die Frage, ob die Abwanderung dann irgendwann vom Strukturwandel aufgefangen worden sei oder lediglich aufgrund des abgetragenen Überhanges aufgehört habe, sei eigentlich falsch gestellt. Beides wirke wechselseitig, so wirke z.B. die Neigung der Alten, dazubleiben, stabilisierend, indem u.a. neue Arbeitsplätze im Gesundheitssektor entstünden.
Um für das Ruhrgebiet Lösungen zu erarbeiten, böten sich vor allem zwei Vergleiche an: Zum einen ein problembezogener Vergleich und zum anderen die Frage, wie es an guten Standorten aussehe bzw. was davon übertragbar sei. Bei letzterem ergäben sich allerdings zwangsläufig Grenzen, so sei z.B. die Entwicklung am Stahlstandort Göteborg ungleich erfolgreicher, aber mit der Riesenregion Ruhrgebiet eben nur schwer vergleichbar. Eine erste grobe Standortbetrachtung unter dem Blickwinkel Forschung und Entwicklung ergebe aus seiner Sicht folgende Eckpunkte:
- Branchen mit know-how-intensivem Charakter und hochqualifizierten Arbeitskräften seien traditionell sehr gering vorhanden und im Ruhrgebiet nach wie vor unterdurchschnittlich repräsentiert. Seit einigen Jahren verlaufe das Wachstum in diesen Bereichen im westdeutschen Durchschnitt, d.h. zumindest der Anschluß werde gehalten, von einem Aufholen könne aber keine Rede sein.
- Forschungsstrukturen mit Anbindung an internationale Netzwerke seien nach den ihm vorliegenden Zahlen immer noch weit unterrepräsentiert. So betrage der Anteil im Bereich Spitzentechnologie nur ca. 3,5%, im Vergleich zum deutschlandweiten Durchschnitt von ca. 13%.
- Im Hinblick auf die erforderliche Flexibilität von Strukturen und Unternehmensgrößen müsse nach Branchen unterschieden werden. So seien die Voraussetzungen im Fahrzeugbau mit vergleichsweise geringen F&E-Aktivitäten schlechter zu beurteilen als die insgesamt guten Ausgangsbedingungen im Bereich Chemie im weitesten Sinne, hier vor allem in den Sektoren Biotechnologie und Umwelttechnik, in denen eine kontinuierlich steigende Anzahl von KMU zu beobachten sei.
Parallel zu den wirtschaftlichen Entwicklungen sei auch ein Lernprozeß in der Politik zu beobachten, der vom Schwerpunkt Innovationsförderung in den 80er Jahren zur Regionalen Wirtschaftsförderung in den 90er Jahren geführt habe. Für die Zukunft sei hier seines Erachtens eine konsequente Weiterentwicklung in Richtung auf endogene Faktoren wichtig. Der Strukturwandel müsse in der Tat von innen kommen, also wie bereits gesagt auch in den Köpfen der Betroffenen verankert werden, denn
[Seite der Druckausg.: 64]
exogene Faktoren wie Förderung und Investitionsbereitschaft ließen zwangsläufig angesichts neu entstehender Angebote (z.B. in mittel- und osteuropäischen Staaten) nach. Es sei daher der richtige Weg, Netzwerke und lokale Stärken zu fördern, wobei man natürlich neue Technologien stets im Auge behalten müsse.
In Hinsicht auf die lokalen Stärken wird aus dem Publikum bemerkt, daß es wohl symptomatisch für alle Regionen sei, sich selbst in den Mittelpunkt der Entwicklungen zu rücken, wobei dann im Zweifel doch wieder jeder auf überregional erfolgreiche Entwicklungen setze. Hier stelle sich die Frage, ob nicht bei aller Berücksichtigung lokaler Stärken doch auch die überregionale Kooperation eine entscheidende Rolle spiele. Ansonsten bestehe die Gefahr, daß sich der kommunale Wettbewerb lediglich auf eine Ebene höher verlagere? Darauf antwortet der Direktor von CEPS/INSTEAD, es komme in der Tat auf die richtige Mischung an. Am Beispiel Luxemburg als Vier-Länder-Gebiet lasse sich verdeutlichen, daß wenn alle Regionen dasselbe täten, sie sich tatsächlich blockieren würden. Jede der Regionen müsse die richtigen Nischen besetzen, jede der Subregionen habe verschiedene Stärken und Schwächen, unterschiedliche Souveränitätsgrade und verschiedene Entwicklungsgeschwindigkeiten.
Diese Anforderungen lassen sich prinzipiell auch am Beispiel Pittsburgh nachvollziehen. So muß nach übereinstimmenden Aussagen der Vertreter der University of Pittsburgh berücksichtigt werden, daß weder die Arbeitslosigkeit noch die wirtschaftliche Entwicklung in der Region Pittsburgh so homogen verteilt waren, wie es die Übersichtszahlen auf den ersten Blick erscheinen lassen. Beispielsweise rangiere Allegheny County mit 128 verschiedenen Kommunen mit einer Einwohnerzahl von meist unter 10.000 auf dem 2. Platz in den USA hinsichtlich kommunaler Fragmentierung.
Diese hochgradige Fragmentierung, insbesondere in der unmittelbaren Umgebung von Pittsburgh, habe zu zusätzlichen Problemen beim Strukturwandel beigetragen, vor allem weil die verfügbaren öffentlichen Ressourcen zur wirtschaftlichen Entwicklung bei den einzelnen Gemeinden sehr begrenzt waren und es zusätzlichen Aufwand bedeutete, sie zu bündeln. Innerhalb der 80er Jahre wurde z.B. innerhalb der Stadtgrenzen von Pittsburgh lediglich ein Stahlwerk geschlossen. In diesem Fall verfügte Pittsburgh als Großstadt über genügend Reserven, um sich wirtschaftlich vergleichsweise schnell von diesem Einbruch zu erholen. In der Umgebung hingegen, z.B. entlang des Monongahela Flusses südlich der Stadtgrenzen, im sog. Mon Valley, habe es anders ausgesehen: Sechs Stahlwerke seien im Lauf der 80er Jahre geschlossen worden, zwei weitere stellten ihre Stahlproduktion weitgehend ein und produzierten lediglich noch eingeschränkt im Bereich der Metallverarbeitung und Verkokung.
[Seite der Druckausg.: 65]
Für die hier betroffenen kleinen Städte habe diese Entwicklung ein verheerendes Ausmaß angenommen, weil der größte Teil der kommunalen Einkünfte und der Arbeitsplätze verlorenging. Dementsprechend hätten sich die meisten kleineren Stahlstandorte in der Umgebung von Pittsburgh bis heute nicht erholt. Bevölkerungsverlust und ein besonders hoher Anteil an alten und an arbeitslosen Menschen kennzeichneten die Situation, oftmals sei die finanzielle Basis der Kommunen durch das Ausbleiben von Steuereinnahmen völlig zusammengebrochen. An anderen Stellen hingegen sei robustes Wachstum zu beobachten, das zum Teil auf die auch in den USA endemische Suburbanisierung zurückzuführen sei, zum Teil aber auch auf mehr Arbeitsplätze in der Innenstadt selbst (trotz zurückgehender Bevölkerung), und zum Teil auf Einflüsse wie den neuen Flughafen oder Industrieparks.
Natürlich könne nicht nur nach der geographischen Verteilung differenziert werden, sondern ebenso auch nach der sozialen Verteilung. So seien in den 80er Jahren naturgemäß sehr viel mehr Arbeitsplätze in der Produktion (sog. blue collar jobs) verlorengegangen als Schreibtischarbeitsplätze in Management und Verwaltung (sog. white collar jobs). Vor allem die afro-amerikanische Bevölkerung sei vom Arbeitsplatzverlust in der Produktion besonders hart betroffen. Die entsprechenden Unterschiede in den Arbeitslosenzahlen und in der Armutssituation dauerten bis heute an, und Pittsburgh gehöre in dieser Hinsicht nach wie vor zu den am meisten betroffenen Regionen der USA. [vgl. Banks (1994) Economic Benchmarks Report. University of Pittsburgh, Center for Social and Urban Research. Pittsburgh.]
So positiv die Entwicklung der durchschnittlichen Arbeitslosenzahlen in der Region Pittsburgh zweifellos sei, so sehr gelte es doch zu berücksichtigen, daß Arbeitslosenzahlen lediglich die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage repräsentierten. Sie erlaubten z.B. für sich genommen noch keine Aussage darüber, inwieweit sich auch durch sinkende Nachfrage eine Verbesserung ergeben habe. Hier liege einer der Schlüssel für die Entwicklung in Pittsburgh, die in hohem Maße durch Abwanderung von Arbeitssuchenden mitbestimmt sei: Zwar entstand wie geschildert ein Angebot an neuen Arbeitsplätzen in der Region, jedoch in einem Ausmaß, das gemessen an der Entwicklung im Rest der USA bescheiden genannt werden müsse.
Der Löwenanteil der positiven Entwicklung der Arbeitslosenzahlen müsse also der Nachfrageseite zugeordnet werden. Hier seien zwei Faktoren entscheidend: Zum einen eine regelrechte Auswanderungswelle - binnen weniger Jahre verließen über 200.000 Menschen die Region. [In den Vereinigten Staaten ist die wirtschaftlich-technologische Entwicklung seit jeher mit einer besonderen Mobilität der arbeitenden Bevölkerung verbunden. Generell ist z.B. die Bereitschaft höher, bei Bedarf häufig umzuziehen oder regelmässig weitere Strecken zwischen Arbeitsplatz und Wohnort zurückzulegen. ] Zum anderen die qualitativen Auswirkungen die-
[Seite der Druckausg.: 66]
ser Auswanderung: Migration wirke selektiv, so daß es nicht überrasche, daß ein besonders hoher Anteil der Migranten junge, mobile und arbeitssuchende Menschen gewesen seien. In der Folge habe sich die demografische Zusammensetzung massiv in Richtung älterer Jahrgänge verschoben, und die besondere soziale Problematik von Langzeitarbeitslosigkeit und Altersarmut trat deutlicher hervor. Diejenigen, die die Suche nach Arbeit aufgegeben hatten (und damit zudem nicht länger in der Arbeitslosenstatistik geführt wurden), verblieben oft genug allein aus ihrer wirtschaftlichen Zwangslage heraus in der Region. Der Bevölkerungsanteil derjenigen, die 65 und älter sind, habe schließlich in der Region im Jahr 1998 bei 17,4% gegenüber 12,3% für die USA insgesamt gelegen und gehöre damit zu den höchsten in den USA. Im engeren Bereich um die Stadt Pittsburgh selbst (Allegheny County) seien sogar 18,3% der Bevölkerung 65 Jahre und älter.
Zusammenfassend kann jedoch nach Ansicht einiger Vertreter der University of Pittsburgh festgestellt werden, daß die Region trotz vieler immer noch nicht verheilter Narben die Krise des Niedergangs der (US-)Stahlindustrie grundsätzlich überstanden habe. Seit 1986 gehe es langsam, aber stetig aufwärts. Als 1998 die letzte Kokerei innerhalb der Stadtgrenzen von Pittsburgh - und damit die letzte mit der Stahlerzeugung noch verbundene Aktivität - geschlossen worden sei, war die Arbeitslosenrate in der Region, genauer in Allegheny County, auf dem historischen Tief von 3.3%. Wichtige Arbeitsplätze entstanden wie beschrieben z.B. im High-Tech-Sektor, aber auch im Bereich der industriellen Produktion habe die Talfahrt gestoppt werden können, denn Pittsburgh sei in der Lage gewesen, in diesem Sektor einige bedeutende Investoren anzuziehen (vgl. auch Kap. 1.2).
Der beste Beweis für die Überwindung der Strukturkrise sei aber wohl das Ende der großen Abwanderung aus der Region. Seit Ende der 80er Jahre habe sich der Trend teilweise umkehren lassen, und auch wenn aktuell wieder ein leichter Anstieg der Abwanderung zu beobachten sei, reichten diese Zahlen bei weitem nicht an die Größenordnungen früherer Jahrzehnte heran. Für ein vorläufiges Ende der Krise bzw. eine substantielle Erholung spreche auch die makroökonomische Entwicklung. Während infolge der Rezession von 1982 die Entwicklung in den USA und Pittsburgh gegenläufig waren (USA in den folgenden Jahren positiv, Pittsburgh negativ), hat Pittsburgh in der allgemeinen Rezession von 1990 und der anschließenden Erholung den Anschluß an den generellen Trend wiedergefunden. Wichtige etablierte Sektoren wie Bau und Transport lagen Anfang der 90er Jahre sogar über dem nationalen Durchschnitt, ebenso wie einige zukunftsorientierte Wachstumsbranchen, z.B. Banken, Information und Kommunikation, Bildung, Recht. Wissenschaft und Forschung erweiterten ihr Spektrum parallel von den klassischen medizinischen Schwerpunkten der University of Pittsburgh bis zu Softwareentwicklung, Ingenieurwissenschaften
[Seite der Druckausg.: 67]
und Robotik an der Carnegie Mellon University. Diese Entwicklung könne als klares Zeichen dafür gewertet werden, daß sich die durchschnittliche Effizienz der Unternehmen in der Region soweit erhöht hat, daß sie mit den unvermeidlichen zyklischen Ab- und Aufwärtsbewegungen der wirtschaftlichen Entwicklung mithalten können.
Andere Stellungnahmen hingegen lassen die Situation in einem skeptischeren Licht erscheinen: So weist die Vertreterin der Graduate School of Public and International Affairs der Univ. Pittsburgh darauf hin, daß sich das Beschäftigungswachstum in den letzten Jahren auf die Hälfte des US-Durchschnitts verlangsamt habe, und auch die Expansion in den Dienstleistungssektoren habe letztlich trotz einer grundsätzlich positiven Entwicklung nicht mit den nationalen Trends Schritt halten können. Entsprechend dem allgemeinen Trend zum Wachstum in einigen Dienstleistungsbereichen wie Recht, Bildung, moderne Medien oder auch F&E habe sich die Situation auch in Pittsburgh positiv entwickelt. In allen anderen Dienstleistungsbereichen hingegen sei die Entwicklung in den 90er Jahren hinter den nationalen Durchschnitt zurückgefallen. Auch durch den neuen Großflughafen seien zwar durchaus Spin-off-Effekte eingetreten, insgesamt seien die hohen Erwartungen an den Flughafen als Katalysator neuer Wirtschaftsaktivität in der Region jedoch enttäuscht worden. Die weitere Entwicklung hänge kritisch davon ab, inwieweit es gelinge, zusätzliche Airlines anzuziehen und das Frachtgeschäft auszuweiten.
Ein besonderer Beitrag zu der von allen Anwesenden als vordringlich erachteten regionalen Spezialisierung könne dementsprechend nicht abgeleitet werden. Die positive Entwicklung bei den sozialen Diensten sei vor allem Ausdruck des „outsorcing" ehemals staatlicher Dienste an privatwirtschaftlich tätige Anbieter, aber auch der ausgeprägten Nischenfunktion von Pittsburgh im Bereich Stiftungen und anderer „Non-Profit"-Organisationen. Schließlich verdienten vor allem die IuK-Dienstleistungen besondere Erwähnung. Auch hier biete sich aber vor allem hinsichtlich der Beschäftigungszahlen ein gemischtes Bild. Die hohen Wachstumsraten sollten auch nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch sie hinter dem nationalen Durchschnitt zurückgeblieben seien. Vor allem kleine Unternehmensneugründungen wüchsen schnell, das in der Region großgewordene Internet-Unternehmen Lycos hingegen habe aufgrund offensichtlich besserer Bedingungen anderswo die Region verlassen.
Insgesamt sei das Zurückbleiben hinter der positiven Entwicklung des US-Durchschnitt zu erwarten gewesen, denn der Prozeß der Restrukturierung sei erheblich komplexer, als dies makroökonomische Eckwerte eines Wechsels von einer Produktions- zu einer Dienstleistungsökonomie suggerierten. So beinhalte der Verlust der Produktionsbasis Stahl den Verlust eines hundert Jahre gewachsenen ökonomischen und gesellschaftlichen Netzwerks und eines wichtigen Teils seiner Insti-
[Seite der Druckausg.: 68]
tutionen mit allen Konsequenzen für die soziale, wirtschaftliche und räumliche Organisation der Region. Der Strukturwandel in Pittsburgh habe gerade in den letzten Jahren wesentlich an Fahrt verloren, und so rangiere Berichten zufolge Pittsburgh Ende der 90er Jahre unter den 25 größten Metropolen der USA mit Abstand auf dem letzten Platz bei der Entstehung neuer Arbeitsplätze.
[Domenick, J. (1998) Region Lags in Goal to Create New Jobs. Pittsburgh Tribune Review, 9 May.]
Um hier wieder Anschluß zu gewinnen, muß sich Pittsburgh nach Ansicht der Wissenschaftler im wesentlichen mit den gleichen Trends auseinandersetzen, die die Arbeitsplatzentwicklung in den USA allgemein bestimmen. Dazu gehören vor allem:
- Vorhandene Arbeitsplätze sterben sehr viel schneller als früher, neue entstehen ebenfalls schneller. Der Arbeitsplatzumsatz ist somit dramatisch gestiegen, und die arbeitende Bevölkerung ist heute eher denn je damit konfrontiert, sich einen neuen Arbeitsplatz suchen zu müssen.
- Die Arbeitsplatzdemografie verändert sich entlang der allgemeinen gesellschaftlichen Trends. So suchen heute sehr viel mehr Frauen und sehr viel mehr Alleinerziehende als früher Vollzeitarbeitsplätze.
- Die Anforderungen an neu entstehenden Arbeitsplätzen sind andere, in der Regel qualitativ hochwertigere, als noch vor einem Jahrzehnt. Auf der Angebotsseite divergiert auch der Ausbildungsstand der Arbeitssuchenden immer stärker.
So seien einerseits selbst in traditionellen produzierenden Gewerben sehr viel mehr Arbeiter mit College-Abschlüssen beschäftigt, während in anderen Bereichen wie z.B. Datenbankadministration oder Systemanalyse der Besuch einer höheren Schule allein bei weitem nicht ausreiche. Häufig werde übersehen, daß die neuen qualitativen Anforderungen nicht nur für neue Tätigkeiten oder in neu aufkommenden Geschäftsfeldern gelten, sondern auch für die meisten etablierten Industrien und Dienstleistungen. Nach Schätzungen wurden fast zwei Drittel aller neuen Arbeitsplätze in traditionellen Branchen wie Versicherungen oder im Sektor Bildung und Erziehung geschaffen - u.a. ein Indiz dafür, daß modern ausgebildete Arbeitskräfte einen der Schlüsselfaktoren auch für regionale Wettbewerbsfähigkeit darstellen. In diesem Zusammenhang werden vor allem unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens große Herausforderungen für die Ausbildung von Arbeitskräften auf allen Niveaus gesehen.
Der Einfluß von Umweltaspekten auf die wirtschaftliche bzw. soziale (Re-)vitalisierung der Region schließlich könne auf zwei Wegen deutlich gemacht werden: Zum einen durch Faktoren, die unmittelbar auf den Umweltzustand der sog.
[Seite der Druckausg.: 69]
„brownfields", also belasteter Industriebrachen, zurückzuführen seien. Zum anderen spielten indirekte Faktoren eine Rolle, z.B. die Rückwirkungen durch die zunehmende Nutzung der sog. „greenfields", also bislang naturnaher Räume im Rahmen der zunehmenden Suburbanisierung (urban sprawl). Wesentliche direkte Einflüsse bestünden z.B. durch
- die Lage und Größe von Altlastenflächen. Sie seien entscheidend für das Entwicklungspotential der unmittelbaren Umgebung. Allein die Existenz von etwa 130 kleineren Kommunen im Umland von Pittsburgh bzw. die Tatsache, daß einige größere Altlasten jeweils mehrere Kommunen tangierten, erschwere die Revitalisierung u.U. erheblich durch Abstimmungsprobleme oder durch die schlichte Höhe des Finanzbedarfs, den einzelne Kommunen kaum bewältigen könnten (vgl. Kap. 1.4). Aber auch unter sozialen Gesichtspunkten könne die Lage von „brownfields" entscheidend sein, etwa wenn die Altlasten in Gebieten mit starker Minderheitsbevölkerung oder mit einem besonders hohen Anteil an sozial Schwachen lägen. Rund um „brownfields" wandere in der Regel mehr Bevölkerung ab als anderswo und die Arbeitslosigkeit sei im Durchschnitt deutlich erhöht.
- die Anfang der 80er Jahre in Kraft getretenen strengen Bestimmungen hinsichtlich der finanziellen Verantwortlichkeit für die Beseitigung von Kontaminationen oder für eventuelle Schäden aufgrund der vorhandenen Umweltbelastungen. Sie ließen potentielle Käufer und Verkäufer von Grundstücken zurückhaltend mit Investitionen sein. Aus diesem Grund seien in den folgenden Jahren auf Bundesebene in den USA zahlreiche Modifikationen eingeführt worden, mit dem Ziel, Investitionshemmnisse zu beseitigen oder zumindest zu mildern. Auch Steuervorteile für die Absetzbarkeit von Reinigungskosten wurden eingeführt.
Wesentliche indirekte Einflüsse hingegen bestünden
- durch die zunehmende Zersiedelung bzw. Suburbanisierung. Während beispielsweise die Bevölkerung in der Region Chicago von 1970 bis 1990 um 4% gewachsen sei, wuchs die urbanisierte Fläche im gleichen Zeitraum um 46%. In Pittsburgh sank die Bevölkerungszahl um 9%, während der Flächenverbrauch gleichzeitig um 33% stieg. Oder in Houston sei z.B. der Benzinverbrauch pro Kopf um 50% höher als in Chicago - im wesentlichen aufgrund einer um 10% geringeren Bevölkerungsdichte.
[Seite der Druckausg.: 70]
- durch die Tatsache, daß infolge einer an Emissionen orientierten, vor allem ordnungspolitischen Umweltgesetzgebung die Entwicklung unbelasteter Flächen gegenüber der (Rück-)entwicklung belasteter Flächen bevorzugt werde. Der Besitz belasteter Flächen sei kostenintenisv und risikobehaftet, und das mache es naheliegend, vorrangig unbelastete Flächen zu entwickeln. In der heutigen Realität führten die emissionsorientierten Bestimmungen zu dem Dilemma, daß vor allem unbelastete Flächen für die wirtschaftliche Entwicklung nutzbar gemacht werden und auf diese Weise der Umweltverbrauch steige.
- die direkte und indirekte Subventionierung nicht erneuerbarer Ressourcen. Dabei spiele die Energiepolitik der USA eine entscheidende Rolle in der Begünstigung der Suburbanisierung. Vor allem die politischen Rahmensetzungen für niedrige Benzinpreise, von Steuervergünstigungen für die Exploration neuer Vorkommen bis zu massiven Rüstungsausgaben zum Schutz der Einflußsphäre in Ölförderländern, z.B. im Nahen Osten, verschleierten die wahren Kosten für Flächenverbrauch und Zersiedelung. Auch werde die Exploration in sensiblen Naturschutzgebieten [z.B. im Arctic National Wildlife Refuge ] erlaubt, und die Kosten für Umweltschäden durch Verkehr würden den Verursachern nicht angelastet.
Die Entwicklung der suburbanen Ausdehnung mündet nach Ansicht des Direktors der Environmental Policy Studies der University of Pittsburgh spätestens dann in eine Spirale, wenn sich Arbeitgeber in den aufstrebenden Dienstleistungsbranchen ebenfalls in der Nähe der suburbanen Wohngebiete ansiedeln und wenn eine abnehmende Bevölkerungszahl in innerstädtischen oder Problemzonen mit steigenden Kosten für die Erhaltung der auch unter Umweltschäden leidenden Infrastrukturen konfrontiert werden. In den entsprechenden Kommunen bleibe häufig nur die Wahl zwischen höheren Kosten pro Kopf oder nachlassenden öffentlichen Dienstleistungen. Staatliche Förderprogramme seien zudem auf das Bauen auf der grünen Wiese ausgerichtet, Umbau und Renovierung von Altbauten würden nicht bedacht. Sei jemand trotzdem willens, sich in einem Altgebiet zu engagieren, müsse er damit rechnen, aufgrund des möglicherweise als höher eingeschätzten Risikos schlechtere Kreditbedingungen zu erhalten.
Es gebe zweifellos eine Vielzahl isolierter, überwiegend kommunaler Anstrengungen, sich in der Revitalisierung von Industriebrachen zu engagieren. Angesichts der allgemeinen Rahmenbedingungen seien diese Bemühungen aber nicht geeignet, den Trend zur Suburbanisierung aufzuhalten. Die Kombination aus emissionsorientierten Umweltgesetzen, energie- und verkehrspolitischen Rahmensetzungen, Subventionen, staatlichen Förderprogrammen für Neubau und der Benutzung von Öko-
[Seite der Druckausg.: 71]
systemen ohne angemessene Preise führe zu einer Form von „greenfields economics", die man letztlich als Herausforderung begreifen müsse, sich für die Wiederbelebung von „brownfields" einzusetzen.
Eine besonders wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang, u.a. auch nach Einschätzung des Vertreters der „Pittsburgh Regional Alliance" PRA, das Engagement der lokalen Universitäten. Auf die Frage, welche Kräfte dieses Engagement gefördert hätten, antworten die Vertreter der Universitäten, daß sowohl Eigeninitiative als auch Anfragen aus Industrie und Kommune eine Rolle gespielt hätten. Wichtig sei es allenfalls festzuhalten, daß es in der Regel deutliche Unterschiede zwischen gemeinsamen Interessen der Universität und den Interessen einzelner Professoren gegeben habe und immer noch gebe. Die corporate identity auf dem Niveau einzelner Universitäten oder gar darüber hinaus des akademischen Sektors sei gering ausgeprägt. Wichtiges Engagement sei vor allem in Zusammenarbeit mit örtlich ansässigen und überregionalen Stiftungen zu beobachten.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Februar 2001