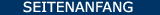![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
1. Konturen des wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels am Beispiel verschiedener Regionen
[Seite der Druckausg.: 10 (Fortsetzung)]
1. Konturen des wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels am Beispiel verschiedener Regionen
1.1 Das Ruhrgebiet
Seit dem Wiederaufbau der Ruhrgebietsindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg hat es keine Ruhepause für das „Revier" gegeben. Die Wiederherstellung der Schwerindustrie, von der Kohleförderung bis zur metallverarbeitenden Industrie war noch nicht abgeschlossen, da folgte schon Ende der 50er Jahre die Schließung der ersten Zechen, wurden die ersten Feierschichten gefahren. Die 60er Jahre waren dennoch von unbeirrbarem Wachstumsglauben geprägt, für den u.a. die dauerhafte Anwerbung von Gastarbeitern kennzeichnend war. Die Tragweite der bereits durchschlagenden Strukturkrise, i.w. verursacht durch tiefgreifenden technologischen Wandel und gekennzeichnet durch die fortschreitende Verlagerung der Wertschöpfung in den tertiären Sektor, wurde von politischen und wirtschaftlichen Entscheidern lange ignoriert, ebenso wie von großen Teilen der Gesellschaft. Zwar gewannen Dienstleistung und Wissenschaft weltweit stetig an Bedeutung, und mit ihnen hochtechnologisierte Industriezweige, z.B. im Bereich der organischen Chemie oder der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK-Technik), die Entscheider in Politik und Industrie haben nach allgemeiner Einschätzung der Referenten aber nur zögerlich auf die Entwicklungen reagiert. So begann die Landesregierung erst 1968, fast ein Jahrzehnt nach Beginn der Kohlekrise [Laut RWI Essen datiert der Beginn der Kohlekrise auf etwa 1960, die Stahlkrise folgte 1972.] , mit einem umfassenden Programm zur Unterstützung des Strukturwandels.
[Seite der Druckausg.: 11]
Zudem blieb das Ruhrgebiet, unbeeindruckt von der Strukturkrise im Bergbau und in der Stahlindustrie, bis Anfang der 70er Jahre für den Zustrom großer Mengen an Gastarbeitern geöffnet. Diese, letztlich auf bundespolitische Vorgaben zurückzuführende Entwicklung erscheint angesichts der schon damals massiven Steigerungsraten der Arbeitsproduktivität pro Kopf und dem daraus resultierenden Druck auf den Arbeitsmarkt aus heutiger Sicht nur schwer nachvollziehbar. Am härtesten traf es die Kohleförderung: Zum einen verschlechterten sich die Förderbedingungen, da die oberflächennahe Kohle im Süden des heutigen Ruhrgebiets erschöpft war und die kohleführenden Schichten nach Norden in die Tiefe abtauchten. Immer neue Förderanlagen mußten errichtet und immer größere Tiefen erreicht werden, eine hochgradig kostenintensive Entwicklung. Zum anderen drängte preiswertere ausländische Kohle ebenso auf den Markt wie andere Energieträger, vom Erdöl bis zur Kernkraft.
Dementsprechend ungünstig verlief auch die Arbeitsmarktentwicklung in den klassischen, eng miteinander verknüpften Sektoren Montan- und Stahlindustrie: Zum einen wurden wie geschildert die Wettbewerbsbedingungen im Zuge der Globalisierung schärfer. Dabei litt der Arbeitsmarkt im Steinkohlebergbau bis heute am massivsten unter der sinkenden Nachfrage. Zum anderen begann die Rationalisierung weit über den Montanbereich hinaus Arbeitsplätze zu fressen.
In den 80er Jahren war dann die strukturelle Krise auch in den vor- und nachgelagerten Branchen nicht mehr aufzuhalten. Sie konnte trotz erheblicher Anstrengungen bis heute nicht bewältigt werden. Der Druck hält bis heute an, und nach wie vor wird versucht, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen durch Subventionierungen gewaltigen Ausmaßes aufzufangen. Einige Zahlen mögen dies belegen und die Dimensionen des Strukturwandels und seiner Folgen verdeutlichen: So berichtet die Oberbürgermeisterin von Duisburg, daß die Zahl der Arbeitsplätze in der metallverarbeitenden und der Metallindustrie in Duisburg in 20 Jahren von 67.000 auf 23.000 gesunken sei, das entspreche einem knappen Drittel aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze. Im Bergbau sei die Entwicklung noch dramatischer verlaufen: Von ca. 30.000 seien heute lediglich noch 4.000 hochsubventionierte Arbeitsplätze übriggeblieben.
Insgesamt ist nach Auskunft des Vertreters des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) die Zahl der Beschäftigten von 1960 bis heute um gut 200.000 von 2,3 auf 2,1 Mio. gesunken. Auch bedingt durch eine höhere Nachfrage nach Arbeit pendelt so die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet um 14% und liegt damit um rund ein Drittel über dem Bundesdurchschnitt. Angesichts der Massivität des Strukturwandels dürfte diese Tatsache kaum erstaunen: So hat sich die Zahl der Beschäftigten im Steinkohlebergbau
[Seite der Druckausg.: 12]
binnen 40 Jahren von 450.000 auf unter 60.000 mit weiter fallender Tendenz verringert, in der Stahlindustrie ist die Zahl der Beschäftigten von 230.000 auf etwa 70.000 gefallen. Dafür stieg der Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor lediglich von 46% auf 62% an.
[Zum Vergleich: In den USA sind heute rund 80% der Beschäftigten im Dienst leistungs sektor tätig.]
Der Vertreter des IHK-Bezirks Essen
[der neben Essen auch die Großstädte Mühlheim a.d.Ruhr und Oberhausen umfaßt.]
betont in diesem Zusammenhang, daß es im internationalen Vergleich einen Hebel zwischen Industrie- und Dienstleistungsbeschäftigung gebe. So mußten zwischen 1980 und 1996 jene OECD-Staaten, die einen besonders starken Rückgang der Industriebeschäftigten verzeichneten, meist auch mit unterdurchschnittlichen Zuwächsen bei den Dienstleistungen vorlieb nehmen.
In den Niederlanden z.B. verringerte sich die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe nicht, die Stellen im tertiären Sektor hingegen nahmen um jährlich 3,1% zu. Belgien und Schweden als Schlußlichter im OECD-Vergleich hatten bei einem Stellenabbau von -1,9% bzw. -1,7% im verarbeitenden Gewerbe lediglich 0,9% bzw. 0,4% Wachstum bei den Dienstleistungen zu verzeichnen. Deutschland im unteren Mittelfeld kommt bei -1,1% Stellenabbau im verarbeitenden Gewerbe auf ein mageres Wachstum von 1,5% im wesentlich kleineren Dienstleistungssektor – absolut gesehen ein massiver Verlust an Arbeitsplätzen bei gleichzeitig steigendem Angebot an Arbeitskraft . Eine Gesamtübersicht gibt Abb. 1:
[Seite der Druckausg.: 13]
Abb. 1: Industrie und Dienstleistung - Der Beschäftigungszusammenhang 1980 bis 1996 (in Prozent)
Als weitere Probleme treten nach Ansicht mehrerer Referenten vor allem folgende aktuelle Aspekte hinzu:
- Durch die verstärkte Fokussierung auf die neue Hauptstadt Berlin liege das Ruhrgebiet mehr als früher am Rande von Investitionsüberlegungen.
- Durch die Wiedervereinigung habe sich zwangsläufig eine Schere geöffnet. Zum einen gebe es ein vermehrtes Angebot von Investitionsoptionen in den neuen Bundesländern, zum anderen müßten aber auch die vorhandenen Strukturfördermittel vor allem des Bundes, aber auch Risikokapital aus der Privatwirtschaft auf sehr viel mehr Schultern als früher verteilt werden.
[Seite der Druckausg.: 14]
- Durch die geplante Osterweiterung der EU drohten weite Teile des Ruhrgebiets auch aus der EU-Förderkulisse herauszufallen, da auch hier vorhandene Mittel breiter verteilt werden müßten bzw. die Konkurrenz wachse.
Diese aktuellen Entwicklungen verschärfen aber letztlich nur eine Problematik, deren Wurzeln historisch-struktureller Natur sind und die von Raumordnungsaufgaben ebenso geprägt ist wie vom gesamtwirtschaftlichen Wandel zur Tertiärisierung mit all seinen Verwerfungen, vor allem für das Angebot an Arbeitsplätzen. Die insgesamt überdurchschnittlich schlechte Beschäftigungslage im Ruhrgebiet präsentiert sich dabei in einer abwärtsgerichteten Spirale als Ursache und Folge zugleich. Das Abrutschen ganzer Stadtteile in Armut und die damit verbundenen sozialen Verwerfungen schaffen eine ungleich schwierigere Ausgangslage für die erforderlichen Neuinvestitionen. Die Standortbedingungen einschließlich der Humanressourcen verschlechtern sich dramatisch, wurde erst einmal der Anschluß verloren.
Strukturen und Institutionen zur Bewältigung des Strukturwandels
Der Abwärtsspirale aus der „Verslumung" von Stadtteilen und sich verschlechternden Ausgangsbedingungen für Neuinvestitionen versucht die Landesregierung mit ressortübergreifenden Handlungsprogrammen für „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf" z.B. in Duisburg-Marxloh entgegenzuwirken. Angesichts der Vielzahl betroffener Viertel einerseits und begrenzter Mittel andererseits werden jedoch die Aussichten auf substantielle Fortschritte in der Breite eher gering eingeschätzt; die Programme dienen in der Regel eher der Abwehr einer weiteren Verschlechterung der Situation in den betroffenen Gebieten.
Dennoch bietet das Ruhrgebiet heute auch eine ganze Reihe von (im folgenden dargestellten) Beispielen für eine erfolgreiche Revitalisierung betroffener Gebiete - und damit wird auch die Chance offensichtlich, die in der Krise liegt: Wer den Anschluß verloren hat, ist in der Lage, ausgetretene Pfade zu verlassen und sich neu zu orientieren. Diese Ausgangslage kann in einer grundlegend veränderten Ausgangssituation, von Vorteil sein – sie muß es allerdings nicht. Seit 1968 sind viele Milliarden DM von Land und Bund in das Ruhrgebiet gepumpt worden, um negative Folgen des Strukturwandels zu mildern und Voraussetzungen für eine positive Entwicklung zu schaffen. Die Gelder sind vor allem in zwei Bereiche geflossen:
- In den Ausbau und die Modernisierung von Infrastrukturen. Heute verfügt das Ruhrgebiet neben modernen Straßen, Autobahnen und einem dichten Eisenbahnnetz über Europas größten und wohl modernsten Binnenhafen, über zwei internationale Flughäfen, 14 Hochschulen und Fachhochschulen mit rund
[Seite der Druckausg.: 15]
- In die zur Milderung sozialer Brüche als notwendig erachteten Subventionierungen, die vor allem auf dem freien Markt seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr konkurrenzfähige Sparten (wie die regionale Untertagegewinnung von Steinkohle sowie große Teile der herkömmlichen Stahlerzeugung) betreffen. Sanierungsansätze ohne entsprechende Subventionen wie z.B. in Pittsburgh, wo man in Kauf genommen habe, daß große Bevölkerungsteile abwanderten, sind nach Ansicht des Vertreters des Wirtschaftsministeriums in Deutschland allein aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte undenkbar.
160.000 Studenten, 20 Technologiezentren und 13 Forschungs- und Entwicklungszentren sowie nicht zuletzt über eine gut organisierte Ver- und Entsorgung. Auch zahlreiche An-Institute und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen von internationalem Rang sind vorhanden, z.B. Institute der Max-Planck- und der Fraunhofer-Gesellschaft sowie eine Vielzahl weiterer Einrichtungen im Rahmen von Public-Private-Partnership-Konzepten (sog. PPP).
Ein Standortnachteil im Strukturwandel ist zweifellos die historisch gewachsene, komplizierte Verwaltungsgliederung der Region Ruhrgebiet. So greifen beispielsweise allein drei der fünf nordrhein-westfälischen Regierungsbezirke in das Ruhrgebiet ein, ohne daß eines der jeweiligen Verwaltungszentren Arnsberg, Münster und Düsseldorf im Ruhrgebiet selbst liegt. Über die Landesebene und die Regierungsbezirke hinaus sind der Kommunalverband Ruhrgebiet (KVR) ebenso wie elf kreisfreie Großstädte und vier Kreise mit insgesamt 42 Kommunen gefordert, ihre Entscheidungen in Kenntnis der jeweils externen Entwicklungen zu treffen und zu koordinieren. In diesem Zusammenhang weist die Vizepräsidentin des Landtages NRW darauf hin, daß aus Sicht der Partei, der sie angehöre, dringend ein eigener Regierungsbezirk für das Ruhrgebiet eingerichtet werden sollte, um z.B. die regionale Verkehrsplanung und eine integrierte Flächenpolitik optimieren zu können. Auch der Vertreter des KVR mahnt in allgemeinerer Form den Bedarf nach höherer Handlungsautonomie und besserer Strukturierung für das Ruhrgebiet an, zumal man sich ohnehin mitten in einer landesweiten Verwaltungsreform befinde.
Die Technologie- und Gründerzentren (TGZ) spielen nach Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Technologie- und Gründerzentren eine besondere Rolle bei der Bewältigung des Strukturwandels, da sie sich in besonderem Maße der Förderung und Pflege von Unternehmensneugründungen im Bereich zukunftsfähiger Schlüsseltechnologien annähmen. Hier entständen überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze - nach fünf Jahren im statistischen Durchschnitt der Unternehmensneugründungen neun Mitarbeiter in innovativen Unternehmen versus fünf Mitarbeiter in traditionellen Unternehmen – und die Rate der Konkurse in den ersten drei Jahren betrage nur 5% im Vergleich zu über 50% bei Unternehmen
[Seite der Druckausg.: 16]
außerhalb von TGZ. Während Technologiezentren sich vorrangig der Entwicklung und Pflege einer Standortgemeinschaft von technologieorientierten Unternehmen mit entsprechenden Gemeinschaftseinrichtungen und FuE-orientierten Dienstleistungsangeboten widmeten, liege der Schwerpunkt bei den Gründerzentren eher auf Gründungsberatung sowie günstigen Startkonditionen für Neugründungen. Hier sei der Aufenthalt in der Regel befristet, d.h. ein lauffähiges Unternehmen müsse in der Regel nach einigen Jahren den Standort wechseln.
Hilfestellungen der vorgenannten Art beschränken sich allerdings nicht auf Neugründungen, denn in der Mehrzahl gilt es natürlich, bestehende Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Zu diesem Zweck hat das Land NRW u.a. ein Zentrum für Innovation und Technik (ZENIT) gegründet, um mit den Worten des Geschäftsführers kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Land als eine Art „Stabstelle Technik" den Zugang zu modernen Strukturen und zu innovativer Technik zu erleichtern. Die Einrichtung, die zu je einem Drittel vom Land, von einem Trägerverein aus Unternehmen verschiedenster Branchen und von einem Bankenkonsortium aus Westdeutscher Landesbank, Westdeutscher Genossenschafts-Zentralbank und der privaten Bankenvereinigung getragen wird, wurde Mitte der 80er Jahre durch das Engagement einiger Unternehmer ins Leben gerufen.
Neben intensiver Beratungs- und Moderationstätigkeit unterstützt bzw. verwaltet ZENIT einige NRW-Förderprogramme wie z.B. das Technologieprogramm Wirtschaft (TPW) [Um angesichts kürzer werdender Entwicklungszeiten und Produktionszyklen sowie höherer Aufwen dung en im F&E-Bereich die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, werden angewandte Forschung, die Einführung neuer und der Einsatz vorhandener Technologien in neuen Anwendungsfeldern finanziell unterstützt. ] , den sog. Innovationsbezogenen Personaltransfer (IPT) [Hier wird die Einstellung qualifizierter Nachwuchskräfte in KMU anteilig durch Personalkosten zu schüsse und Betreuung gefördert.] oder das Programm zur finanziellen Absicherung von Unternehmensneugründungen aus der Hochschule (PFAU) [Auf der Basis eines Auswahlverfahrens wird das Engagement potentieller Firmengründer durch eine maximal zwei Jahre lang gezahlte finanzielle Grundsicherung abgesichert. ] , mit dem der Einsatz von Hochschulabgängern auch in KMU erhöht werden soll. Anfang der 90er Jahre beschleunigte sich die Geschwindigkeit, mit der sich technische Veränderungen vollzogen, erheblich. Während ZENIT in den ersten Jahren des Bestehens einen Schwerpunkt auf die frühzeitige Identifizierung und Umsetzung einzelner vielversprechender Technologien für KMU setzen konnte, verkürzten sich die dafür zur Verfügung stehenden Zeiträume im Lauf der letzten Jahre deutlich. Das führte u.a. dazu, daß übergreifende Themenstellungen wie „Neue Materialien" oder „Biotechnologie" in den Vordergrund rückten.
[Seite der Druckausg.: 17]
Hinzu trat und tritt in steigendem Maße die europäische Komponente, der ZENIT beispielsweise durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Euro Info Centre (EIC) [Im Auftrag der Europäischen Kommission und unterstützt vom Land NRW informiert das EIC seit 1987 KMU über europäische Förderprogramme, Investitionsmöglichkeiten in anderen EU-Staaten, europaweite öffentliche Ausschreibungen und neue Richtlinien bzw. Gesetze.] und des IRC-Netzwerks [Das IRC-Netzwerk ist eine Initiative der DG XIII der Europäischen Kommission unter dem 4. EU-Forschungsrahmenprogramm. Hauptziel ist die Förderung der betrieblichen Innovation durch Tech nologietransfer (inward/outward) und allg. Beratungsleistungen wie z.B. die Unterstützung bei der Konzeption und Formulierung von Vorschlägen für EU-Vorhaben.] gerecht wird. Weitere Arbeitsschwerpunkte lagen oder liegen in Beratungen rund um die Einführung des EURO, deren strategische Auswirkungen nach Einschätzung des Vertreters von ZENIT vielfach gar nicht gesehen oder unterschätzt werden, sowie in der Marktforschung, die überwiegend im Sinne einer angebotsorientierten Politik gefördert wird (vgl. hierzu Kap. 2.1). Insgesamt gehe aber der Handlungsbedarf hinsichtlich Globalisierung weit über Europa hinaus und so unterstütze ZENIT die KMU auch bei der Öffnung neuer Märkte weltweit. U.a. zahle die Organisation einen Lohnkostenzuschuß in Höhe von 25.000 DM jährlich für einen neu eingestellten Mitarbeiter, der den KMU helfen solle, technologische Innovationspotentiale besser zu erschließen und das Dickicht von Institutionen bzw. Förderanträgen besser durchschauen zu können.
Ein besonders wichtiger Aspekt des Strukturwandels sei schließlich erheblicher Veränderungsbedarf in Hinsicht auf hierarchisch bzw. autoritär organisierte Unternehmensstrukturen, die die Nutzung vorhandener Potentiale bei allen Mitarbeitern nachweislich behinderten. Hier berate ZENIT zu neuen Möglichkeiten hierarchiearmer bzw. -freier Organisationsformen und sei diesen Weg auch selbst gegangen: Mit Ausnahme der gesetzlich notwendigen Geschäftsführung seien alle Mitarbeiter gleichberechtigt, Aufgaben würden kundengerecht strukturiert und in Form zeitlich begrenzter Projekte abgearbeitet.
Umweltaspekte
Das Ruhrgebiet ist aufgrund seiner langen bergbaulichen und schwerindustriellen Tradition zwangsläufig von einer besonderen Intensität an Umweltbelastungen betroffen. Zwar ist der Himmel über der Ruhr seit den 80er Jahren wieder blau, dennoch werden in einzelnen Belastungen fast aller Umweltmedien immer noch bundesweit Spitzenwerte erzielt. Viele Gewässer sind nach wie vor überdurchschnittlich belastet, und große Teile der Abwasserentsorgung mußten aufgrund möglicher Bergschäden oberirdisch gebaut werden. Insgesamt gehen die Bergschäden durch absackendes Terrain aufgrund des intensiven, teils illegalen, teils schlecht gesicherten Untertagebaues in die Milliarden. In vielen Gebieten muß permanent
[Seite der Druckausg.: 18]
Grundwasser abgepumpt, müssen lange aufgegebene Untertagebaue mit erheblichem Kostenaufwand instand gehalten werden, da ansonsten massivste Schäden an Infrastrukturen bis hin zur dauerhaften Versumpfung ganzer Stadtflächen drohen.
Schließlich sind insbesondere die Böden des Ruhrgebietes gebietsweise noch hoch belastet. Die typischen Noxen reichen hier von Schwermetallen bis zu organischen Substanzen, z.B. polyzyklischen Kohlenwasserstoffen. Dementsprechend sind auch Probleme an der Schnittstelle Umwelt und Gesundheit immer wieder tagesaktuell: Die Meldungen reichen von dioxinverseuchten Schlacken auf Sportplätzen bis zur Gefährdung durch schwermetallbelastete Nahrung und Stäube, die sich statistisch u.a. in Darm- und Knochenerkrankungen niederschlagen. Die Intensität der Umweltbelastungen, aber auch die permanenten Aktivitäten zur Sanierung können beispielhaft an den Kapazitäten der stationären Bodenbehandlungsanlagen in NRW verdeutlicht werden: Sie betrugen im November 1999 insgesamt 529.000 Tonnen pro Jahr, weitere Kapazitäten von 244.000 t/a sind im Bau.
[Quelle: Landesumweltamt NRW, http://www.lua.nrw.de/bodanl.html]
Auf diese Weise hat sich aus der dringlichen Notwendigkeit zur Sanierung ein blühender Industriezweig ergeben, und mit dem zwangsläufig erworbenen Know-How gehört die Branche mittlerweile zu den Marktführern nicht nur in Europa. Neben solchen nachsorgenden Aufbereitungsmaßnahmen und weitergehenden, produktionsintegrierten Umweltschutzmaßnahmen wie z.B. Filteranlagen ist in NRW aber auch ein breites Spektrum an vorsorgenden, integrierten Ansätzen vorhanden. So soll z.B. die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum mit Qualitätszielen des nachhaltigen, d.h. gleichermaßen energie- und flächensparenden Bauens verknüpft werden. Aus diesem Grunde wurden vor allem im Bereich der staatlichen Förderung Rahmenbedingungen geschaffen, die diesen Ansprüchen entgegenkommen. U.a. wird seit 1998 die Förderung des Miet- und Genossenschaftswohnbaus auf Standorte konzentriert, die im Einzugsbereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), insbesondere einer Schienenstrecke liegen.
Weitere Beiträge sind nach Darstellung der Vizepräsidentin des Landtages in der Begrenzung der Eigenheimförderung auf Grundstücksgrößen unter 400 m2 und in den Revitalisierungsprogrammen für Brachflächen bzw. Altlastenflächen zu sehen. Noch seien im Ruhrgebiet rund 6000 Hektar Industriebrachen ungenutzt. Als ein Instrument wurde 1980 der Grundstücksfonds Ruhr gegründet (und vier Jahre später auf ganz NRW erweitert), für den die Landesentwicklungsgesellschaft LEG Brachflächen erwerbe und saniere, um dann die aufbereiteten Flächen zu verkaufen und einer neuen, strukturell sinnvollen Nutzung zuzuführen. Damit werde nebenbei auch der Industriezweig „Umwelttechnik" unterstützt, indem Sanierungstechnik weiterentwickelt werden könnte.
[Seite der Druckausg.: 19]
Der Grundsatz „Brache vor Freiraum", d.h. Verdichtung statt Zersiedelung ist auch über die Ausweisung von Gewerbeflächen hinaus erklärtes Ziel des Landes NRW. So weist die Vizepräsidentin des Landtages darauf hin, daß z.B. das Recycling von Flächen trotz wirtschaftlicher und bundespolitischer Restriktionen ernst genommen werde. Man folge hier den Forderungen der Enquete-Kommission des Bundestages „Schutz des Menschen und der Umwelt", die u.a. feststelle „langfristig soll die Versiegelung eingefroren werden, d.h. daß sich Neuversiegelung und Entsiegelung die Waage halten". Diese Forderung sei nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus sozialen Aspekten von besonderer Bedeutung, denn im Zuge eines zunehmend spekulativen Bodenmarktes verlören Länder und Kommunen wichtige Steuerungsmöglichkeiten, um z.B. an innerstädtischen Standorten Wohnraum für einkommensschwache Haushalte zu schaffen. NRW habe seine Förderpraxis für den sozialen Wohnungsbau auch deshalb an den Einzugsbereich des öffentlichen Personennahverkehrs gekoppelt, da hierdurch die besonders einkommensschwachen Haushalte, die gar kein Auto besitzen, die Möglichkeit zur Mobilität erhielten. Dies sei ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.
1.2 Die Region Pittsburgh
Urbanes Wachstum war in den USA der 50er und 60er Jahre derart robust, daß sich die (wirtschafts-)wissenschaftliche Theorie entwickelte, es gebe einen engen Zusammenhang zwischen der Größe und der Wirtschaftskraft von Metropolen. Städte, wenn sie erst einmal eine gewisse Größe (z.B. eine Million Einwohner) erreicht hätten, würden der Theorie zufolge nicht mehr kleiner werden, da die wirtschaftlichen Vorteile der Größe bzw. der Konzentration dies verhinderten (sog. „ratchet effect"). [vgl. Thomson W.R. (1965) A Preface to Urban Economics. The Johns Hopkins Press, Baltimore.]
Dennoch gab es in der wirtschaftlichen Realität der Vereinigten Staaten bereits in den 60er Jahren eine eindrucksvolle Ausnahme von der theoretischen Regel: Pittsburgh mit seinen weit über 2 Millionen Einwohner verlor bereits damals an Einwohnern und Wirtschaftskraft. In den 70er Jahren erfaßte die negative Bevölkerungsentwicklung auch viele andere Agglomerationen in den USA, so daß der Glaube an die Unausweichlichkeit städtischen Wachstums erschüttert wurde.
Viele, wenn auch nicht alle dieser Regionen begannen jedoch in den 80er Jahren wieder zu wachsen. Der Bevölkerungsverlust in Pittsburgh hingegen setzte sich beschleunigt fort. Während die Theorie des „ratchet effect" aufgrund mangelnder Übereinstimmung mit der Realität zu den Akten gelegt wurde, bekam die Region Pittsburgh ihren Mangel an wirtschaftlicher Diversität in vollem Ausmaß zu spüren. Noch bis in die 70er Jahre hinein konnte sie als eine der klassischen Stahlregionen der
[Seite der Druckausg.: 20]
USA angesehen werden, spätestens seit Ende der 70er Jahre mündeten aber auch hier die Umbrüche bzw. Einbrüche in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in eine massive Strukturkrise. In den 80er Jahren verließen fast durchgehend rund 50.000 Menschen jährlich die Region - ein Trend, der erst Anfang der 90er Jahre gebremst und in eine leicht positive Entwicklung umgekehrt werden konnte.
Um diese Entwicklung verstehen zu können, ist ein Blick auf die Veränderungen in der Struktur der industriellen Produktion und darüber hinaus in der regionalen Wertschöpfung hilfreich (Tab. 1 und 2). Aus den Zahlen wird ersichtlich, daß der dramatische Teil des Niedergangs der industriellen Produktion in den Zeitraum 1978 bis 1988 fällt. Im folgenden Jahrzehnt bis heute ist eine Stabilisierung erkennbar, die jedoch weiterhin hinter der Entwicklung im Rest der USA zurückbleibt.
Tab. 1: Arbeitsplatzentwicklung in der Region Pittsburgh im Vergleich zu den USA insgesamt (pro Tausend Arbeitsplätze)
Sektor |
Region Pittsburgh* |
USA insgesamt* | ||||
1978 |
1988 |
1998 |
1978 |
1988 |
1998 |
|
Produktion |
272,7
|
151,1
|
130,5
|
20.967
|
19.886
|
18.867
|
Übrige |
748,6 |
881,5
|
1.053,3
|
66.962 |
91.150
|
113.468
|
Gesamtzahl Nichtöff. Sektor (exkl. Landwirtschaft) |
1021,3 |
1.032,6
|
1.183,8
|
87.930 |
111.036
|
132.335
|
* (in Klammern: prozentuale Veränderung im vergangenen Jahrzehnt)
[Seite der Druckausg.: 21]
Tab. 2: Reale Wertschöpfung in Mrd. $ in der Region Pittsburgh im Vergleich zu den USA insgesamt (Bezugsjahr der Inflationsbereinigung: 1992)
Sektor |
Region Pittsburgh* |
USA insgesamt* | ||||
1978 |
1988 |
1998 |
1978 |
1988 |
1998 |
|
Produktion |
7,0 |
5,1
|
5,9
|
1353,9 |
1759,3
|
2209,7
|
Übrige |
23,4 |
25,7
|
32,3
|
2437,8 |
3226,5
|
4146,3
|
Gesamtzahl Nichtöff. Sektor (exkl. Landwirtschaft) |
30,4 |
30,9
|
38,3
|
3791,7 |
4985,8
|
6356,0
|
* (in Klammern: prozentuale Veränderung im vergangenen Jahrzehnt)
Quelle für Tab. 1 und 2: Giarratini et al., Univ. of Pittsburgh, nach: The 1998 Pittsburgh REMI Model.
In Pittsburgh ebenso wie in den USA insgesamt gingen in den zwanzig Jahren von 1978 bis 1998 Arbeitsplätze in der Produktion verloren, während neue im tertiären Sektor hinzukamen. Allerdings war der Rückgang im Produktionssektor in Pittsburgh sehr viel ausgeprägter als im Durchschnitt der USA: Auf zwei Jahrzehnte bezogen minus 52,1% gegenüber lediglich minus 10,0% in den USA insgesamt. Gleichzeitig war der Gewinn an neuen Arbeitsplätzen sehr viel schwächer als im Rest der USA: 40.7% gegenüber 69.5% in den USA insgesamt. Die Verluste an Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen können weitgehend auf die Entwicklungen im Stahlsektor zurückgeführt werden: Von den über 142.000 Arbeitsplätzen, die in der Produktion im Zeitraum 1978 bis 1998 verloren gingen, waren lediglich 11.000 nicht im Metallsektor (d.h. überwiegend in der Stahlerzeugung und -verarbeitung). Weltweiter Wettbewerb und technischer Fortschritt in der Eisen- bzw. Stahlerzeugung führten dazu, daß von 45 erzbasierten Stahlschmelzen im Jahre 1974 bis 1991 nur 23 überlebten, die zudem ihre Kapazitäten erheblich reduzierten. Hinzu kamen starke Rationalisierungseffekte, z.B. infolge der Umstellung von großvolumigen, sog. integrierten Hüttenwerken auf kleinere Elektrostahlwerke, die auf die Verarbeitung von Sekundärrohstoffen, i.w. Schrott, spezialisiert waren.
Dieser technologische Wandel trug auch dazu bei, daß sich der Standort der Stahlerzeugung zunehmend verlagerte bzw. diversifizierte: Waren die integrierten Hüttenwerke noch eng an die Kohle- bzw. Koksproduktion in und um Pittsburgh gebunden, arbeiten die neueren Elektrostahlwerke (sog. Minimills) mit Lichtbogenöfen, die lediglich Elektrizität benötigen. Einer der wichtigsten Wettbewerbsvorteile der Region Pittsburgh, die Nähe zur Kohle und die gute Transportinfrastruktur, verlor
[Seite der Druckausg.: 22]
demzufolge an Bedeutung. Um weiter mithalten zu können, mußte man mit erheblichem Kostenaufwand die regionale Elektrizitätserzeugung ausbauen - eine Rechnung, die angesichts des allgemeinen Rückgangs der schwerindustriellen Produktion nicht aufging: Die gerade neu aufgebauten Kapazitäten waren nicht ausgelastet, und die Kosten für Elektrizität in der Region sind nach Aussagen der Wissenschaftler vom Dept. of Economics der University of Pittsburgh bis heute nicht wettbewerbsfähig im Vergleich zum Rest der USA. Insgesamt waren vor allem folgende Nachteile nach Ansicht der Wissenschaftler mitentscheidend für die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der Region:
- Die Region war und ist als traditioneller Stahlstandort fest an gewerkschaftliche Organisation und dementsprechend an Tarifverträge gebunden. Das ist in anderen Regionen bzw. Staaten der USA nicht der Fall, so daß dort zumindest zeitweise Wettbewerbsvorteile durch niedrigere Löhne realisiert werden konnten.
- Die neue Minimill-Technologie ist nicht mehr abhängig von traditionellen Standortvorteilen und kann dezentral organisiert werden. Die wesentlichen Rohstoffe Schrott und Elektrizität sind überall zu vergleichbaren Bedingungen verfügbar, und unter diesen Voraussetzungen ist es von Vorteil, neue Kapazitäten auch räumlich in Marktnähe aufzubauen.
- Die Großabnehmer der Autoindustrie rund um Detroit haben über mehrere Jahrzehnte Kapazitäten der integrierten Hüttenwerke in die Gegend der Großen Seen abgezogen.
- Die Region Pittsburgh bietet keine Wettbewerbsvorteile im Markt für Sekundärrohstoffe (Schrott etc.), die für die heutige Stahlproduktion zu einem mitentscheidenden Faktor geworden sind. Im Gegenteil, die am meisten gefragten Qualitäten an Schrottstahl sind auf den Märkten des Südens und des Mittleren Westens oft preiswerter.
Allerdings ist die Stahlindustrie nicht völlig aus Pittsburgh verschwunden. Immerhin werden nach wie vor fast 7 Mio. Tonnen Stahl erzeugt, das entspricht rund 6.2% der gesamten US-Kapazitäten (Zahlen von 1994). Davon sind rund 3.7 Mio. Tonnen aus integrierten Hüttenwerken, d.h. überwiegend aus Erz erzeugter Stahl. Rund 3 Mio. Tonnen Spezialstähle, d.h. legierte Erzeugnisse (z.B. Chrom-Stähle o.ä.) werden nach wie vor in der Region erzeugt, und in diesem Sektor ist Pittsburgh mit 38% der US-Kapazitäten sogar Marktführer.
[Seite der Druckausg.: 23]
Strukturen und Institutionen zur Bewältigung des Strukturwandels
Zum Verständnis bzw. zur proaktiven Mitgestaltung des Strukturwandels ist die Frage von Interesse, in welchen neuen Branchen und mit Hilfe welcher Strukturen bzw. Institutionen die maßgeblichen Potentiale für Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu finden sind. Dazu ist als erstes ein differenzierter Blick auf die Arbeitsmarktstatistik hilfreich (Tab. 3).
Die jährlichen Wachstumsraten im nichtproduzierenden Bereich für Pittsburgh und die USA, aufgegliedert in sechs Sektoren (Dienstleistungen, Finanzen, Groß- und Einzelhandel; zu Vergleichszwecken werden Bergbau und Landwirtschaft hinzugenommen), reflektieren deutlich die Erholung der Region Pittsburgh von den Einbrüchen der frühen 80er Jahre. Dennoch bleibt die Region insgesamt hinter der Entwicklung in den restlichen USA zurück, wenn man auf den gesamten Zeitraum von 20 Jahren (1978-1998) blickt. Die Zahlen für den Zeitraum 1988-1998 zeigen substantielle Fortschritte für einzelne Sektoren, i.w. Dienstleistung, Einzelhandel, Transport und öffentliche Einrichtungen, Bausektor, aber auch in der Produktion selbst. Vor allem Produktionsbereiche wie z.B. Industrieanlagenbau, Maschinenbau, elektronische Ausrüstung, Transportausrüstung und Instrumentenbau zeigen positive Entwicklungen, sowohl hinsichtlich der Wertschöpfung als auch der Arbeitsplätze.
Tab. 3: Jährliche prozentuale Wachstumsraten der Beschäftigtenzahlen in ausgewählten Sektoren für Pittsburgh und die USA insgesamt, 1978 - 1998.
Sektor |
Pittsburgh |
USA | ||||
1978-88 |
1988–98 |
1978-98 |
1978-88 |
1988-98 |
1978-98 |
|
Dienstleistungen |
3.64 |
2.18 |
2.91 |
4.56 |
3.23 |
3.89 |
Finanzen* |
0.73 |
3.38 |
2.05 |
2.58 |
0.95 |
1.76 |
Einzelhandel |
0.93 |
1.02 |
0.98 |
2.50 |
1.81 |
2.15 |
Großhandel |
0.51 |
0.36 |
0.44 |
1.75 |
1.00 |
1.38 |
Transport** |
-0.94 |
1.86 |
0.45 |
1.40 |
1.80 |
1.60 |
Bauen |
-0.22 |
1.26 |
0.52 |
2.49 |
1.61 |
2.05 |
Bergbau |
-3.29 |
-3.36 |
-3.32 |
0.32 |
-3.16 |
-1.44 |
Landwirtschaft*** |
6.11 |
4.70 |
5.40 |
5.26 |
3.63 |
4.44 |
* einschließlich Versicherungen und Immobilien
** einschließlich öffentlicher Dienstleistungen (public utilities)
*** einschließlich Forstwirtschaft
Quelle: Giarratini et al., Univ. of Pittsburgh, nach: The 1998 Pittsburgh REMI Model.
[Seite der Druckausg.: 24]
Vorrangig haben nach Ansicht der Ökonomen von der University of Pittsburgh internationale Investitionen in diesen Bereichen neue Substanz gebracht, z.B. durch Sony in der Produktion von Fernsehern oder durch Adtranz Nordamerika für Transportsysteme. Insgesamt habe sich die Zahl produzierender Unternehmen in der Region innerhalb eines Jahrzehnts um nahezu 11% erhöht, eine wichtige Bestätigung für die Innovationskraft mittelständischer Unternehmen. Produktion in Pittsburgh bedeutet heute größere Diversität als im Stahlzeitalter, mehr Firmen beschäftigen insgesamt weniger Arbeitnehmer.
Das Wachstum in den Sektoren Transport und Bau könne durch erhebliche Investitionen im Bereich von Verkehrsinfrastrukturen erklärt werden, z.B. wurden ein neuer Großflughafen und neue Autobahnen gebaut. Auch eine Vielzahl von Public-Private Investitionen in Schlüsseltechnologien wie Biotechnologie, Software Engineering oder Robotik hätten erheblich zu Investitionen im Bausektor beigetragen. Pittsburgh bewältige zudem ein hohes Lufttransportaufkommen, allerdings werde der Sektor von einem Unternehmen (US Airways) dominiert. Das Aufkommen habe sich in den späten 80er Jahren verdoppelt, um dann zwischen 1990 und 1996 wieder um nahezu 20% zu sinken.
Beim Sektor Finanzen, Versicherungen, Immobilien handele es sich um einen der wenigen Bereiche, in denen sich das wirtschaftliche Wachstum der später 80er Jahre auch in den 90er Jahren ungebrochen fortgesetzt habe. Auch das Beschäftigungswachstum im Bereich der Finanzdienstleistungen im weitesten Sinne habe sich bis dato fortgesetzt. Die Entwicklung sei im wesentlichen angeführt worden durch die in der Region tätigen Bankunternehmen. Desweiteren seien es vor allem die Bereiche Bildung, Medizin und wirtschaftsbezogene Dienstleistungen gewesen, die als Wachstumsmotoren auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitrugen. Die positive Entwicklung in einzelnen Sektoren konnte jedoch anfangs die insgesamt dramatische Arbeitslosigkeit nicht auffangen, und so lag noch 1983 die Arbeitslosigkeit in der Region Pittsburgh um mehr als 50% höher als im Durchschnitt der USA. Seit 1989 allerdings haben sich die Zahlen angeglichen, und Ende 1998 waren sie fast gleich: In Pittsburgh 4.6%, in den USA insgesamt 4.5%.
Eine besondere Rolle komme in diesem Zusammenhang zweifellos dem Sektor Bildung und Forschung zu, der das Rückgrat der neuen wirtschaftlichen Entwicklung darstelle. Insbesondere zur Förderung der sog. „spike industries" also innvationsorientierter Unternehmen, sei die Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Sachverstand von zentraler Bedeutung. Aus diesem Grund existierten mittlerweile auch in der Region Pittsburgh eine entsprechende Anzahl an Technologiezentren, die in engem Kontakt mit Universitäten und den Forschungszentren großer Konzerne auf der
[Seite der Druckausg.: 25]
Suche nach erfolgreichen Lösungen an der Schnittstelle zwischen F&E und Markteinführung seien.
Darüber hinaus stellten die ortsansässigen Universitäten aber auch für sich genommen einen in der Regel nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor dar. So trügen beispielsweise allein die zwei großen Universitäten in Pittsburgh mit über zwei Mrd. $ zu den jährlichen Einnahmen in der Region bei. Zur Erläuterung: Allein der Etat der University of Pittsburgh mit ihren rund 25.000 Studenten beträgt über eine Mrd. $ und liegt damit weit über den Etats vergleichbarer deutscher oder französischer Universitäten. Die Carnegie Mellon University hat sogar einen noch höheren Pro-Kopf-Etat - insgesamt rund 400 Mio. $ bei nur 7.500 Studenten. Als Zentren der regionalen F&E-Aktivitäten werden die beiden großen Pittsburgher Universitäten im kommenden Jahr rund eine halbe Mrd. $ an Drittmitteln aus öffentlichen und privaten Quellen in die Region holen. Mit über 10.000 Angestellten in der Software-Branche, die besonders eng mit den Universitäten verknüpft ist, liegt Pittsburgh gemeinsam mit Silicon Valley, den Regionen Seattle, Austin/Dallas und Boston an vorderster Front in den USA.
Eine weitere, im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Potentiale zentrale Institution für die Region ist die „Pittsburgh Regional Alliance (PRA)". Diese Non-Profit-Organisation hat im wesentlichen die Aufgabe übernommen, die wichtigsten Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung im Südwesten von Pennsylvania zu koordinieren, durch intensives Marketing dazu beizutragen, daß die Atmosphäre für Neuansiedlungen von Unternehmen geeignet ist und interessierten, vielversprechenden Unternehmern in jeder Hinsicht behilflich zu sein.
Umweltaspekte
Neben den geschilderten wirtschaftlichen und sozialen Aspekten des Strukturwandels besitzen Umweltaspekte naturgemäß auch in der Stahl- und Kohleregion um Pittsburgh einen besonderen Stellenwert. Vor allem unter dem Gesichtspunkt der Flächennutzung lassen sich hier teils erstaunliche Beziehungen zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialstrukturen aufzeigen. Pittsburgh, noch in den 70er Jahren wegen seiner enormen Luftverschmutzung und den daraus resultierenden Gesundheitsschäden „deadly smoky city" der USA genannt, entwickelte auf der Ebene der örtlichen Regierung im Allegheny County besonders strenge Emissionsvorschriften, die wesentlich zum Zustandekommen des heute in den USA allgemein gültigen „clean air act" beitrugen.
Weitere, vielfältige Probleme ergeben sich nach Angaben des Director Environmental Policy Studies der Univ. of Pittsburgh heute vor allem noch in den Umweltmedien
[Seite der Druckausg.: 26]
Boden und Wasser, z.B. durch die Belastung von Grundwasser mit organischen Chemikalien oder deren Abbauprodukten. Insgesamt müsse man in den USA heute von der enormen Zahl zwischen 300.000 und 500.000 Altlasten ausgehen, von denen zwangsläufig eine erhebliche Zahl in und um Pittsburgh vorzufinden seien. Es handle sich beispielsweise um stillgelegte Stahlwerke oder Kokereien auf Flächen von bis zu 170 acres (rund 70 Hektar), die teilweise weniger als 3 km vom Stadtzentrum entfernt lägen. Ihre Revitalisierung sei mit erheblichen Kosten verbunden. So habe unlängst die Stadt zwei 130 und 170 acre große „brownfields" zu einem Preis von 75.000 $/acre erworben, d.h. insgesamt 9,7 und 12,7 Mio. $, um sie in einer Mischbesiedlung von Kaufhäusern, Gewerbe, Dienstleistern und Wohneinheiten zu revitalisieren. Die Kosten, die der Vorbesitzer für die Reinigung der größeren Fläche aufzubringen habe, bewegten sich zwischen 30 und 50 Mio. $. Für eine andere, kleinere Fläche, die von der US Army als Munitionslager genutzt wurde, mußten insgesamt 37,5 Mio. $ ausgegeben werden, um sie für die Nutzung durch ein Galvanikunternehmen wirtschaftlich interessant zu machen.
1.3 Luxemburg
Luxemburg betreibt nach Aussagen des Direktors des luxemburgischen Sozial- und Wirtschaftsforschungsinstituts CEPS/INSTEAD schon seit den 50er Jahren eine ausgeprägte Politik zur Unterstützung der industriellen Diversifizierung, mit dem Erfolg, daß auch die am klassischen Stahlstandort keineswegs spurlos vorübergegangene Strukturkrise heute erfolgreich bewältigt scheint. Es stellt sich damit unmittelbar die Frage, inwieweit diese Entwicklung übertragbar ist. Beruht der luxemburgische Erfolg auf einem eher atypischen, kaum auf andere Regionen übertragbaren Modell, handelt es sich um eine Art Gegenmodell mit Alternativcharakter für Andere oder geht es lediglich um einen interessanten Zufall, der sich aber zum Nachdenken über das jeweils eigene Vorgehen eignet?
Um diese Fragen besser beantworten zu können, soll zunächst versucht werden, ein möglichst klares und überschaubares Abbild des luxemburgischen Weges und der individuellen luxemburgischen Grundvoraussetzungen zu erhalten. Dazu ist auch ein Blick in die historische Entwicklung und die gesamtpolitischen Rahmenbedingungen hilfreich. Luxemburg hat in seiner langen Geschichte unter der Herrschaft von vielen Staaten bzw. Dynastien gestanden, jedoch letztlich seit dem zehnten Jahrhundert immer den Charakter einer separaten und weitgehend autonomen politischen Einheit bewahrt. Der Wiener Kongreß schuf dann 1814/15 das Großherzogtum Luxemburg als deutschen, jedoch mit den Niederlanden in Personalunion verbundenen Staat. Er wurde 1866 souverän und ist nach seiner Verfassung von 1868 bis heute eine parlamentarische Erbmonarchie, in der dem Großherzog umfassende Rechte zustehen. 1867 sicherte das Land im Londoner Vertrag ewige Neutralität zu, die erst unter dem
[Seite der Druckausg.: 27]
Eindruck der deutschen Besetzung in zwei Weltkriegen aufgegeben wurde (Nato-Beitritt 1949). Luxemburg war seit der Gründung 1944 der sog. Benelux-Wirtschaftsunion gleichberechtigtes Mitglied und in der Folge führend am Zustandekommen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beteiligt. Heute ist es kleinster Mitgliedsstaat der EU und eines seiner wirtschaftlichen und administrativen Zentren. Mit einem BSP von umgerechnet über 45.000$ pro Kopf
[Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes – Auslandsstatistik – für 1996.]
liegt es mit Abstand an erster Stelle in der EU und zählt insgesamt zu den reichsten Ländern der Welt. Besonders bemerkenswert ist dabei u.a. die Tatsache, daß angesichts der geringen Größe des Landes und damit seines Binnenmarktes 89,1 bzw. 92,7% des BIP auf die Ausfuhr bzw. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen bezogen werden
[Stat. Bundesamt 1994.].
Selbst klassische Handelsnationen wie die Niederlande folgen hier mit erheblichem Abstand. Schon diese Fakten machen deutlich, daß sich Luxemburg in gewisser Hinsicht seit jeher in einer Ausnahmesituation befindet, ohne jedoch lediglich Spielball externer Entwicklungen zu sein. Die jeweiligen luxemburgischen Regierungen haben sich zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg immer aktiv zu dieser Ausnahmerolle bekannt und offenbar erfolgreich versucht, die sie umgebenden Systembedingungen so zu beeinflussen, daß die Existenz und die Sonderwege Luxemburgs gesichert waren (z.B. durch eine enge Beziehung zu den USA bei gleichzeitigem Engagement für eine europäische Staatengemeinschaft).
Dazu gehört seit jeher auch eine gezielte Zuwanderungspolitik, die sich in ihrer Ausprägung deutlich vom deutschen Modell des Umgangs mit Gastarbeitern abgehoben hat. Zum einen holte das katholisch geprägte Luxemburg vorwiegend Ausländer aus religionsverwandten Ländern, vor allem aus Portugal und Italien, ins Land. Zum anderen ließ und läßt das Land einen erheblichen Teil seiner Wertschöpfung von den sog. „frontalliers", also Grenzgängern, erwirtschaften. Auf diese Weise trägt es in nicht unerheblichem Maß auch zur Entwicklung bzw. Stabilisierung der umgebenden Regionen in Frankreich, Belgien und Deutschland bei. Als Konsequenz aus der im Vergleich zum restlichen Europa geradezu dramatisch positiven wirtschaftlichen Entwicklung sind heute z.B. rund 10.000 Arbeitsplätze für Grenzgänger aus Rheinland-Pfalz entstanden, über 2000 für Saarländer, insgesamt rund 35.000 für Bewohner der angrenzenden Regionen Frankreichs und rund 20.000 für Belgier. Der Anteil der Ausländer an der Wohnbevölkerung in Luxemburg beträgt heute über 27% und ist damit höher als in jedem anderen europäischen Land. Dieser extrem hohe Anteil ist nicht zuletzt auf die extrem niedrige Geburtenrate bei den eingesessenen Luxemburgern zurückzuführen. Dennoch ist Luxemburg kaum mit Problemen konfrontiert, wie sie sich aus der typischen Gemengelage sozialer Isolation und finanzieller wie kultureller Benachteiligung ergeben. Im Laufe des 20sten Jahrhunderts hat zudem
[Seite der Druckausg.: 28]
die in der ganzen Welt typische Migration von ländlichen in urbane Regionen auch in Luxemburg stattgefunden.
Industriegeschichtlich hat sich Luxemburg vom schwerindustriellen Standort der 60er Jahre, in dem 80% des Exportvolumens von der Eisen- und Stahlindustrie erwirtschaftet wurden, zum internationalen Finanzzentrum und zum Gastgeber bedeutender europäischer Einrichtungen gewandelt. Die ehemals reichen Eisenerzressourcen gelten spätestens seit den 80er Jahren als erschöpft. Auch die agrarischen Ressourcen dürfen als eher durchschnittlich angesehen werden, so daß die Wurzeln des wirtschaftlichen Erfolges heute mehr denn je eher im Umgang mit Kapital und im flexiblen und erfinderischen Einsatz von Humanressourcen liegen. Der grundlegend erfolgreiche Strukturwandel ist darüber hinaus nach Ansicht des Direktors von CEPS/INSTEAD ebenso das Ergebnis einer traditionell engen Abstimmung zwischen allen gesellschaftlichen Akteuren wie der vergleichsweise hohen Autonomie bei gleichzeitig überschaubaren Verhältnissen. Sie läßt sich seiner Darstellung zufolge am besten entlang zweier Linien verfolgen:
- Zum einen in der Weise, wie sie allen entwickelten Industrieländern und hier im speziellen den schwerindustriellen Gebieten weitgehend gemeinsam ist: Rückgang der landwirtschaftlichen Tätigkeiten, gefolgt vom Rückgang der industriellen Tätigkeiten mit paralleler Entwicklung der Dienstleistungen. Typisch für Luxemburg ebenso wie für die Vergleichsregionen sind die monolithischen Dimensionen der Eisen- und Stahlindustrie, in deren Licht der Strukturwandel überwiegend als massive Entindustrialisierung wahrgenommen wurde.
- Zum anderen entlang individueller luxemburgischer Komponenten: So gab es bis in die 60er Jahre keine nach außen wahrnehmbaren massiven Veränderungen, obwohl die Politik schon in den frühen 50er Jahren nicht nur den Veränderungsbedarf erkannte, sondern auch konsequent den Grundstein für eine industrielle Diversifizierung legte. Die tiefergehenden Veränderungen vollzogen sich dann in den 70er Jahren, ohne jedoch - zumindest laut etablierten makroökonomischen Indikatoren wie BIP oder Arbeitslosenzahlen - das Schicksal der anderen Regionen in Hinsicht auf die zum Teil erheblichen Verwerfungen zu teilen. Zu der insgesamt positiven Entwicklung trug im wesentlichen das außergewöhnlich kräftige Wachstum des Bankensektors bei.
Um die Bewältigung der Strukturkrise entlang der zweiten Linie genauer zu verfolgen, bietet es sich an, Luxemburg als Teil eines Großraumes zu betrachten, der insgesamt unter der Stahlkrise gelitten hat, zumal seit jeher viel Erwerbsarbeit in Luxemburg von Grenzgängern geleistet wird, die aus Lothringen, Wallonien und Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland kommen. Jedes dieser Gebiete hat sich auf der
[Seite der Druckausg.: 29]
Basis seiner spezifischen Voraussetzungen und Ressourcen mit dieser Entwicklung auseinandergesetzt. Die verschiedenen Entwicklungsverläufe lassen sich beispielhaft an der Entwicklung der Einwohnerzahlen, des Bruttoinlandsprodukts BIP über die Jahre und nicht zuletzt an der Beschäftigungsentwicklung skizzieren (Tab. 4 und Abb. 2).
Tab. 4: Bevölkerungsentwicklung und Entwicklung des BIP pro Kopf in Luxemburg und angrenzenden Regionen.
Region/Bezirk |
Bevölkerungsentw.
|
BIP pro Kopf 1998
|
Belgien |
| |
Hainaut |
+ 0,1 |
83 |
Brabant-Wallon |
+ 14,9 |
82 |
Namur |
+ 6,3 |
85 |
Liège |
+ 2,3 |
104 |
Province de Luxembourg |
+ 8,3 |
100 |
Deutschland |
| |
Saarland |
+ 2,9 |
106 |
Reg.Bez. Trier |
+ 8,0 |
89 |
Reg.Bez. Rheinhessen-Pfalz |
+ 10,7 |
92 |
Reg.Bez. Koblenz |
+ 10,9 |
108 |
Frankreich |
| |
Vosges |
- 1,8 |
|
Moselle |
+ 0,7 |
Lothringen insg. 94 |
Meuse et Moselle |
- 0,7 |
|
Meuse |
- 3,3 |
|
Luxemburg |
+ 11,1 |
169 |
* Zur besseren Interpretation seien die Zahlen der Gesamtbevölkerung in den Regionen vermerkt (Stand 1.1.97): Rheinland-Pfalz 4,0 Mio., Luxemburg 0,4 Mio., Lothringen 2,3 Mio., Saarland 1,1 Mio., Wallonien 3,3 Mio.
Aus den Darstellungen ergibt sich u.a., daß Luxemburg das bei weitem höchste BIP pro Kopf erwirtschaftet, und daß es de facto einen Arbeitsplatzüberschuß gibt. Auch der Index für das Wohlstandsniveau ist vom Vergleichswert 100 im Jahr 1985 auf über 160 heute gestiegen. Die Probleme der Armut halten sich dabei im Vergleich zu den europäischen Nachbarn in Grenzen. Im Vergleich zu den USA, wo das Wirtschaftswachstum überwiegend ohne die Schaffung neuer Arbeitsplätze stattgefun-
[Seite der Druckausg.: 30]
den hat (sog. jobless growth), entstehen zudem in Luxemburg im Mittel 6000 Arbeitsplätze pro Jahr neu, davon rund 1000 für Neubürger.
Abb. 2: Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in Luxemburg und angrenzenden Regionen (1975 = 100).
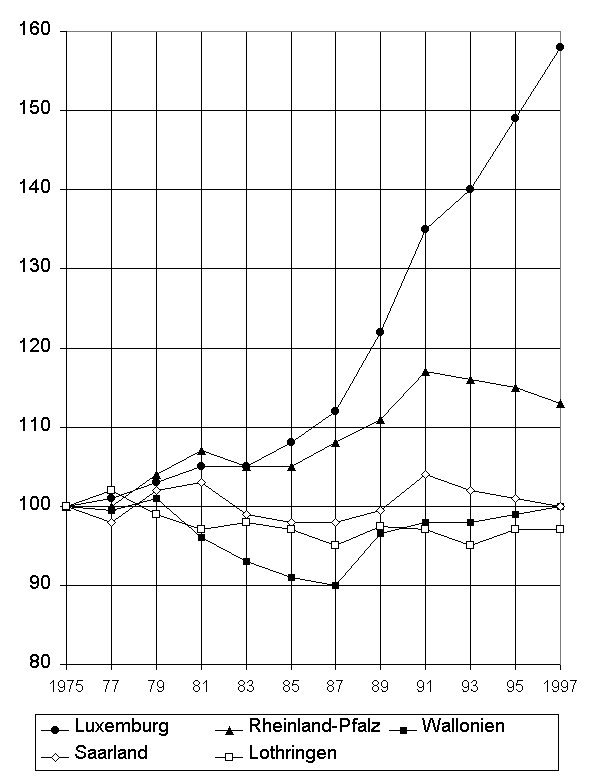
Quelle: Schaber G., CEPS/INSTEAD nach: Eurostat
Diese Entwicklung war möglich, obwohl sich Luxemburg bestimmten Rahmen
[Seite der Druckausg.: 31]
bedingungen des allgemeinen Strukturwandels nicht entziehen konnte. So sank auch in Luxemburg die Zahl der Stahlarbeitsplätze seit den frühen 50er Jahren von 18.000 auf heute unter 5.000. Aus ehemals 25 Hochöfen und sieben Stahlwerken wurden drei kleinere Elektrostahlwerke und sieben Walzstraßen.
Strukturen und Institutionen zur Bewältigung des Strukturwandels
Während der weltweiten Stahlkrise der 70er Jahre reagierte man anfangs, indem die im Land ansässigen Unternehmen restrukturiert und unter einem Dach vereint wurden. Der sog. ARBED-Konzern entstand (Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange), dessen weitere Entwicklung u.a. auch für die Stahlindustrie des Saarlandes entscheidend war (ARBED-Saarstahl). Im Zuge des weiteren Rückganges der westeuropäischen und nordamerikanischen Stahlproduktion wurde die industrielle Produktion in Luxemburg dann jedoch schließlich weitgehend auf andere Branchen verlagert, z.B. Reifenproduktion, Chemie, Metallverarbeitung. Der Anteil der Stahlindustrie (einschließlich der metallverarbeitenden Industrie) am Bruttoinlandsprodukt ist von rund 30% in seiner Blütezeit auf heute rund 2% gesunken - ein Wert, der in seiner Größenordnung in etwa dem heutigen Beitrag der Landwirtschaft entspricht.
Der Anteil der Banken am BIP hingegen ist nach einer in den ersten Jahrzehnten kaum wahrnehmbaren Steigerung seit 1970 sprunghaft von 4% auf etwa 20% gestiegen. Noch 1979 waren lediglich 39 Banken in Luxemburg vertreten, heute sind mehr als 200 Bankinstitute aus 22 Ländern und insgesamt über 800 Kredit- und Versicherungsinstitutionen in Luxemburg tätig. Der Sektor Banken und Versicherungen stellt 10% der inländischen Arbeitsplätze, er erwirtschaftet 20% des BIP und entspricht in etwa einem Drittel des Staatshaushaltes. Insgesamt sind rund zwei Drittel der luxemburgischen Arbeitsplätze heute im weiteren Sinne dem Dienstleistungsbereich zuzuordnen, annähernd ein Drittel ist in Industrie und Handwerk beschäftigt, der verbleibende kleine Rest in der Landwirtschaft.
Diese Entwicklung sei kein Zufall, so der Direktor von CEPS/INSTEAD, sondern die Folge einer auch mit Hilfe der Politik geförderten Diversifizierung bzw. grundsätzlich einer stetigen, intensiven und handlungsorientierten Auseinandersetzung mit dem Strukturwandel. Tab. 5 gibt eine Übersicht über die Entwicklung des ökonomischen Wandels in den Jahren 1975 bis 1997.
[Seite der Druckausg.: 32]
Tab. 5: Übersicht über die Entwicklung des ökonomischen Wandels in Luxemburg von 1975 bis 1997.
1975 – 1997 Entwicklung der ... |
Prozentuale Veränderung |
Kommentar |
Bevölkerung |
+ 11 % |
In etwa vergleichbar mit benachbarten deutschen Regierungsbezirken, in benachbarten Regionen Belgiens hingegen geringeres Wachstum, in denen Frankreichs Nullwachstum bis Verluste. |
Inlands-Beschäftigung |
+ 44 % |
Die Umstrukturierung vollzieht sich überwiegend durch die Entwicklung des DL-Sektors, aber auch durch den Erhalt und die Erneuerung von Industrietätigkeiten außerhalb der Metallbranche. |
Lohnbeschäftigung |
+ 58 % |
Starker Kontrast zu allen umgebenden Regionen (vgl. Abb. 2), die angesichts eines in etwa gleichbleibenden Angebots an Lohnbeschäftigung bei gleichzeitig deutlich mehr Arbeitssuchenden mit hohen Arbeitslosenzahlen zu kämpfen haben. In Luxemburg existiert de facto ein Arbeitsplatzüberschuß. |
Arbeitslosigkeit |
+ 1,8% |
Heute 2,8%, prozentuale Veränderung bezogen auf 1975 lediglich 1%. |
Wertschöpfung aus industrieller Produktion |
- 35 % |
Massive Verluste in der Eisen- und Stahlbranche, aber neu geschaffene Industrie bringt rund 11.000 neue Arbeitsplätze. |
Wertschöpfung im Bausektor |
+ 45 % |
Das Wachstum entspricht der günstigen Entwicklung der Wirtschaft in ihrer Gesamtheit. |
Dienstleistungen (marktbezogen) |
+ 109 % |
Branchen mit besonderem Wachstum: - Transport und Kommunikation +74% - Kredit und Versicherung +214% - Übrige DL +288%. |
Dienstleistungen (nicht marktbezogen) |
+ 102 % |
Inkl. 12.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Verwaltung. |
Ein Ende des ökonomischen Wandels sei auch heute nicht absehbar. Man diskutiere schon jetzt, welche weiteren Schritte zu unternehmen seien, falls sich der ebenfalls
[Seite der Druckausg.: 33
zerbrechliche Wirtschaftsfaktor Banken eines Tages nicht mehr als tragfähig erweise. Diversifizierung und Antizipation seien auch für die Zukunft gefragt.
Eine Auswahl wichtiger Meilensteine dieser bis heute im Zentrum der luxemburgischen Strategie stehenden Politik der Diversifizierung und Antizipation zeigt die folgende Tab. 6:
Tab. 6: Auswahl wichtiger Ereignisse in der (wirtschafts-)politischen Entwicklung Luxemburgs.
Jahr |
Ereignis |
1949 |
Niederlassung des US-Konzerns Goodyear |
1952 |
Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl mit Vermittlerrolle und Sitz in Luxemburg |
1958 |
Schaffung der Europäischen Wirtschaftsunion |
1962 |
Rahmengesetz zur systematischen Diversifizierung |
1968 |
Rahmengesetz für den Mittelstand |
1974 - 1980 |
Kontinuierlicher Ausbau von Maßnahmen zur Stärkung der nationalen Solidarität, u.a.
|
1977 |
Schaffung der Société Nationale du Credit a l’Investissement |
1986 |
Anpassung der Mittelstandsgesetzgebung an eine regionale Perspektive; Schaffung des „pole européen de developpement" zur Förderung grenzüberschreitender Wirtschaftsaktivitäten in der Region |
1990 |
Gesetz über Vorruhestandsregelungen zur Vermeidung von Entlassungen |
1993 |
Gesetz über Maßnahmen zugunsten der Einstellung älterer Arbeitsloser und Langzeitarbeitsloser |
1995 |
Gesetz zur finanziellen Beihilfe für Unternehmen, die Berufsschülern während ihrer Ausbildung Praktikumsplätze anbieten |
1999 |
Grundlegendes Gesetz zu einem nationalen Beschäftigungsplan |
[Seite der Druckausg.: 34]
Die Gesetzgebung fördere beispielsweise nicht nur den Dienstleistungssektor, von 200 neugeschaffenen Betrieben seien derzeit sogar rund 90% im Bereich der industriellen Fertigung angesiedelt. Der Staatssektor sei gleichzeitig enorm geschrumpft, der zwangsläufig in diesem Sektor notwendig werdende Arbeitsplatzabbau sei mit Hilfe von Sozialplänen aufgefangen worden. Beispielsweise habe man übergangsweise gemeinnützige Beschäftigung aus Steuermitteln finanziert. Insgesamt habe sich hier das sog. „système tripartite" mit seiner engen (und institutionalisierten) Kooperation von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Staat sehr bewährt. Im Gegensatz zum deutschen Bündnis für Arbeit, das erst nach langer Zeit und unter dem Druck offenbar unlösbarer Gegensätze zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern sowie den bekannten Problemen am Arbeitsmarkt zustande kam, hat die regelmäßige Einbeziehung der Politik als Moderator im luxemburgischen système tripartite eine selbstverständliche Tradition und wird als ständige Einrichtung begriffen.
Umweltaspekte
Wählt man die wesentlichen Beiträge zur Wertschöpfung in Luxemburg als Ansatz für die Einbeziehung von Umweltaspekten, dann müßten Themen wie nachhaltigkeitsorientierte Investmentfonds [wie sie z.B. in der Schweiz aktuell sind, vgl etwa SAM – Sustainable Asset Management..] , Rahmensetzungen im internationalen Handel oder z.B. auch die Auswirkungen der IuK-Technik auf den globalen Energie- und Rohstoffverbrauch eine besondere Rolle spielen. Hier konnte jedoch kein besonderes Engagement, weder im Rahmen der Tagung noch in weitergehenden Medienrecherchen ermittelt werden. Offene umweltpolitische Kontroversen beschränken sich in Luxemburg i.w. auf einzelne Schadstoffaspekte wie z.B. den weiteren Einsatz ozon- und klimaschädlicher Stoffe in der Chemieproduktion. Über lokale Altlasten aus der ehemaligen Stahlproduktion konnten keine Informationen recherchiert werden.
Das Bewußtsein über globale Erfordernisse einer nachhaltigen Entwicklung erscheint trotz der vergleichsweise guten Verfügbarkeit von Daten, z.B. bei dem in Luxemburg ansässigen und in dieser Hinsicht durchaus engagierten Statistischen Amt der EU (Eurostat) weder bei der Regierung noch bei den im Land ansässigen Banken und Versicherungen sonderlich ausgeprägt zu sein. Anders kann kaum erklärt werden, daß Luxemburg auf diesem zukunftsträchtigen Gebiet bislang keine führende Rolle spielt, ganz entgegen der sonst immer wieder unter Beweis gestellten Fähigkeit zu vorausschauendem Handeln.
[Seite der Druckausg.: 35]
1.4 Lille und sein Umland
Lille, einst regionales Zentrum in der französischen Peripherie, wird immer mehr zum wichtigen Knotenpunkt im Entwicklungskorridor zwischen den briti-schen Inseln und dem kontinentalen Europa. Ursprünglich war, ähnlich wie im Ruhrgebiet, die Kohle zentraler Drehpunkt für die Ansiedlung von Industrien, und so hat sich seit Beginn des industriellen Zeitalters nördlich eines Gürtels von Kohlenzechen, der sich vom französischen Bethune über Valenciennes bis zum belgischen Charleroi erstreckte, die Textilindustrie und östlich davon um Maubeuge die Metallgewinnung und –verarbeitung zu einer bedeutenden Industrieregion zusammengeballt. Dementsprechend stieg zwischen 1850 und 1910 die Bevölkerung in Lille und Umgebung von 50.000 auf über 800.000 Menschen, vor allem als Folge einer einmaligen Blüte des Textilsektors. Lille wurde das wichtigste Zentrum des europäischen Textilhandels, hinzu kamen aber auch über 200.000 Beschäftigte in den Kohlenzechen der Region. Bis 1910 war die Region um Lille (Nord-Pas de Calais) zur wichtigsten Industrieregion Frankreichs aufgestiegen. Diese Entwicklung setzte sich über zwei Weltkriege bis in die 50er Jahre fort.
In den darauffolgenden Jahrzehnten bis heute hat diese klassische Industrieregion in ähnlicher Weise wie die zuvor beschriebenen Regionen Ruhrgebiet, Pittsburgh und Luxemburg eine intensive Strukturkrise durchlitten, bei der über 200.000 Arbeitsplätze verloren gingen. Bereits Ende der 50er Jahre begann, ähnlich wie im Ruhrgebiet, der Abstieg in die Rezession, für den ein komplexes Ursachengemisch ausgemacht werden kann, das u.a. folgende Aspekte umfaßt:
- Die Erfindung und breite Verwendung synthetischer Fasern führten zu einem strukturellen Umbruch in der Textilindustrie;
- Lieferstrukturen, Arbeitsmärkte und Rohstoffpreise wandelten sich im Zuge der Entkolonialisierung der dritten Welt;
- die Globalisierung durch neue Telekommunikationsmöglichkeiten, neue Fertigungstechnologien und damit neue Markstrukturen führte schließlich auch hier zu zunehmender Konkurrenz.
Als Folge verlagerten sich große Teile der europäischen Textilindustrie in die ehemaligen Kolonien bzw. Länder der dritten Welt. Hinzu kam die Strukturkrise im Montan- und Stahlbereich, von der auch Lille nicht verschont blieb ( Tab. 7):
[Seite der Druckausg.: 36]
Tab. 7: Drei Phasen des Strukturwandels am Beispiel des Montansektors der Region Nord-Pas-de-Calais
Zeitraum |
Entwicklung |
Anmerkungen |
Phase 1 1960 - 1968 |
Arbeitsplätze aus dem Bergbau werden in zwei anderen regional etablierten Sektoren ersetzt: Maschinenbau und Bekleidung. |
Der Wandel geht mit einer deutlichen Feminisierung der Arbeitsplätze einher. |
Phase 2 1968 - 1975 |
Abkehr von der Idee einer internen Konversion auf der Basis vorhandener Strukturen. Als neue Bereiche kommen hinzu: Automobilindustrie, Plastik- und Metallverarb., Industriebau, Elektroindustrie. |
Der überwiegende Teil der neuen Arbeitsplätze ist für Männer. Die Krise im Textilsektor führt zu besonderer Erwerbslosigkeit bei Frauen. |
Phase 3 1975 - 1996 |
Zu Beginn Stagnation in allen Sektoren, steigende Zahl von Insolvenzen bei Firmenneugründungen, breite Rezession. Seit 1985 ein Schub in Richtung tertiärer Sektor, der gedämpft bis heute anhält. |
Weiterer Rückgang um 100.000 Arbeitsplätze, Arbeitslosigkeit 1996 bei über 16%, Abwanderungsrate bei jährlich ca. 4,2%. |
Auf diese Weise gingen binnen dreier Jahrzehnte rund 200.000 Arbeitsplätze verloren, das entspricht rund der Hälfte aller Arbeitsplätze in der Metropole Lille. Diese Entwicklung konnte bis heute nicht aufgehalten werden, und so gab es 1996 in Lille und Umgebung 100.000 Arbeitsplätze weniger als 1976. Allein seit 1990 hat die Region nach Angaben des Referenten rund 12.600 Arbeitsplätze verloren, etwa doppelt soviel wie der nationale französische Durchschnitt. Zwischen 1982 und 1990 war die Arbeitsplatzentwicklung kurzfristig von Hoffnung gekennzeichnet, denn ein spektakulärer Wandel von Industriearbeitsplätzen zum tertiären Sektor fand statt. Natürlich entstanden auch nach 1990 weiterhin neue Arbeitsplätze im tertiären Sektor, jedoch nicht in gleichem Ausmaß wie zuvor. Heute beläuft sich die Arbeitslosenrate in der Region Nord-Pas-de-Calais auf 16,3%, davon sind wiederum 39,3% Langzeitarbeitslose und 23% jünger als 25 Jahre. All diese Zahlen liegen über dem französischen Durchschnitt. Dementsprechend hoch ist die Migrationsrate von minus 4,2% jährlich, die höchste in Frankreich. Das verfügbare Bruttoeinkommen ist mit 73.400 FF pro Haushalt und Jahr das niedrigste in Frankreich. Bezüglich der Armutssituati-
[Seite der Druckausg.: 37]
on bzw. den damit verbundenen Ausgaben für Sozialhilfe belegt die Region Platz zwei hinter Korsika.
Strukturen und Institutionen zur Bewältigung des Strukturwandels
Lille ist trotz dieser dramatischen Einbrüche in relativ kurzer Zeit heute wieder zu einem der wichtigsten urbanen Zentren Frankreichs aufgestiegen. Allein 1998 haben sich 52 ausländische Unternehmen neu in Lille angesiedelt.
[Vgl. den Artikel „For fear of McJobs" im Economist vom 5. Juni 1999. ]
So konnten nach Auskunft des Referenten von CEPS die ca. 200.000 verlorenen Stellen zwischenzeitlich durch Stellen in folgenden Sektoren annähernd ausgeglichen werden:
- In der Textilindustrie selbst blieben noch ca. 20.000 Stellen erhalten;
- die Profilierung von Lille als medizinisches Zentrum für weite Teile Nordfrankreichs und angrenzender belgischer Gebiete erbrachte ca. 13.000 neue Stellen;
- durch e-commerce-Aktivitäten entstanden ca. 25.000 Stellen;
- im Nahrungsmittelsektor einschließlich der dazugehörigen Logistik entstanden insgesamt ca. 45.000 Stellen;
- darüber hinaus entstanden durch den generellen Ausbau von Lille als Logistikzentrum ca. 50.000 weitere Stellen;
- weitere Stellen entstanden im politisch-administrativen Bereich (Lille als Hauptstadt einer Region mit über 4 Mio. Einwohnern);
- nicht zuletzt bietet auch der Wissenschafts- und Schulbereich mit insgesamt über 100.000 Studenten an vier Universitäten und 17 (Fach-) Hochschulen ein erhebliches Beschäftigungspotential.
Insbesondere die Vielzahl neuer Arbeitsplätze im Logistikbereich beruht auf der Rolle von Lille als Verkehrsknotenpunkt. Gerade angesichts der traditionellen französischen Verkehrsstrukturen, die auf die zentralen Verbindungen zu Paris ausgelegt waren, haben sich für Lille neue Chancen ergeben. Heute haben sechs der zehn größten französischen Unternehmen des Logistikbereichs ihren Sitz in Lille, denn die Transportwege plazieren Lille in einer ausgezeichneten strategischen Position. Besonders erwähnenswert sind hier z.B. die Autobahnachsen von Antwerpen und Rotterdam über Gent nach Paris oder auch nach Strasbourg und Süddeutschland oder die Achse London über den Kanal-Tunnel nach Brüssel und weiter nach Düsseldorf und in das Ruhrgebiet. Weiter ist Lille ein Bahnknotenpunkt für Hochgeschwindigkeitszüge, mit denen Paris in einer Stunde, Brüssel in 30 Minuten oder London in weniger als zwei Stunden erreichbar sind. Die Flughäfen Roissy, Brüssel und Lille-
[Seite der Druckausg.: 38]
Lenquin (die letzten beiden mit jeweils über 1 Million Passagieren und hohen Frachtkapazitäten) tun ein übriges.
Mit den sich wandelnden Ansprüchen an die Güter- und Personenmobilität im vereinten Europa hat Lille seine alte Rolle als europäischer Verkehrsknotenpunkt nach Einschätzung des Referenten von CEPS/INSTEAD bereits heute in hohem Maße wiedergefunden und wird sie in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Man müsse bedenken, daß in einem Radius von 300 km über 100 Millionen Menschen mit hoher Kaufkraft leben. Zudem leben in der Region Nord-Pas-de-Calais selbst rund 4 Mio. Menschen, von denen 40% jünger als 26 Jahre seien - damit sei es die Region Frankreichs mit der jüngsten Bevölkerung.
Hinzu komme, daß Lille für Belgien, die Niederlande und auch für Großbritannien das Tor nach Frankreich darstelle und damit auch den ersten Zugang zu den großen südeuropäischen Märkten. Umgekehrt stelle Lille für einen Großteil der Warenströme aus diesen Märkten einen obligatorischen Kreuzungspunkt auf dem Weg in die Niederlande, nach Belgien und Großbritannien dar. Schließlich dürfe die Lage in unmittelbarer Nähe des Meeres bzw. großer Häfen nicht vergessen werden.
Auf der Basis dieser strategischen Vorteile planen die Stadt- bzw. Regionalplaner Großes für die Region: Nachdem die drei großen Ereignisse 1) Tunnel unter dem Ärmelkanal, 2) TGV-Halt in Lille und 3) der Europäische Binnenmarkt neue Türen geöffnet haben, soll die urbane Region Lille mit ihren über 100 kleinen Kommunen und insgesamt über 1,6 Mio. Einwohnern bis zum Jahr 2015 zu einem der wichtigsten europäischen Zentren für Unterkunft, Umwelt, Transport und Kommunikation werden (ähnlich wie dies auch verschiedene Städte des Ruhrgebiets anstreben). So entsteht u.a. ein Servicezentrum für Telekommunikation als „Euro-Teleport" in Roubaix bei Lille, und weitere Servicezentren, z.B. im Gesundheitssektor oder für den Logistikbereich sind geplant. An der Kreuzung der Hochgeschwindigkeitszüge London-Brüssel und Südfrankreich-Paris-Amsterdam bzw. Ruhrgebiet entstand unter dem Namen Euralille ein Geschäfts- und Freizeitzentrum auf rund 300.000 m2 in unmittelbarer Nähe des TGV-Bahnhofs Lille-Europe.
Diese modernen Ergänzungen der Innenstadt kontrastieren mit dem ebenfalls durchgängig sanierten Altstadtviertel in flandrischer Architektur. Insgesamt ist man sich aber der besonderen Bedeutung einer baulichen Harmonisierung bewußt, denn mangels natürlicher „Vorzüge" (Fluß, Panorama etc.) müssen Urbanität, Lebensqualität und Attraktivität in besonderem Maße durch die gebaute Umwelt geschaffen werden.
[Seite der Druckausg.: 39]
Auch dem öffentlichen Personennahverkehr wird in Hinsicht auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Region besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Lille setzt auch hier auf innovative technologische Konzepte: So wird die Metropole von einer vollautomatischen Untergrundbahn (VAL) bedient, die in der Region gebaut und zudem in regionalen Forschungszentren entwickelt wurde. Das System konnte bislang erfolgreich nach Toulouse, nach Atlanta und Jacksonville (beide USA) und nach Taipeh (Taiwan) exportiert werden. Weitere U-Bahnen, Hochgeschwindigkeitszüge und das „Shuttle" unter dem Ärmelkanal werden bereits in der Region hergestellt.
Man ist bemüht, diese Erfolge zu einem weiteren Kristallisationspunkt für die Ausweitung der Aktivitäten im gesamten Sektor Bahnkonstruktion und Transportforschung werden zu lassen. Für das Jahr 2015 wird allein für die VAL ein Passagieraufkommen von 15 Mio. Passagieren jährlich angestrebt, und sie soll grenzüberschreitend auch die zwei nächstliegenden belgischen Städte erreichen.
Aus der Nähe zum Nachbarland Belgien ergeben sich im zusammenwachsenden Europa weitere Einflüsse auf die Entwicklung der Metropole. Mittelfristiges Ziel ist letztlich die Schaffung einer „métropole lilloise transfrontalière" mit einer Bevölkerung von rund zwei Mio. Menschen im Umkreis von 30 km. Schon seit 1991 kooperieren interkommunale und kommunale Strukturen auf französischer und belgischer Seite (in Flandern und Wallonien) projekt-, d.h. einzelfallbezogen, und 1998 hat man erstmals begonnen, in einem auf drei Jahre konzipierten Vorhaben ein gemeinsames Entwicklungskonzept unter Beteiligung aller fünf interkommunalen Strukturen auf französischer wie belgischer Seite zu erarbeiten. Dieses Entwicklungskonzept für eine grenzübergreifende Metropolregion wird unter dem Namen TERRA von der Europäischen Kommission unter dem Gesichtspunkt „Neue Ansätze in der Raumplanung" gefördert.
Nicht zuletzt sollen die lokalen kulturellen Möglichkeiten ausgebaut und international vermarktet werden, von den rund 20 Museen über Theater- und Konzerthallen bis zu ortsansässigen Orchestern bzw. Ensembles. So wurde z.B. ein Tanz- und Vergnügungslokal aus dem Beginn des Jahrhunderts, unter Schirmherrschaft des französischen Kulturministeriums als „studio national des arts contemporains" wiedereröffnet. Die Einrichtung ist einmalig in ihrer Art und steht international als Ausbildungsort für Künstler (Postgraduierung) und für Ausstellungen zur Verfügung. Auf der Suche nach einer neuen Identität hat man sich sogar um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2004 beworben.
Über diese, überwiegend auf lokalen Stärken beruhenden Ansätze hinaus kann die Entwicklung der Region um Lille nur unter Berücksichtigung des generellen politisch-wirtschaftlichen Rahmens in Frankreich verstanden werden. Anders gesagt: Viele
[Seite der Druckausg.: 40]
der Probleme, unter denen die Region zu leiden hat, sind zu einem erheblichen Anteil auf gesamtfranzösische Problemlagen zurückzuführen. Dazu gehören z.B. die im internationalen Vergleich nach wie vor sehr hohe strukturelle Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit, die sich seit den 70er Jahren entwickelt hat. Einem McKinsey-Report zufolge haben sich zwischen 1970 und 1995 die Arbeitsstunden pro Kopf im nichtöffentlichen Dienstleistungsbereich mehr als verdoppelt. In Frankreich hingegen haben sie sich im gleichen Zeitraum halbiert. Hinzu kommen hohe Lohnnebenkosten und ein traditionell dichtes Netz an staatlichen Regularien rund um den Arbeitsmarkt und die soziale Sicherung. So sind z.B. Zeitarbeit, ja sogar befristete Verträge nach wie vor heftig umstritten, und die meisten Franzosen gehen mit 55 (viele öffentliche Bedienstete mit 50) Jahren in den Ruhestand – eine kostenträchtige Angelegenheit für das öffentliche Rentensystem. Mit rund 10% des Bruttosozialprodukts sind zudem die Gesundheitskosten so hoch wie in keinem anderen Land der EU.
Verschiedene Programme zur Verbesserung dieser Rahmenbedingungen sind seit dem Regierungswechsel 1997 initiiert worden, darunter ein allgemein als erfolgreich beurteiltes Programm zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit. Mit Hilfe dieses Programms unter der Schirmherrschaft der Ministerin Aubry, die gleichzeitig stellvertretende Bürgermeisterin von Lille ist, konnten bislang über 180.000 Jugendliche einen in der Regel zu 80% vom Staat subventionierten Arbeitsplatz erhalten. Die Gesamtkosten für dieses Programm belaufen sich auf rund 35 Mrd. FF, und Kritiker sehen dies als Teil eines neuen, umfangreicheren Problems
[Vgl. Artikel des Economist, a.a.O.].
Der gesamte französische Arbeitsmarkt ist in besonders hohem Maße staatlich subventioniert. So ist einer OECD-Untersuchung zufolge zwischen 1973 und 1997 die Gesamtzahl der subventionierten Arbeitsplätze in Frankreich von 100.000 auf über 2,2 Mio. gestiegen, während sich gleichzeitig die Gesamtzahl an nicht subventionierten Arbeitsplätzen von 21,4 auf 20,3 Mio. verringert habe. Um dieses steigende Maß an Subventionierungen finanzieren zu können, sei das System quasi gezwungen, die Lohnnebenkosten ebenfalls hoch zu halten. Damit steht das französische Modell im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Weg einer substantiellen Senkung der Lohnnebenkosten, wie er auch von den meisten übrigen westeuropäischen Ländern bevorzugt wird.
Die französische Regierung vertritt diesen Weg mit Selbstbewußtsein: „Wenn der private Sektor seine Hausaufgaben nicht machen will, dann will ich, daß der öffentliche Sektor diese Aufgabe übernimmt" sagte sinngemäß der frühere französische Finanzminister Strauss-Kahn. In Frankreich ist der OECD-Untersuchung zufolge auf diese Weise inzwischen nahezu ein Viertel der französischen Arbeitskraft an öffentli-
[Seite der Druckausg.: 41]
che Unterstützung gekoppelt, entweder in Form von Arbeitslosengeldern oder von subventionierten Tätigkeiten. Kritiker geben zu bedenken, daß die französische Wirtschaft unter diesen Umständen kaum in der Lage sei, flexibel auf Globalisierungseffekte zu reagieren, und daß die Steuerungsaufgabe dem Staat mittelfristig über den Kopf wachsen könnte, vor allem angesichts unterschiedlicher Lohnniveaus in einer EU mit gemeinsamer Währung und weit unterdurchschnittlicher Lohnniveaus im Bereich der Beitrittskandidaten aus Mittel- und Osteuropa.
Umweltaspekte
Wie häufig in Frankreich sind Umweltaspekte im Vergleich zu Deutschland nur selten Gegenstand einer breiten und überregionalen öffentlichen Diskussion. Allenfalls in besonders problematischen Fällen, die angrenzende Bereiche wie die menschliche Gesundheit unmittelbar berühren, finden sich Umweltaspekte in den Schlagzeilen wieder.
Es kann aber davon ausgegangen werden, daß die üblichen Altlastenprobleme einer Kohle-, Stahl- und Textilregion hier ebenso wie in allen Vergleichsregionen zum Tragen kommen. Hinzu kommen „moderne" Problemlagen einer Industrieregion, etwa wenn auf Beschluß der französischen Regierung 1998 die Milch von 16 Erzeugern in der Region wegen zu hoher Dioxin-Werte nicht mehr verkauft werden durfte. Die Schuld dafür wurde Müllverbrennungsanlagen gegeben, die nicht mit der andernorts üblichen Filtertechnologie ausgestattet waren bzw. sind. Nach neuerlichen Meldungen über breite Dioxinbelastungen in Eiern und Fleisch aus Belgien im Laufe des Jahres 1999 gehört die Region damit zu den prominenten Vertretern der mit organischen Giften hoch belasteten Gebiete, in der Aspekte von Emission bzw. Immission im Strukturwandel als Standortrisiko zukünftig verstärkt berücksichtigt werden müssen – eine Aufgabe, in der die regionale „Direction Enivronnement" (DIREN) eine wichtige Rolle spielen muß.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Februar 2001