

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
-
1. Ist nationale Wirtschaftspolitik in Zeiten zunehmender Globalisierung überhaupt noch möglich?
Heiner Flassbeck
1. Ist nationale Wirtschaftspolitik in Zeiten zunehmender Globalisierung überhaupt noch möglich?
1.1 Globalisierung und internationale Kooperation
Globalisierung und Rechtsordnung
Eine funktionierende Marktwirtschaft verlangt die Schaffung und Durchsetzung von Regeln. Der Markt ist effizient bei der Verteilung der vorhandenen Ressourcen. Diese Effizienz ist aber nur gewährleistet, wenn alle Akteure rein ökonomisch rationalen Handlungsmustern folgen, also etwa Mißbrauch der Vertragsfreiheit oder Betrug ausgeschlossen sind. Wo immer ein Markt entsteht oder wohin immer sich bestehende Märkte ausdehnen, das Regelsystem, das ihre Funktionsfähigkeit garantiert, muß mitentstehen oder mitwachsen. Ob es sich dabei um kodifizierte Rechtsnormen oder ungeschriebene Verhaltensregeln im Sinne der Handlungsweisen des ehrbaren Kaufmanns handelt, ist nicht entscheidend.
In der Tat ist in den westlichen Industrieländern das Rechtssystem dem Marktsystem gefolgt. Existierte vor dem Ausbau der Handelswege vor allem die Rechtsordnung der Städte und Gemeinden, die die Märkte (im wahrsten Sinne des Wortes) regulierte, so entstanden mit der zunehmenden Arbeitsteilung und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, über die Städte- und Gemeindegrenzen hinweg zu handeln, auch übergreifende Rechtssysteme. In diesem Jahrhundert entwickelten sich daraus weltumspannende Übereinkünfte, die nationale Rechtssysteme überlagern und modifizieren.
Regelgebundene internationale Kooperation bedeutet letztlich die Schaffung einer Rechtsordnung, die den wirtschaftlich Handelnden Sicherheit in Fällen gibt, in denen der Partner die prinzipielle Freiheit der Vertragsgestaltung mißbraucht oder auf eine Weise agiert, die den Regeln des ehrbaren Kaufmanns widerspricht. Wer von Globalisierung spricht, muß also immer auch von der Globalisierung des Rechts sprechen.
Diese Globalisierung des Rechts stößt vor allem deswegen auf Widerstände, weil die Dimensionen des wirtschaftlichen Handelns weit über die Dimensionen der relativ statischen nationalen politischen Systeme hinausreichen. Rechtsetzung und Rechtsanpassung ist in demokratisch verfaßten Staaten alleinige Aufgabe der Vertretung des Volkes. Internationales wirtschaftliches Handeln zwingt folglich souveräne nationale Parlamente dazu, mit anderen souveränen Parlamenten zu kooperieren, um länderübergreifende Regeln zu schaffen. Diese Art der internationalen Kooperation ist geradezu vital dafür, daß die Chancen der Globalisierung genutzt werden können. Folglich sind die großen internationalen Organisationen entstanden, deren Tätigkeit immer mehr im Mittelpunkt der globalen Wirtschaftspolitik steht.
[Seite der Druckausgabe: 2]
Globalisierung und der Wettbewerb der Unternehmen
Auch der Wettbewerb der Unternehmen im engeren Sinne, also die Art und Weise, wie Unternehmen im Markt agieren und versuchen, sich Vorteile gegenüber ihren Mitkonkurrenten zu verschaffen, stand schon sehr früh im Blickpunkt derer, die für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Regeln verantwortlich waren. Wettbewerb der Unternehmen kann nämlich nur die gewünschten Ergebnisse generieren, wenn der Wettbewerb nicht durch Monopolpositionen oder den Versuch, solche mit wirtschaftlicher Macht zu erreichen, außer Kraft gesetzt wird. Die Vereinigten Staaten beispielsweise entwickelten schon Ende des 19. Jahrhunderts eine sehr differenzierte Anti-Trust-Gesetzgebung.
Einer der Kernpunkte jeder Anti-Trust-Gesetzgebung ist der Versuch, über Anti-Dumping-Regeln unlauteren Wettbewerb der Art zu verhindern, daß ein Unternehmen durch gezielten Einsatz großer wirtschaftlicher Mittel, also beispielsweise unter bewußter Hinnahme von temporären Verlusten in bestimmten Geschäftsfeldern, versucht, andere Wettbewerber auf Dauer aus dem Markt zu verdrängen, um eine Monopolstellung zu erringen. Wie schwer im einzelnen der Nachweis solcher Dumping-Praktiken auch immer sein mag, daß Dumping möglich ist und daß es langfristig für die Konsumenten schädlich sein kann und deswegen eine staatliche Intervention erfordert, ist unbestritten.
Globalisierung und der Wettbewerb von Staaten
Mit der fortschreitenden Globalisierung ist nun die Idee entstanden, nicht nur Unternehmen, sondern auch Staaten stünden im Wettbewerb miteinander, nämlich um den besten Standort für die international agierenden Investoren und um die Verbesserung für die Bedingungen der heimischen exportierenden Unternehmen. Wenn aber schon der Wettbewerb der Unternehmen regelungsbedürftig ist, können und sollten dann Staaten ohne weiteres Wettbewerb miteinander betreiben?
Offensichtlich ist die Gefahr des Mißbrauchs, das heißt des unlauteren Wettbewerbs, beim Wettbewerb der Staaten noch wesentlich größer als bei Unternehmen. Ein Unternehmen, das seine Preise für ein bestimmtes Produkt drastisch senkt, um seine Mitkonkurrenten aus dem Markt zu verdrängen, setzt sich selbst gewissen Risiken aus. Es muß in anderen Geschäftsfeldern stark genug sein, um die Verluste für eine Zeit tragen zu können, schwächt also seine Position kurzfristig, um langfristig Erfolg haben zu können. Bei Staaten gibt es diesen Fall auch. Verzichtet etwa eine Regierung auf den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, um die Steuern für Unternehmen international attraktiv zu machen, mag sie kurz- und mittelfristig erfolgreich sein, auf lange Sicht kann dadurch aber der Standort nachhaltig geschwächt werden.
Staaten verfügen aber über noch weitgehendere Mittel als Unternehmen, wenn es darum geht, die Arbeitsplätze im Inland zu fördern. Regierungen können die Bevölkerung dazu zwingen oder davon überzeugen, daß es notwendig ist, den eigenen
[Seite der Druckausgabe: 3]
Lebensstandard einzuschränken, um Exporterfolge erzielen zu können. Gelingt das, stehen diese Regierungen in der Regel nicht unter einem raschen Erfolgszwang wie Unternehmen, weil die internationale Mobilität der Bevölkerung aus vielerlei Gründen sehr gering ist. Gelingt es folglich einem Land, seinen Gürtel enger zu schnallen, also weit unter seinen Verhältnissen zu leben, kann es sehr nachhaltig in die internationalen Märkte eingreifen und die Marktergebnisse zu seinen Gunsten manipulieren.
Erstaunlicherweise ist das im Falle staatlicher Subventionen vollkommen unbestritten. Bestritten wird es aber schon im Falle von Steuersenkungen, dem sog. Steuerwettbewerb, oder gar im Falle von Lohndumping über ein systematisches Zurückbleiben der Lohnzuwächse hinter dem Produktivitätszuwachs.[Vgl. Herbert Giersch: Der lachende Dritte, in: Wirtschaftswoche Nr. 39, 1997; Oskar Lafontaine: Wo ist der lachende Dritte?, in: Wirtschaftswoche Nr, 43, 1997; Heiner Flassbeck: Und die Spielregeln für die Lohnpolitik in einer Währungsunion, in: Frankfurter Rundschau, 31.10.1997.] In allen Fällen dürften aber die internationalen Rückwirkungen der Maßnahmen, und seien sie aus rein nationalen Gründen erwünscht, nicht aus dem Auge verloren werden. Globalisierung heißt eben, daß in zunehmendem Ausmaß die nationalen Grenzen an Relevanz für jede Art von wirtschaftlichem Handeln verlieren. Also können nationale Maßnahmen immer weniger ohne Rücksicht auf andere Nationen durchgesetzt werden, sollen nicht ähnliche oder zuwiderlaufende Reaktionen der anderen provoziert werden.
Globalisierung und Nicht-Kooperation?
Insofern geht die immer wieder zu hörende Aussage, internationale Kooperation sei zwar wünschenswert, aber unrealistisch, vollkommen am Problem vorbei. Die Frage ist in erster Linie nicht, ob Kooperation wünschenswert ist, sondern welche Folgen der Wettbewerb der Nationen, die Nicht-Kooperation, für diese Länder hat. Führt man sich diese Folgen vor Augen, erübrigt sich die Erörterung der Notwendigkeit von Kooperation weitgehend. Nicht-Kooperation ist nämlich auf keinen Fall eine Antwort auf Globalisierung.
Die gedankliche Übertragung des einzelwirtschaftlichen Modells des Wettbewerbs zwischen etwa gleichstarken Akteuren auf Staaten leidet unter einer Reihe von Mißverständnissen. Das gravierendste Mißverständnis ist die Gleichsetzung von jeder Art von Kostensenkung mit unternehmerischem Wettbewerb.
Schon die Meinung, der unternehmerische Wettbewerb sei von vornherein immer ertragreich und verbessere die gesamtwirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft, ist nicht ohne weiteres richtig. Wenn ein Unternehmen die Kosten senkt, erhöht es ohne Zweifel seine Wettbewerbsfähigkeit und in der Regel seinen Marktanteil. Doch gilt das, was für ein Unternehmen richtig ist, auch für die Gesamtheit der Unternehmen? Gibt es nicht Nullsummenspiele, bei denen keiner gewinnen kann?
Betrachten wir einen einfachen Fall. Ein Unternehmen senke seine Kosten durch den Abbau von Overheads wie den Beiträgen zu wissenschaftlichen und kulturellen
[Seite der Druckausgabe: 4]
Veranstaltungen oder durch die Verminderung von Reiseausgaben und Bewirtungskosten. Dieser Abbau von Kosten in einem Unternehmen schlägt sich in anderen Unternehmen als eine Verminderung der Einnahmen nieder. Folglich müssen auch diese rationalisieren und Overheads streichen. Bei einigen Betrieben führt das schließlich zu Entlassungen. Damit sinken auch die Einnahmen der privaten Haushalte und folglich deren Ausgaben für Güter, die von Unternehmen produziert werden. Unterstützt der Staat die Arbeitslosen, steigen seine Ausgaben und die Einnahmen sinken wegen sinkender Steuereinnahmen Hält er sein Defizit durch Ausgabensenkung an anderer Stelle konstant, sinken wiederum die Einnahmen der Unternehmen, denn der Staat oder die privaten Haushalte kaufen weniger.
Die Kostensenkung eines Unternehmens kann in gesamtwirtschaftlicher Sicht nicht zu einer Verbesserung der Situation der Unternehmen insgesamt führen, da die Ausgaben des einen immer die Einnahmen des anderen sind Diese Art von unternehmerischem Wettbewerb bringt keine Lösung unserer wirtschaftlichen Probleme. Echter unternehmerischer Wettbewerb verläuft ganz anders. Wenn ein Unternehmer eine Idee hat, wie man die schon vorhandenen Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital auf eine neue Art und Weise miteinander kombinieren kann, so daß er damit sein Gut billiger als bisher anbieten kann, ist das Ergebnis völlig anders. Alle in der Volkswirtschaft haben dann mehr Kaufkraft. Sie fragen folglich entweder mehr Güter des Pionierunternehmens nach, was dazu führt, daß er eine größere Menge mit der gleichen Belegschaft produziert, oder sie kaufen andere Güter, deren Produzenten wiederum mehr Arbeitskräfte einstellen und damit den nicht mehr benötigten Arbeitern des Pionierunternehmens Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Dieser echte unternehmerische Wettbewerb ist gesamtwirtschaftlich immer positiv zu bewerten, auch wenn er dem Einzelnen Mobilität hinsichtlich seiner Qualifikation sowie des Ortes und der Branche, in der er einen Arbeitsplatz findet, abverlangt.
Nun wird gerade in Deutschland allzu häufig das Modell des Wettbewerbs der Unternehmen übertragen auf den Wettbewerb von Nationen. In welcher der beiden Arten von Wettbewerb aber stehen Nationen? Sind Nationen innovativ, haben sie neue Ideen, erfinden sie neue Produktionsverfahren und neue Produkte? Wer würde das von der Mehrzahl der Maßnahmen behaupten wollen, die im Wettbewerb der Nationen ausschlaggebend sind? Man kann es freilich nicht ausschließen, aber Steuersenkung beispielsweise, die beliebteste Maßnahmen im globalen Wettstreit, ist sicher nicht innovativ, sondern zwingt nur die eine Nation das zu tun, was die andere schon getan hat. Gewinnen kann bei platter Kostensenkung keiner, weder die private Wirtschaft noch die Staaten. Überziehen die Regierungen aber in dieser Art von Wettbewerb der Nationen, dann verlieren sogar alle, weil die Staaten am Ende nicht mehr in der Lage sind, ihre ureigensten Aufgaben zu erledigen, und die Effizienz des Gesamtsystems sinkt.
Das zweite Mißverständnis betrifft die Frage der Reaktion des Mitbewerbers. Unternehmen können sich zum Ziel setzen, ein anderes Unternehmen endgültig vom Markt zu verdrängen, entweder durch Kostensenkung im Sinne von Dumping oder durch unternehmerische Innovation. Staaten können aber nicht mit wirtschaftlichen Mitteln andere Staaten verdrängen. Der zunächst unterlegene Staat muß Antworten auf die Herausforderung finden Das läßt sich derzeit in Asien, bei den sogenannten
[Seite der Druckausgabe: 5]
Tiger-Staaten beobachten. Weil sie im Wettbewerb zurückgefallen sind und hohe Defizite im Außenhandel aufweisen, werten sich ihre Währungen ab und sie schnallen den Gürtel enger. Die Marktanteilsgewinne der westlichen Länder, zu denen im besonderen Maße Deutschland gehörte, werden folglich nur von kurzer Dauer sein.
Mit anderen Worten, der neomerkantilistische Ansatz vieler westlicher Staaten, deren Politik einseitig auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit oder der Standortbedingungen ausgerichtet ist, wird mit Neomerkantilismus beantwortet. Schaukelt sich eine solche Entwicklung auf, sind Abwertungswettläufe wie vor der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre die Folge. Sind diese Abwertungswettläufe vor allem Kostensenkungswettläufe bei relativ stabilen Wechselkursen und schon sehr niedrigen Inflationsraten, ist eine allgemeine Deflation früher oder später die unvermeidbare Folge.
Woran liegt es, daß sich immer wieder solche neomerkantilistischen Auffassungen durchsetzen? Eine Erklärung dafür ist das Vorherrschen einer neoklassischen Doktrin in der Wirtschaftspolitik. Weil wenig dafür spricht, daß diese Doktrin, deren Kern Lohnsenkungen sind, in einer geschlossenen Volkswirtschaft wirksam sein kann,[Vgl. Tendenzen der Wirtschaftsentwicklung 1998/99. Bearbeiter: Arbeitskreis Konjunktur im DIW, in: Wochenbericht Nr. 27/98] erschöpft sich die Anwendung dieser Lehre in der Praxis weitgehend in der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit über Kostensenkung. Wenn dies aber von großen, relativ geschlossenen Volkswirtschaften oder gar von allen Ländern angewendet wird, führt sich diese Strategie selbst ad absurdum, weil nicht alle real abwerten können und die großen Volkswirtschaften bei der Binnennachfrage mehr verlieren, als sie im Export gewinnen können. Das Ergebnis sind Kostensenkungswettläufe, bei denen am Ende alle verlieren müssen.
Das beste Beispiel dafür ist der derzeitige Exportboom in Westdeutschland. Erst seit die Nachfrage des Auslandes in einigen Branchen, wie etwa der Automobilbranche, kräftig steigt, wird dort in Sachanlagen und in Humankapital investiert. Gleichwohl kann dieser von der Lohnpolitik getragenen Strategie der forcierten Exportförderung kein durchschlagender Erfolg beschieden sein. Sie schwächt nämlich zugleich die Binnennachfrage und damit die Gewinnsituation der Unternehmen. Dem kann nur entgegengewirkt werden, wenn die privaten Haushalte mit einer kompensatorischen Senkung der Sparquote reagieren oder der Staat seine Defizite erhöht.
Eine solche Strategie ist aber auch deshalb zum Scheitern verurteilt, weil sie das Ausland zu höherer Verschuldung zwingt. Nur wenn die anderen Länder Leistungsbilanzdefizite hinnehmen, können im Inland mit der zusätzlichen Nachfrage aus dem Ausland die Gewinne steigen und folglich Anregungen für die Investitionstätigkeit entstehen. Wie die akute Krise in den asiatischen Tigerstaaten und in Osteuropa zeigt, kann das nicht auf Dauer gutgehen,
Angebotspolitiker, die Schwächen auf der Angebotsseite im Inland mit „attraktiven Produkten ausländischer Anbieter" gleichsetzen, müßten schlußfolgern, daß „die
[Seite der Druckausgabe: 6]
Erfolgsaussichten" einer Verbesserung der Angebotsbedingungen „stark eingeschränkt" sind, „wenn es intensive Handelsbeziehungen zu anderen Ländern gibt" [Sachverständigenrat, Jahresgutachten 1997/98, Ziffer 298] Der Sachverständigenrat bezieht diese Überlegungen aber nur auf „nachfrageorientierte Politik" Ohne Zweifel stößt eine nachfrageorientierte Politik in einer kleinen offenen Volkswirtschaft an Grenzen, weil mit rein nationalen Nachfrageanstößen oft rasch große Leistungsbilanzdefizite entstehen. „Erfolgreiche" Angebotspolitik produziert solche Defizite nicht im Inland, sondern im Ausland. Da jedes „Ausland" irgendwo auf der Welt „Inland" ist, kann eine solche Politik kaum nachhaltige Erfolge nach sich ziehen.
Jede Art von nationalem Alleingang, sei es beim Kostenniveau oder beim Nachfrageniveau, stößt bei „intensiven Handelsbeziehungen" rasch an Grenzen. Deshalb sind wirtschaftspolitische Strategien notwendig, die dem außenwirtschaftlichen Gleichgewicht eine genauso große Bedeutung beimessen wie den anderen wirtschaftspolitischen Zielen. Das bedeutet nicht, einem fortwährenden Versuch zu diskretionärer internationaler Kooperation das Wort zu reden. Es bedeutet aber, sich auf internationale Verhaltensregeln vor allem im Bereich der Lohn- und Steuerpolitik zu einigen, die Abwertungswettläufe ebenso verhindern wie anhaltende außenwirtschaftliche Ungleichgewichte. Diese Regeln haben dann - nicht anders als die Regeln, an die sich der „ehrbare Kaufmann" hält - den Rang von ordnungspolitischen Grundregeln, die im internationalen Handel an die Stelle der Gesetze treten, wie sie zum Schutz des fairen Wettbewerbs innerhalb der Nationalstaaten bestehen.
1.2 Lohnpolitik, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung
Gerade die Krise in Südostasien und die sich anbahnenden Konflikte um Verluste und Gewinne an Wettbewerbsfähigkeit in Europa werfen - ebenso wie die gespaltene Konjunktur in Deutschland - in der Tat die Frage auf, welchen Rang das Ziel des „außenwirtschaftlichen Gleichgewichts", das immerhin im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 verankert ist, in der „globalisierten" Welt noch hat. Der Sachverständigenrat etwa stellt lapidar fest, das Ziel des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts sei in Deutschland nicht gefährdet.[Sachverständigenrat, a.a.O., Ziffer 290.] Gleichwohl ist der Zusammenhang zwischen den sich rasch vergrößernden Überschüssen in den Leistungsbilanzen in Deutschland und Europa auf der einen Seite und den Defiziten in vielen anderen Ländern auf der anderen Seite evident.
Die lange Zeit zu beobachtende Vernachlässigung des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts bei der Rollenverteilung der Wirtschaftspolitik war sicher in der Vorstellung begründet, daß bei flexiblen Wechselkursen ein solches Gleichgewicht automatisch erreicht werde. Nach vielerlei Enttäuschungen mit dem System marktbestimmter Wechselkurse und einer an rein nationalen Gegebenheiten ausgerichteten Geldpolitik gibt es weltweit heute aber kaum noch völlig unregulierte Devisenmärkte. In Asien etwa hatten viele Länder ihre Währungen fest an den US-Dollar gekoppelt;
[Seite der Druckausgabe: 7]
in Osteuropa gibt es sowohl diesen Fall wie auch eine noch weitergehende Koppelung an die Geldpolitik eines Leitwährungslandes, den sog. Currency Board. In Westeuropa schließlich steht der Beginn der Europäischen Währungsunion kurz bevor - der weltweit bedeutendste Zusammenschluß von Ländern, innerhalb dessen kein Devisenmarkt mehr existiert.
Wie schon im Währungssystem von Bretton Woods, das in den fünfziger und sechziger Jahren für weitgehende Stabilität gesorgt hatte, tritt damit die Frage in den Vordergrund, auf welche Weise außenwirtschaftliches Gleichgewicht erreicht werden soll, wenn es keine Wechselkursänderungen als Puffer zwischen Ländern mit unterschiedlichen Makro- und Mikrostrukturen mehr gibt Das ist im Grunde nichts anderes als die häufig diskutierte Frage, wie Länder auf Schocks der verschiedensten Art bei absolut festen Wechselkursen reagieren sollen und können. Bedeutend sind drei Arten von Schocks:
- Auf der Nachfrageseite treten Schocks auf, weil die Geldpolitik in dem Bemühen, Inflation oder Deflation zu bekämpfen, über steigende oder sinkende Zinsen die Investitionsbedingungen verändert. Diese Schocks sind bei festen Wechselkursen relativ unproblematisch, da sie alle Länder in einem Festkursblock gleichmäßig treffen.
- Angebotsschocks treten auf, wenn sich - wie bei den Ölpreiskrisen oder bei Naturkatastrophen - die Produktionsbedingungen in einer Region in kurzer Zeit dramatisch verändern. Soweit davon alle Länder weitgehend gleichermaßen betroffen sind, ist das Währungssystem für die Schockverarbeitung ohne Bedeutung. Ob das anders ist, wenn nur ein Land, z.B. im Rahmen einer Naturkatastrophe, betroffen ist, ist eine offene Frage. Den damit verbundenen Rückgang des Realeinkommens muß das Land auf jeden Fall tragen, falls es keine Transfers aus anderen Ländern erhält. Dafür, daß die Abwertung der eigenen Währung, also ein nochmaliger Verzicht auf Realeinkommen zugunsten einer Verbesserung der Absatzchancen für eigene Produkte, den Anpassungsprozeß erleichtert, lassen sich nur schwer zwingende Argumente finden.
- Wesentlich bedeutender ist, wie auf solche Schocks auf der Angebotsseite zu reagieren ist, die einen Verlust von Wettbewerbsfähigkeit für ein einzelnes Land oder eine Ländergruppe innerhalb eines Systems fester Wechselkurse oder einer Währungsunion mit sich bringen. Ein Musterfall hierfür ist die deutsch-deutsche Währungsunion, die zu einer weitgehenden Deindustrialisierung Ostdeutschlands führte, weil dort nicht nur der Einstiegswechselkurs sehr hoch war, sondern auch die Löhne und die Lohnstückkosten über einige Jahre hinweg wesentlich stärker stiegen als im Westen. Bei gleichen Preisen für die handelbaren Güter verloren die ostdeutschen Produzenten fast ihren gesamten Markt, weil sie keine wettbewerbsfähigen Produkte anbieten und/oder nicht in ausreichendem Maße investieren konnten, um neue Produkte auf den Markt zu bringen.
Entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit einer Region oder eines Landes ist die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten im Verhältnis zu denen der wichtigsten Handelspartner. Die Empirie zeigt, daß die Wechselkursänderungen
Seite der Druckausgabe: 8]
über sehr lange Fristen diese Differenzen fast perfekt ausgeglichen haben [Über kurze Fristen gab es allerdings sehr große Schwankungen des realen Wechselkurses, also ein „Überschießen" der nominalen Wechselkursänderungen über die Lohnstückkosten- und Preisdifferenzen hinaus].In einem gut funktionierenden Währungssystem auf der Basis fester nominaler Wechselkurse sollten die realen Wechselkurse in ähnlicher Weise unverändert bleiben. Der Vorteil eines solchen Währungssystems liegt darin begründet, daß es nicht zu ähnlichen kurzfristigen Fluktuationen der Wettbewerbsposition von Regionen oder Ländern kommt, wie das bei flexiblen Kursen gang und gäbe war. Länder, die eine Währungsunion oder auch nur einen Festkursblock untereinander bilden wollen, müssen also in der Lage sein, die Zuwachsraten der gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten einander anzugleichen und auf diese Weise ihre Lohnpolitik zu koordinieren.
Das läßt sich am Beispiel Deutschlands, Frankreichs und den USA ohne weiteres demonstrieren. Von 1970 bis Mitte der achtziger Jahre stiegen in Westdeutschland die Lohnstückkosten - in Landeswährung gerechnet - immer weniger stark als in den beiden anderen Ländern. Diese Differenz wurde allerdings durch Aufwertungen der
D-Mark regelmäßig ausgeglichen. Erst nach 1987 gelang es Frankreich, mit Deutschland weitgehend gleichzuziehen, so daß Wechselkursänderungen entbehrlich wurden. Seit 1994 Jedoch öffnet sich wieder eine Schere zugunsten Deutschlands, die eigentlich eine Aufwertung der D-Mark erfordern würde (Abbildung 1). Auch gegenüber dem US-Dollar ist früher oder später eine Aufwertung der D-Mark zu erwarten, da in den Vereinigten Staaten die Lohnstückkosten schon seit Anfang der neunziger Jahre stärker expandieren.
Im Vorfeld der Europäischen Währungsunion, in der die Wechselkurse schon fixiert sind, muß, wenn sich die Lohnpolitik hierzulande nicht ändert, die französische Lohnpolitik reagieren und dafür sorgen, daß die nominalen Lohnsteigerungen ähnlich weit hinter dem Zuwachs der Produktivität zurückbleiben wie in Deutschland. Angesichts des schon entstandenen Rückstands in Frankreich wäre dort sogar für einige Jahre eine noch stärkere Lohnmoderation als in Deutschland notwendig. Das gleiche gilt für fast alle übrigen potentiellen Teilnehmerstaaten an der EWU. Überall steigen die Lohnstückkosten, während sie in Deutschland sinken.
Der Wettbewerbsschock, der auf diese Weise von Deutschland ausgelöst wird, zwingt die Partnerländer zum Handeln, wollen sie nicht dauerhaft Marktanteile verlieren. Die Politik der „Lohnmäßigung" und der Anpassung an den „deutschen Anker", die schon die gesamten achtziger Jahre gekennzeichnet hat, müßte in diesem Fall fortgesetzt werden. Allerdings zwingt der Wettbewerb auf den Gütermärkten früher oder später die Unternehmen, die absolut sinkenden Kosten in den Preisen weiterzugeben. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis bei Fortsetzung dieser Politik in ganz Europa auch das Preisniveau sinkt, also eine Deflation eintritt.
Eine Anpassung der nationalen Lohnstückkostensteigerungen an die stärksten Handelspartner ist in einem System absolut fester Wechselkurse bzw. in einer Währungsunion unumgänglich. Gleichzeitig muß aber durch die Signale, die von der Notenbank des Leitwährungslandes oder der gemeinsamen Notenbank ausgehen, der Lohnpolitik angezeigt werden, daß nur dann, wenn die Zuwachsrate der Lohn-
[Seite der Druckausgabe: 9]
stückkosten mit der von der Zentralbank tolerierten Inflationsrate übereinstimmt, keine Konflikte zwischen Geld- und Lohnpolitik bestehen.
Abbildung 1:
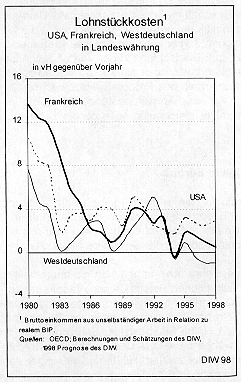
Daran gemessen ist Deutschland jetzt einen Schritt zu weit gegangen. Solange die Entwicklung der Lohnstückkosten - wie in den achtziger Jahren - in der Größenordnung von 2 vH und damit in der Nähe der von der Notenbank tolerierten Inflationsrate lag, war eine Anpassung all der Länder an den Anker Deutschland sinnvoll, die eine ähnlich niedrige Inflationsrate haben wollten. Niemand aber kann ernsthaft eine deflationäre Entwicklung anstreben wollen. Daraus folgt, daß das für die europäische Zentralbank maßgebliche Inflationsziel auch für die Tarifpartner in allen Ländern Europas bei der Suche nach geeigneten Tarifabschlüssen maßgeblich sein muß. Daneben müssen sie sich, ganz gleich auf welcher Ebene die Tarifverhandlungen stattfinden, strikt an der Entwicklung der jeweiligen Produktivität orientieren, sollen gravierende Fehlentwicklungen unterbleiben. Im Idealfall steigen in allen Ländern, die Mitglied der Währungsunion sind, die Lohnstückkosten exakt um 2 vH. Das hat jüngst auch der Sachverständigenrat anerkannt, wenn er konstatiert, daß diejenigen Länder, die in der Vergangenheit häufig abgewertet hatten, nun ihre „Lohnent-
[Seite der Druckausgabe: 10]
wicklung eng an der inländischen Produktivitätsentwicklung zu führen" haben, „wollen sie eine erhöhte Arbeitslosigkeit vermeiden" [Sachverständigenrat, a.a.O., Ziffer 360]
Der Sachverständigenrat schließt daraus für Deutschland, „die deutsche Lohnpolitik (müsse) darauf achten, daß sie die Verteilungsspielräume nicht überdehnt, stiegen die Lohnstückkosten hierzulande so stark, würden zahlreiche Unternehmen Marktanteile verlieren, viele Beschäftigte ihren Arbeitsplatz"[Sachverständigenrat, a.a.O., Ziffer 360] Dies steht allerdings unter dem Rubrum, die „Lohnpolitik sei gefordert, mit Flexibilität die Lösung des Beschäftigungsproblems anzugehen"[Sachverständigenrat, a.a.O., Ziffer 359]. Hier wird die Analyse irreführend. Der Sachverständigenrat erwähnt weder, daß Deutschland in der Vergangenheit ein Aufwertungsland und nicht ein Abwertungsland war, noch die Tatsache, daß zuletzt die Lohnzuwächse in Deutschland weit unterhalb des Produktivitätszuwachses lagen. Die Schlußfolgerungen für ehemalige Auf- und Abwertungsländer können aber nicht völlig gleichartig sein, und es kann nicht gleichgültig sein, ob die Lohnstückkosten fallen oder steigen.
1.3 Wirtschaftspolitik in Europa
Die großen Währungsblocks, die in der Regel eine große geschlossene Volkswirtschaft mit nur geringem Exportanteil darstellen und die intern in hohem Maße koordinieren müssen, sind nach außen relativ autonom in ihren wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Das betrifft sowohl die Geldpolitik als auch die Finanzpolitik.
Seit Beginn der achtziger Jahre etwa haben sich die finanzpolitischen Bedingungen in den drei großen wirtschaftlichen Blocks dieser Welt, in Japan, den USA und Europa zeitweise weit auseinanderentwickelt und weisen sogar gegenläufige Tendenzen auf (Abbildung 2). So hat Japan den weltweiten Boom und seine großen Exporterfolge in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre genutzt, um staatliche Überschüsse zu realisieren, während die USA und Europa ihre Defizite nur leicht vermindern konnten. Umgekehrt in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre: Nun gelang es den USA im Zuge eines kräftigen Aufschwungs ihren Haushalt auszugleichen, während in Europa die Reduktion der Defizite auf die „magische" Größe von 3 vH nur unter Hinnahme erheblicher Wachstumseinbußen möglich war. Gleichzeitig mußte die japanische Finanzpolitik im Zuge eines außergewöhnlich starken Aufwertungsschocks, dem eine anhaltende deflationäre Phase folgte, ihre Überschußposition rasch aufgeben und mit hohen Defiziten den Absturz in eine deflationäre Spirale zu verhindern suchen.
[Seite der Druckausgabe: 11]
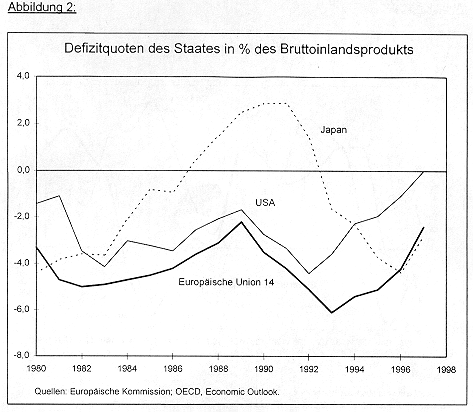
Noch erstaunlicher ist die weitgehend geldpolitische Autonomie der großen „global player". Beispielhaft zeigt sich das - ebenfalls für die Zeit ab 1980 - an der völlig andersartigen Entwicklung der Zinsstruktur in Europa und den USA einerseits sowie in ganz besonderem Maße am Verlauf der Zinsen in Deutschland und den USA in den neunziger Jahren. Abbildung 3 zeigt, daß sich in den achtziger Jahren der Rest Europas von Deutschland und den USA weitgehend monetär abgekoppelt hatte. Während letztere nach der Rezession zu Beginn der achtziger Jahre rasch wieder zu normalen Zinsbedingungen zurückkehrten, nämlich einer Zinsstruktur, die sich mit 2 bis 3 Prozentpunkten deutlich im positiven Bereich bewegte, verharrte der Rest Europas praktisch die gesamten achtziger Jahre bei einem Niveau der Zinsstruktur, das eine deutliche Restriktionswirkung von seiten der Geldpolitik anzeigt.
Dieses Auseinanderlaufen der monetären Bedingungen war Ausdruck des - letztlich erfolgreichen - Versuchs vieler europäischer Länder, eine hartnäckige Inflationierung zu bekämpfen und mit Deutschland in Sachen Geldwertstabilität gleichzuziehen. In den neunziger Jahren schließlich koppelte sich auch Deutschland von den USA ab, weil es inflationäre Gefahren im Gefolge seiner einigungsbedingten Sonderkonjunktur zu bekämpfen versuchte.
[Seite der Druckausgabe: 12]
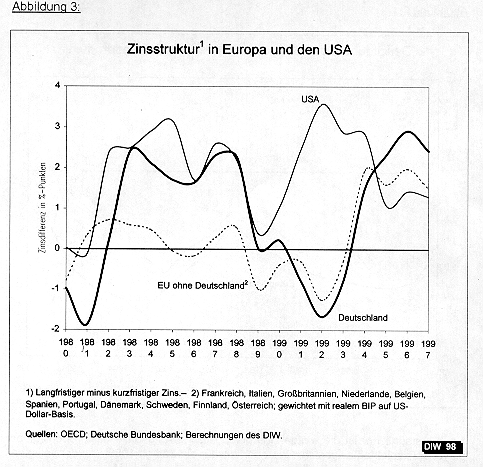
Auf welche Weise das geschah, zeigt eindrucksvoll die Abbildung 4. Die Deutsche Bundesbank erhöhte bis zum Sommer 1992 die kurzfristigen Zinsen, obwohl der amerikanische kurzfristige Zins und die langfristigen Zinsen weltweit bereits seit dem Herbst 1990 fielen. Die Bundesbank konnte mit dieser Politik und angesichts der entgegengerichteten Politik der amerikanischen Zentralbank zwar den Rückgang der langfristigen Zinsen in Deutschland nicht verhindern, es „gelang" ihr aber, den langfristigen deutschen Zins vom amerikanischen nach oben etwas abzukoppeln und sicherlich hat diese Politik, der die meisten Länder Europas folgten, den langfristigen Weltmarktzins höher gehalten, als es sonst der Fall gewesen wäre.
Mitte der neunziger Jahre kehrten sich die Verhältnisse um. Die amerikanische Zentralbank restringierte angesichts fallender Arbeitslosenzahlen und die Bundesbank lockerte angesichts steigender Arbeitslosigkeit und einer sinkenden Inflationsrate. Nun drehte sich auch das Verhältnis der langfristigen Zinsen um. Hatte vorher der deutsche Zins immer über dem amerikanischen gelegen, fiel er nun unter den ame-
rikanischen. In den letzten drei Jahren gibt es sowohl am kurzen wie am langen Ende eine spürbare Entkopplung zwischen den USA und Deutschland. Diese Entkopplung bei den nominalen Zinsen reflektiert natürlich zu einem Teil unterschiedliche Inflationsraten. Die Abkoppelung bei den kurzfristigen Nominalzinsen war schließlich darauf ausgerichtet, unterschiedlichen Inflationsentwicklungen zu begegnen. Das ist gelungen, wenngleich der Effekt nationaler Geldpolitik auf den Kapitalmarktzins, selbst im Falle großer Nationen, gedämpft wird durch die Tatsache, daß dieser Zins, wie kaum ein anderer Preis, Ergebnis des globalen Angebots und der globalen Nachfrage ist.
[Seite der Druckausgabe: 13]
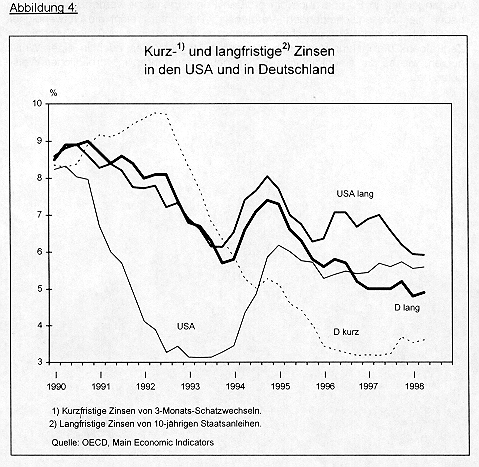
[Seite der Druckausgabe: 14]
1.4 Schlußfolgerungen
Das Ergebnis dieser Überlegungen ist paradox: Die Politik, die von der Mehrheit der Ökonomen im Zeitalter der Globalisierung für „modern" gehalten wird, nämlich über Kostensenkung eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen und die eigene Beschäftigungssituation zu verbessern, ist gerade in einer globalisierten Ökonomie mit raschem Informationsaustausch nicht durchzuhalten. Spielräume gibt es dagegen für eine „unmoderne" gesamtwirtschaftlich ausgerichtete Politik, die vor allem die Entwicklung der Kapitalmärkte selbst prägt und mitgestaltet. Dies kann allerdings nur großen Konglomeraten wie den USA oder Europa gelingen, weil nur sie im globalen Rahmen ein ausreichend großes Gewicht besitzen. Hier sind in der Vergangenheit in Europa auch die größten Fehler gemacht worden und die USA haben hier ihre entscheidenden „Verdienste". Das unterstreicht die Notwendigkeit der Einführung einer Europäischen Währungsunion. Allerdings muß die Europäische Zentralbank die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auch in einer Weise nutzen, wie es die amerikanische in den neunziger Jahren in vorbildlicher Weise getan hat.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | August 1999