

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
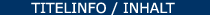
TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausgabe: 5]
I. Zur Umwelt- und Ressourcenrelevanz der Bau- und Wohnungswirtschaft
Spätestens seit der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro ist die Zukunftsverträglichkeit bzw. die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens zu einem zentralen politischen Anliegen geworden. Künftig ist eine Wirtschaftsweise anzustreben, die die natürlichen Lebensgrundlagen erhält bzw. nicht zerstört. Die Wahrung von Zukunftschancen für künftige Generationen erfordert bereits heute einen verantwortungsbewußten Umgang mit Ressourcen. Um mehr Klarheit über eine zukunftsverträgliche Entwicklung zu gewinnen, hat der deutsche Bundestag die Enquetekommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" eingesetzt. Diese Kommission hat die Aufgabe, Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung zu analysieren und - daraus abgeleitet - politische Empfehlungen zu geben.
Die Kommission befaßt sich allgemein mit der Entwicklung von Umweltqualitäts- und Umwelthandlungszielen, mit der Analyse der ökonomischen, sozialen und technischen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens und mit den Innovationen bzw. Veränderungen, die in diesem Zusammenhang bedeutsam erscheinen. Ferner untersucht und entwickelt die Kommission geeignete Maßnahmen und Instrumente zur Umsetzung einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung. Zu diesem Zweck vergibt sie auch Studien an - bisher überwiegend nationale - Forschungseinrichtungen.
In dieser Legislaturperiode konzentriert die Kommission ihre Arbeit auf das Bedürfnisfeld "Bauen und Wohnen". Die Gründe hierfür lassen sich stichwortartig wie folgt zusammenfassen: [Fn. 1: Vgl. hierzu auch Friedrich-Ebert-Stiftung: Produktionsintegrierter Umweltschutz - Wettbewerbschancen durch ökologische Umorientierung, Diskurs Nr. 87, Bonn 1996,S. 8f. ]
- Bauen und Wohnen ist ein Bedürfnisfeld, welches die Menschen aufgrund unmittelbarer Betroffenheit sehr stark anspricht. Ein Dach über dem Kopf braucht jeder. Deshalb erscheint gerade hier eine exemplarische Darstellung von Nachhaltigkeit besonders wichtig.
- Das in diesem Bereich bedeutsame Thema Flächenverbrauch kann nachhaltig nicht allein mit dem Instrument der Bodenpreise gesteuert werden. Vielmehr muß auch die Umweltpolitik künftig den Verbrauch stärker als bisher beeinflussen.
- Der Bereich Bauen und Wohnen ist für den Klimaschutz bzw. für die C02-Reduktion von besonderer Bedeutung. Das C02-Problem läßt sich nicht "am Baubereich vorbei" lösen. Insbesondere im Bereich Bauen und Wohnen der privaten Haushalte liegt ein erhebliches Potential für Klimaverbesse-
[Seite der Druckausgabe: 6]
- Von zentraler Bedeutung ist ferner die stoffliche Seite. Die Energie- und Stoffströme zeigen die Nutzung der Umwelt zur Entnahme von Ressourcen und zur Aufnahme von Schadstoffen. Sie sind daher bei einer Bewertung der Wirkung auf Flora, Fauna und Gesundheit einzubeziehen. Bauabfälle, Baustoffe und Erdaushub bilden zusammen mit über 50% des gesamten Abfallvolumens den größten Stoffstrom in Deutschland. [Fn. 2: Der Vertreter der Bauindustrie weist darauf hin, daß große Mengen dieser Abfälle aus unproblematischen Stoffen und gut wiederverwertbaren mineralischen Stoffen bestehen (ca. 80%). Nicht kontaminierter Boden ist z.B. nur subjektiv Abfall, d.h. im Fall der Entledigung. Für schadstoffhaltige und mit Störstoffen verunreinigte Abfälle liegen die Baurestmassen allenfalls in der Größenordnung der Siedlungsabfälle.] Während aber bereits in vielen Bereichen Stoffströme durch Verordnungen mit Quoten und Überwachung geregelt werden, unterliegt der große Baustoffstrom - bisher - noch keiner solchen Verordnung bzw. einer wirksamen Selbstverpflichtung. Daher ist zu fragen, wie im Baubereich mit Stoffen umzugehen ist, wo Altstoffe wieder einzusetzen sind, ohne Schadstoffe zu "verschleppen", und wo Getrennthaltung bzw. Recycling ansetzen müssen.
- Zwar zählt die Bauharmonisierung zu den vorrangigen politischen Zielen der EU. Nach wie vor sind aber im Bereich Bauen und Wohnen viele Regelungskompetenzen auf nationaler Ebene angesiedelt. Die meisten Standards werden durch die nationale Politik gesetzt. Ferner werden die Stoffströme überwiegend im Lande ausgelöst bzw. gefördert. Inländische Gebietskörperschaften sind große Bauinvestoren und können mit ihrem Bauverhalten beispielgebend sein.
rungen. Dies betrifft z.B. die Dämmung von Häusern und Wohnungen, die Wohnstile allgemein und speziell den Stromverbrauch. Demgegenüber hat die Industrie, die nur noch für rund 30% der C02-Emission verantwortlich ist, schon eine Vielzahl von entsprechender Einsparmaßnahmen realisiert.
Das Bedürfnisfeld Bauen und Wohnen bietet aus Sicht der Kommission insgesamt eine gute Chance, einen Beitrag zur Realisierung des Leitbildes einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung in ökologischer, sozialer und ökonomischer Dimension zu leisten. Auf allen diesen drei Ebenen sind Managementregeln im Sinne eines "Instrumentenkastens" zu entwickeln und anzuwenden, um die diskutierten Ziele zu erreichen.
Die Kommission hat beim Thema Bauen und Wohnen viele Partner und Mitstreiter. Viele Kommunen, Entwicklungsgesellschaften und Verwaltungsverantwortliche, aber auch Mietervereine und Genossenschaften sind dem Thema gegenüber aufgeschlossen und an einer Änderung der bestehenden umweltbelastenden Verfahrensweisen interessiert. Auch die Bauwirtschaft kann und wird sich nicht der angesprochenen Optimierung entziehen. Sie wird jedoch pragmatischere und ökonomische Maßstäbe stärker in den Vordergrund stellen.
[Seite der Druckausgabe: 7]
Die bisherige Kommissionsarbeit hat allerdings auch gezeigt, welche Widerstände auf diesem Weg noch zu überwinden sind. So ist es beispielsweise angesichts der Deregulierung der Baustatistik zunehmend schwierig, valide Zahlen zu bekommen. Ein wesentliches Hindernis für "nachhaltiges Wohnen" besteht aus Sicht der Kommission derzeit in der Subventionierung des Wohnungsneubaus, die den Flächenverbrauch fördert; dazu hat lange Zeit auch die größenunabhängige Förderung von Eigenheimen beigetragen. Trotz eines gut entwickelten Raumordnungsinstrumentariums wachsen die "Speckgürtel" rund um die Großstädte. Randgemeinden versuchen, gute Einkommensteuerzahler aus den Städten an sich zu ziehen; gelingt dies, wird der Flächenverbrauch weiter erhöht. Die Regionalisierung der Flächennutzungsplanung ist bis auf wenige Ausnahmen unzureichend entwickelt. Die Probleme in Bezug auf den Flächenverbrauch schlagen sich mittelbar auch auf der Energieseite nieder. Mehr Wohnfläche bedeutet tendenziell mehr Heizenergie; mehr Landschaftsverbrauch führt zu höherem mobilitätsbezogenem Energieverbrauch. Alle Instrumente, die die zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen begünstigen, fördern daher gleichzeitig den Energieverbrauch.
Schließlich werden die Stoffströme im Bereich Bauen und Wohnen, wenn nichts geschieht, in Zukunft besonders auf der Abbruchseite erheblich zunehmen. Ein für die Kommission erstelltes Gutachten prognostiziert hier - bei einer Trendfortschreibung - Zuwächse von 10% bis 30% im neuen Jahrtausend gegenüber dem laufenden Jahrzehnt und ab 2010 über 30% Zuwachs gegenüber der vorherigen Dekade. Im Bereich des baubezogenen Sondermülls aus Bauschutt ist sogar mit noch höheren Steigerungsraten zu rechnen. Hierbei ist nach Auffassung der Bauindustrie allerdings auch zu beachten, daß Sonderabfälle im Baubereich selten sind und allenfalls bei Baustellenabfällen oder bei Altlastensanierungen anfallen.
Künftig ist besonders darauf zu achten, wie Gebäude gebaut werden. Der Einsatz zu vieler Chemikalien, deren Entsorgung später problematisch wird, ist zu vermeiden. Zugleich gilt es Wege zu finden, den bereits angefallenen Sondermüll "auszuschleusen", da dieser sonst über die Verwertung von Abfällen wieder Eingang in irgendwelche Baustoffe finden kann.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Januar 2001