

[Seite der Druckausgabe: 19 / Fortsetzung]
6. Bausteine der Bankenmacht
6.1 Beteiligungsbesitz der Banken
Anders als in anderen Rechtssystemen ist es deutschen Universalbanken erlaubt, sich an anderen Unternehmen (Banken und Nichtbanken) zu beteiligen. In der Praxis verfügen heute fast alle großen deutschen Banken über einen umfangreichen Anteilsbesitz. So hält beispielsweise die Deutsche Bank AG fast 25 Prozent am größten deutschen Industrieunternehmen, der Daimler-Benz AG, 10 Prozent am größten deutschen Versicherungskonzern, der Allianz Holding AG, 10 Prozent an der mit der Allianz eng verbundenen Münchener Rückversicherungs AG, rund 10 Prozent an der Continental AG, 10 Prozent an der Hapag Lloyd AG, 10 Prozent an der Heidelberger Zement AG, über 25 Prozent an der Philipp Holzmann AG, über 25 Prozent an der Hutschenreuther AG, über 10 Prozent an der Metallgesellschaft AG, fast 19 Prozent an der Horten AG, 10 Prozent an der Karstadt AG und mehr als 30 Prozent an der Klöckner-Humboldt-Deutz AG. Diese Auflistung ließe sich noch erheblich ergänzen, schließlich stellen die genannten Beteiligungen nur einen kleinen Teil des Anteilsbesitzes der Deutschen Bank dar. Vergleichbares gilt auch für die übrigen großen Banken Deutschlands, die dem Marktführer lediglich graduell nachstehen. Auch sie verfügen über einen umfangreichen Besitz an Unternehmensanteilen.
[Seite der Druckausgabe: 20]
Nach Einschätzung von Wissenschaftlern üben Deutschlands Banken mittels dieses Anteilsbesitzes einen erheblichen Einfluß auf diese Unternehmen und damit auf die deutsche Wirtschaft als Ganzes aus. Dieser Einfluß von Banken auf Wirtschaftsunternehmen führe bei der zentralen Bedeutung, die Banken in Deutschland einnehmen, zu Interessenkonflikten oder gar konkreten Störungen des Wettbewerbs. Diese Gefahr sei dann besonders groß, wenn sich Banken an verschie denen Unternehmen beteiligen, die untereinander im Wettbewerb stehen.
Ein Vertreter der Monopolkommission verweist auf die Ergebnisse verschiedener Anhörungen der Kommission. Die angehörten Verbände hätten dabei ausgeführt, daß Nichtbankenbeteiligungen für Kreditinstitute ein geeignetes Mittel darstellten, um Hausbankfunktionen zu eröffnen, die dann bei den Bankgeschäften dieses Beteiligungsunternehmens zu einer Vorzugsstellung rührten. Vertreter von Banken hätten dabei eingeräumt, daß Beteiligungen den Zugang zu besonders ertragsreichen Bankgeschäften wie dem Konsortial- und dem Auslandsgeschäft erleichterten, oder daß die an dem jeweiligen Unternehmen beteiligte Bank dabei eine Vorzugsstellung genieße. Ebenso käme es zu einer Begünstigung bei allen anderen Bankgeschäften, sofern diese nicht zu wesentlich schlechteren Konditionen als von den Konkurrenten angeboten würden. Derartige, den Wettbewerb behindernde Auswirkungen des Beteiligungsbesitzes könnten nach Auswertung der Untersuchungen der Monopolkommission bereits bei einem Anteilsbesitz von 5 Prozent am Grundkapital eines Unternehmens eintreten. Als Folge dieser Bevorzugung müßten Kreditinstitute ohne Beteiligungsbesitz beispielsweise im Konsortialgeschäft bestimmte Beschränkungen der Konsortialquote oder Zugangsbeschränkungen zum Konsortium und im Kreditgeschäft Begrenzungen des Kreditvolumens hinnehmen, ohne daß ihrer eventuell vorhandenen Plazierungskraft und ihrer Bereitschaft zur Übernahme von Kreditrisiken Rechnung getragen werde. Schließlich könne sich der Einfluß eines Kreditinstituts im Nichtbankenbereich auf die Geschäftspolitik des Unternehmens und damit zugleich auf dessen Wettbewerbsposition auswirken.
Bereits die vom Bundesministerium der Finanzen in den siebziger Jahren eingesetzte Studienkommission "Grundfragen der Kreditwirtschaft" (Bankenstrukturkommission) hatte festgestellt, daß von Banken in Einzelfällen "zur Erhöhung oder Stabilisierung des inneren Wertes ihres Anteilsbesitzes" eine aktive Konzentrationspolitik im Nichtbankenbereich betrieben wurde. Rückwirkungen der Beteiligungsnahme von Banken auf die wirtschaftliche und wettbewerbliche Situation der Beteilungsunternehmen erwachse letztlich jedoch - ungeachtet einer in der Praxis kaum möglichen tatbestandlichen Konkretisierung von Mißbrauchen - schon aus der Wahrnehmung der Bankeninteressen als Verwalter eigenen Vermögens und als potentielle Kreditgeber. Bereits die Ausübung der Gesellschafterrechte führe zwangsläufig zur Mitwirkung an wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen. Diese Wirkungen würden verstärkt durch die Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten und Depotstimmrechten.
[Seite der Druckausgabe: 21]
Aus Sicht eines Mittelstandsverbandes ist der Beteiligungsbesitz der Banken dann besonders schädlich, wenn Banken sich über ihre Beteiligungen als Mitwettbewerber mit ihren eigenen Kunden konfrontiert sehen. Es sei fraglich, ob ein Firmenkundenberater eine solche, im Bereich der Unternehmensbeteiligung der Bank konkurrierende Firma noch objektiv beraten kann. Da die Banken über ihre Beteiligungen vor allem in den neuen Bundesländern zunehmend in völlig neue Tätig keitsbereiche und bankfremde Dienstleistungen wie die Immobilien- oder Reisevermittlung oder den Datenverarbeitungsservice vorstoßen, werde diese Konkurrenzsituation für mittelständische Unternehmen zu einem immer gravierenderen Problem. Gerade diese Wirtschaftssegmente waren traditionell den mittelständischen Dienstleistern und den Freien Berufen vorbehalten. Mittelstandsverbände plädieren daher für einen Rückzug der Banken aus diesen bankfremden Dienstleistungsbereichen.
Vertreter von Banken und ihren Interessenverbänden weisen diese Kritik zurück. Sie verweisen darauf, daß die Banken mit ihren Beteiligungen keine unternehmerischen Ziele verfolgen, sondern Unternehmensbeteiligungen lediglich als Anlageform zum Zwecke des Risikoausgleichs nutzen. Deshalb könne es in der Praxis gar nicht zu den unterstellten Wettbewerbsverzerrungen und Interessenkonflikten kommen. Außerdem würde der Anteilsbesitz der deutschen Banken insgesamt erheblich überschätzt. So belege eine neue Studie des Bundesverbandes deutscher Banken, daß der Anteilsbesitz der zehn größten privaten Banken in den letzten Jahren stark rückläufig gewesen sei. Ende 1994 habe der Anteilsbesitz dieser Banken an allen Kapitalgesellschaften in Deutschland gerade einmal 0,4 Prozent betragen; 1976 waren es noch 1,3 Prozent gewesen. Stark rückläufig sei der Anteil der Bankenbeteiligung vor allem bei den großen Beteiligungen von mehr als 25 Prozent. Ohnehin seien die meisten dieser Beteiligungen nur wegen des früher erst ab einem Beteiligungsbesitz von 25 Prozent greifenden steuerlichen Schachtelprivilegs eingegangen worden und würden heute kontinuierlich abgebaut. Durch das Schachtelprivileg sollen ertrag- oder substanzsteuerliche Mehrfach- oder Doppelbelastungen vermieden werden, die sich aus der Verschachtelung von Kapitalgesellschaften ergeben. So können bei Schachtelbeteiligungen einer Kapitalgesellschaft an einer anderen Kapitalgesellschaft die Erträge aus der Beteiligung und die Beteiligung selbst von der Vermögens- und der Gewerbekapitalsteuer befreit werden. Hierzu bedurfte es früher einer Mindestbeteiligung von 25 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft; heute greift das Schachtelprivileg bereits bei einem Anteilsbesitz von 10 Prozent der Gesellschaft.
Die generell rückläufige Tendenz beim Anteilsbesitz der Banken ist aus Sicht eines Vertreters eines Bankenverbandes um so bemerkenswerter, als die Zahl der von den 10 größten deutschen Privatbanken gehaltenen Beteiligungen insgesamt gestiegen ist. So stieg ihre Zahl von 101 Beteiligungen Mitte der 80er Jahre bis Ende 1994 auf immerhin 135 Beteiligungen. Viele dieser neuen Beteiligungen seien dabei von den Banken nur auf das Drängen der Politik eingegangen worden.
[Seite der Druckausgabe: 22]
Schließlich waren die Banken aufgefordert worden, im Rahmen der von allen Parteien geforderten "Bankenmilliarde" ihren Beitrag für den "Aufbau Ost" zu leisten. Die privaten Banken hätten inzwischen den davon auf sie entfallenen Anteil von 400 Millionen DM nahezu vollständig erbracht. Dazu sei eine besondere Beteiligungsgesellschaft gegründet worden, die inzwischen 12 Unternehmen erworben habe.
Die Aussagekraft der von den Banken vorgelegten Zahlen ist umstritten. So wird bezweifelt, ob die gewählte Bezugsgröße der Gesamtheit aller deutschen Kapitalgesellschaften - Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und GmbHs - geeignet ist, um zu einer qualifizierten Bewertung des Anteilsbesitzes der Banken zu gelangen. Während die GmbH als Unternehmensform die mittel ständische Wirtschaft dominiert, sind Deutschlands führende Unternehmen überwiegend Aktiengesellschaften. So sind von den nach Umsatz 100 größten deutschen Unternehmen rund 70 als Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaft auf Aktien organisiert. Auf die deutsche Wirtschaft als Ganzes gesehen, spielt die Aktiengesellschaft dagegen im Vergleich zur GmbH nur eine verhältnismäßig bescheidene Rolle. Auf eine Aktiengesellschaft kommen in Deutschland rund 160 GmbHs. Da das eigentliche ordnungspolitische Problem in den dauerhaften hohen Beteiligungen der Banken an den großen Wirtschaftsunternehmen liegt, führt die Bezugnahmen auf alle Kapitalgesellschaften zwangsläufig zu einer statistischen Reduzierung des Anteilsbesitz der Banken. Folgerichtig erhält man einen höheren Wert, wenn man als Bezugsgröße für die Bewertung des Anteilsbesitzes der Banken als Gesamtheit die deutschen Aktiengesellschaften wählt. Nach einer Studie der Monopolkommission aus dem Jahre 1975 waren Banken damals an 56 der 100 größten Aktiengesellschaften einschließlich der Kommanditgesellschaften auf Aktien direkt beteiligt. Der durchschnittliche Anteilsbesitz der Banken betrug über 7 Prozent. Ein Wissenschaftler betont, daß der Anteilsbesitz der Banken an den großen börsennotierten Aktiengesellschaften in den letzten Jahren weiter gestiegen ist.
Wissenschaftler und Politiker fordern, den Beteiligungsbesitz der Banken wegen der großen ordnungspolitischen Probleme zu beschränken. Zur Erfüllung der für Banken typischen Geschäfte ist es aus Sicht eines Vertreters der Monopolkommission langfristig nicht erforderlich, Beteiligungen an Nichtbanken zu halten. So plädiert die Kommission dafür, den Kreditinstituten den Eigenerwerb von Anteilen an Nichtbanken zu untersagen, soweit mehr als 5 Prozent der Summe der Kapitalanteile erworben werden. Diese Regelung sollte für den Eigenerwerb von Anteilen an Nichtbanken gelten, an denen bisher keine Beteiligung bestand und von Anteilsrechten aus Kapitalerhöhungen. Soweit Anteilsrechte erworben werden, die diese Grenze überschreiten, sollte das Stimmrecht ruhen. Ausnahmen von dieser Regelung sollten nur bei Beteiligungen im banknahen Bereich in Frage kommen, sowie bei Beteiligungen, die zur Erfüllung von Bankenfunktionen z.B. bei einer Sanierung von Unternehmen dienten. Der unternehmerische Einfluß der Banken
[Seite der Druckausgabe: 23]
würde durch diese Maßnahmen auf ein für die Kreditvergabe notwendiges Maß beschränkt.
Ein SPD-Politiker unterstreicht diese Position und erläutert, daß der von der SPD-Bundestagsfraktion vorgelegte Entwurf eines Transparenz- und Wettbewerbsgesetzes ebenfalls den Abbau des Beteiligungsbesitzes der Banken auf maximal 5 Prozent vorsieht. Bestehende Beteiligungen sollen kontinuierlich innerhalb einer Fünf-Jahres-Frist abgebaut werden. Ausnahmen sollen nur noch für den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen mit bankbezogenen Hilfsdiensten oder in Sanierungsfällen gelten, wobei die Beteiligung spätestens nach 5 Jahren wieder zu veräußern ist, sowie für Beteiligungen an Wagnisfinanzierungsgesellschaften oder für den sogenannten Handelsbestand, der aus der Übernahme und Unterbringung von Aktienemissionen verbunden ist. Stimmrechte aus diesem Handelsbestand dürften jedoch nicht ausgeübt werden.
Vertreter der Banken weisen diese Forderungen nach einer Begrenzung des Anteilsbesitzes der Banken zurück. Ein solcher Schritt hätte nach ihrer Auffassung erhebliche negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Schließlich würden Banken hauptsächlich Beteiligungen übernehmen, um in Krisensituationen geratene Unternehmen zu unterstützen. Typische Beispiele dafür seien das Engagement der Deutschen Bank beim Kölner Unternehmen Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD) oder bei der Frankfurter Metallgesellschaft. Nur durch das En gagement der Banken sei die Metallgesellschaft überhaupt vor dem Konkurs bewahrt und damit Tausende von Arbeitsplätzen gerettet worden. Das Engagement in solchen Sanierungsfällen sei für die Banken weder lukrativ, noch mit dem Erwerb wirtschaftlicher Macht verbunden. Kritiker werfen den Banken dagegen vor, gerade bei den genannten Fällen auch eine Mitverantwortung für die krisenhafte Entwicklung dieser Unternehmen zu haben. Schließlich war die Metallgesellschaft auch schon vor dem Beinahe-Zusammenbruch Ende 1993 überwiegend im Besitz der Frankfurter Großbanken. Vertreter der Dresdner und der Deutschen Bank wechseln sich dort turnusmäßig als Vorsitzende des Aufsichtsrates ab. Und auch der Anteilsbesitz der Deutschen Bank an der Kölner KHD sei nicht erst als Folge einer großangelegten Rettungsaktion für das in Not geratene Unternehmen erfolgt. Auch dort sitzt ein Repräsentant der Deutschen Bank dem Aufsichtsrat vor. Es sei fraglich, ob die Banken nicht auch Verantwortung dafür zu übernehmen hätten,, daß diese Unternehmen überhaupt in derartige Schwierigkeiten gekommen sind. Dagegen verweisen die Banken darauf, daß sie mit den von ihnen gehaltenen Beteiligungen eben keine unternehmerische Absichten verfolgten und somit auch keinen Einfluß auf die Geschäftspolitik dieser Unternehmen ausüben könnten.
Aus Sicht der Banken sei es zudem ein Trugschluß zu glauben, daß man zukünftig mittels einer Art Ausnahmekatalog für Bankbeteiligungen festlegen könne, daß die Banken immer dann wie die Feuerwehr zu einem Unternehmen gerufen werden könnten, wenn es dort brennt, um dann, wenn das Unternehmen nach einigen Jahren wieder in die Gewinnzone gekommen sei, ihre Beteiligung schnellstens wieder
[Seite der Druckausgabe: 24]
abbauen zu müssen. Eine solche Trennung der in "gute" Beteiligungen der Banken, die in Sanierungsfällen erwünscht sind, und "schlechte" Beteiligungen, die angeblich ordnungspolitisch problematisch seien, würden die Banken nicht akzeptieren. Schließlich habe gerade das Beispiel "Aufbau Ost" unterstrichen, wie wichtig das finanzielle Engagement von Banken und die damit verbundene Übernahme von Beteiligungen für den dortigen Aufbau der Wirtschaft und die Sicherung von Arbeitsplätzen sei. Es sei bezeichnend, daß die Politiker aller Parteien beim "Aufbau Ost" lautstark nach den Banken und ihrer "Bankenmilliarde" gerufen hätten.
Darüber hinaus müsse beim Abbau des Anteilsbesitzes der Banken nach Einschätzung eines Vertreters des Bundeswirtschaftsministeriums damit gerechnet werden, daß es in dessen Folge zu erheblichen Turbulenzen am deutschen Aktienmarkt kommt. Schließlich soll nach den Vorstellungen der SPD binnen 5 Jahren der Beteiligungsbesitz der Banken und Versicherungen, dessen Wert nach Einschätzung von Fachleuten bei rund 40 Milliarden liegt, erheblich reduziert werden. Es sei zu befürchten, daß dieser Abbau bei den betroffenen Unternehmen zu einem erheblichen Kursverfall mit Konsequenzen für die Eigenkapitalversorgung der deutschen Wirtschaft führen werde. Die Folgen derartiger Kursschwankungen für den deutschen Aktienmarkt als ganzes seien unkalkulierbar. Mit großer Sicherheit würden sich die zu erwartenden Turbulenzen negativ auf die Mentalität der Anleger auswirken und deren Aversionen gegen die Aktie noch weiter verstärken. Und schließlich stelle sich die Frage, wer die von den Banken veräußer ten Unternehmensanteile aufnehmen wird. Ein Vertreter eines Industrieverbandes drückt seine Sorge aus, daß dann vermutlich ausländische Anleger diese Beteiligungen an deutschen Unternehmen übernehmen würden. Da ausländische institutionelle Anleger jedoch vollkommen andere Anlagestrategien verfolgten als die langfristig orientierten Banken, hätte auch dies erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft.
Neben diesen negativen Auswirkungen bestehen nach Einschätzung der Banken grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen einen zwangsweisen Abbau des Anteilsbesitzes der Banken. Und dabei sei fraglich, ob diese Bedenken durch die Festsetzung eines beliebig langen Zeitraums zum Abbau der Beteiligungen ausgeräumt werden können. Gleichwohl wäre der Weg einer Verfassungsklage, die der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, bereits angedroht hatte, der allerletzte Weg, um eine gesetzliche Regelung zu verhindern. Vertreter der Banken hoffen jedoch, daß ein solcher Schritt nicht notwendig sein wird.
Ein Vertreter der Monopolkommission verweist darauf, daß der Aspekt des Risikoausgleichs der Banken oder der historische Sonderfall "Aufbau Ost" mit dem ordnungspolitischen Problem der dauerhaften hohen Beteiligungen der Banken und ihrer wettbewerbsrechtlichen Aspekte schlichtweg nichts zu tun haben. Beim "Aufbau Ost" habe sich das Engagement der Banken ohnehin weitgehend auf banktypische Funktionen beschränkt. Die Beteiligungsmöglichkeiten der Banken
[Seite der Druckausgabe: 25]
in Sanierungsfällen sollen zudem auch zukünftig ausdrücklich möglich sein. Und auch die Frage des Risikoausgleichs der Banken könne kein Argument für die Beibehaltung hoher Beteiligungen von Banken an einzelnen Unternehmen sein. Denn gerade unter dem Aspekt der Risikostreuung seien fünf Beteiligungen zu jeweils 5 Prozent sicherer als eine Beteiligung zu 25 Prozent.
Ein Wissenschaftler und Aktionärsvertreter hält den Aspekt des von den Banken intendierten Risikoausgleichs ohnehin für keine schlüssige Begründung für Bankenbeteiligungen. So hatte der Vorstand der Deutschen Bank in seiner Stellungnahme zu einem entsprechenden Antrag zur Tagesordnung der Hauptversammlung der Deutschen Bank entgegnet: "Die von uns gehaltenen Beteiligungen auch im Nichtbankenbereich stellen Finanzanlagen dar, die zum Ergebnis der Bank beitragen, und dabei die typischen Ertragsrisiken einer Universalbank vermeiden". Dabei sei gerade diese Praxis aus Sicht der Aktionäre der Deutschen Bank äußerst fragwürdig. Denn für die Aktionäre käme es darauf an, einen undurchsichtigen Ertragsausgleich zu verhindern und einer wechselseitigen Subventionierung von Industrie- und Bankgeschäft entgegenzutreten, die es den Managern erleichtere, ungünstige Entwicklungen zu verdecken.
Zweifel werden auch angemeldet, ob der Abbau der Bankbeteiligungen automatisch zu einem Einbruch der Aktienkurse führen müsse. Schließlich gäbe es für die Auflösung der Aktienpakete der Banken Überlegungen und Modelle, die geeignet wären, eine solche Entwicklung auszuschließen. Statt des Verkaufes der Aktienpakete über den Markt sei eine Verteilung in natura anzustreben. Dies bedeutet, daß jeder Aktionär der Deutschen Bank beispielsweise eine Viertel Daimler-Benz-Aktie für jede Deutsche Bank-Aktie erhält. So könnte der Abbau bewerkstelligt werden, ohne Druck auf den Kapitalmarkt auszulösen. Der Kleinaktionär verfüge vorher und nachher über dasselbe Vermögen, denn schließlich gehöre ja auch heute schon jedem Aktionär der Deutschen Bank indirekt über den Beteiligungsbesitz der Deutschen Bank an der Daimler-Benz AG eine Viertel Daimler-Benz-Aktie. Der entscheidende Unterschied bestehe jedoch darin, daß er dann selbst über diesen Anteilsbesitz verfügte, und nicht mehr das Management der Deutschen Bank. Dieser Weg zum Abbau des Beteiligungsbesitzes der Banken wird auch von einem Vertreter der Bundeswirtschaftsministeriums als Möglichkeit gesehen, diesen Abbau ohne die Inkaufnahme von Kurseinbrüchen vorzunehmen. Gleichwohl sei dieser Weg seiner Einschätzung nach nur in Einzelfällen praktikabel.
[Seite der Druckausgabe: 26]
6.2 Das Depotstimmrecht der Banken
Neben dem Anteilsbesitz der Kreditinstitute an deutschen Wirtschaftsunternehmen wird vor allem das sogenannte Depotstimmrecht [ Fn.1: So strittig die Bewertung des Depotstimmrechts ist, so umstritten ist auch der Terminus. Vertreter der Banken lehnen den Begriff "Depotstimmrecht" ab und präferieren den Terminus "Auftragsstimmrecht", weil für sie die Erteilung des Auftrags zur Stimmrechtsvertretung an die Bank das entscheidende Kriterium dieser Regelung ist. Als dritte Variante wird schließlich der Begriff "Vollmachtsstimmrecht" verwendet. Alle drei Termini bleiben letztlich unscharf; schließlich basiert das durch die Banken ausgeübte Stimmrecht auf der Kombination der Faktoren Depotverwahrung und Vollmachtserteilung. So soll hier, ungeachtet der terminologischen Einwände, am Begriff "Depotstimmrecht" festgehalten werden, da sich dieser Begriff in der Diskussion weitgehend etabliert hat.] kritisiert. Beim Depotstimmrecht handelt es sich um das Recht der Kreditinstitute, das Stimmrecht in der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft für ihre Depotkunden auszuüben. Voraussetzung hierfür ist, daß die Aktionäre ihre Aktien in einem Depot des Kreditinstituts verwahren und diese das Kreditinstitut durch eine Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts ermächtigt haben.
Aufgrund des Depotstimmrechtes spielen die großen deutschen Banken in den deutschen Aktiengesellschaften eine zentrale Rolle. Denn in den Hauptversammlungen der großen Publikumsgesellschaften vertreten die Banken in der Regel mittels der von ihren Depotkunden erhaltenen Stimmrechtsvollmachten die Mehrheit der Stimmen. Damit verfügen die Banken über ein erhebliches Einflußpotential auf die Gesellschaft. Nach dem gültigen Aktienrecht hat die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft in Deutschland eine zentrale Bedeutung. Hier üben die Aktionäre als Eigentümer der Gesellschaft ihre Rechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft aus. Zu den wichtigsten Rechten der Hauptversammlung gehören die Bestellung des Aufsichtsrats, die Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, sowie die Entscheidung über Satzungsänderungen, Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und -herabsetzung, die Bestellung von Prüfern und die Auflösung der Gesellschaft. Aufgrund der großen Bedeutung der Hauptversammlung hat der Gesetzgeber in Deutschland einen besonderen Wert auf hohe Hauptversammlungspräsenzen gelegt und als Mittel zur Sicherung dieser Präsenzen das Depotstimmrecht der Kreditinstitute in seiner jetzigen Form festgeschrieben.
Das heutige Depotstimmrecht der Banken hat seine Wurzeln in den Gründerjahren des deutschen Kaiserreichs. Die junge Gesellschaftsform der Aktiengesellschaft erlebte einen regelrechten Boom. Die ersten Publikumsgesellschaften mit breit gestreutem Aktienbesitz entstanden. Die Hauptversammlungen hatten damals nicht die Bedeutung, die ihnen das Aktienrecht heute zuschreibt, um so verständlicher war die Tendenz vieler Kleinaktionäre, nicht persönlich zu den Haupt-
[Seite der Druckausgabe: 27]
versammlungen der Aktiengesellschaften zu erscheinen. Die Vertretung dieser Aktionäre übernahmen die Banken, in deren Depots die Kleinaktionäre ihre Aktien verwahrten. Klare Regeln für diese Stimmrechtsvertretung durch die Banken gab es noch nicht; viele Banken stimmten ohne eine Beauftragung durch den Aktionär in der Hauptversammlung in ihrem Sinne ab. Mit der Aktienrechtsnovelle von 1884 wurde das Depotstimmrecht erstmals juristisch spezifiziert. Die Stimmrechtsausübung ohne eine entsprechende Vertretungsbefugnis oder Einwilligung durch den Aktionär wurde nun unter Strafe gestellt. Die Banken nahmen daraufhin Regelungen für die Stimmrechtsvertretung ihrer Depotkunden in ihre Geschäftsbedingungen auf. Demnach waren die Banken zur Stimmrechtsausübung der von ihnen verwahrten Depotaktien ermächtigt, soweit keine gegenteilige Weisung des Aktionärs vorlag. Die wirtschaftlichen Turbulenzen der Weimarer Republik führten zu erheblichen Auswirkungen auf das deutsche Aktienwesen. Durch die Zersplitterung des Aktienbesitzes und eine kontinuierlich wachsende Zahl von Kleinaktionären mit jeweils nur geringem Aktienbesitz erlangte das Depotstimmrecht der Banken eine immer größere Bedeutung. Die zunehmende Machtentfaltung der Banken in den Hauptversammlungen der Aktiengesellschaften, ohne dabei ein eigenes Kapitalrisiko zu tragen, geriet zunehmend in die Kritik.
Die langjährigen Diskussionen über eine Novellierung des Aktienrechts mündeten 1937 in der Verabschiedung des Aktiengesetzes, das erstmals eine positiv-rechtliche Regelung des Depotstimmrechts enthielt. Demnach war nun eine schriftliche Ermächtigung des Aktionärs für die Ausübung des Depotstimmrechts durch seine Depotbank notwendig, die für maximal 15 Monate gültig sein durfte. Trotz dieser Neuregelung blieb die Kritik am Depotstimmrecht der Banken bestehen. 1965 trat die umfassende Aktienrechtsnovelle in Kraft, die auch eine Neuregelung des umstrittenen Depotstimmrechts beinhaltete. Ziel dieser Neuregelung war laut Begründung des Regierungsentwurfs, "die Teilnahme der einzelnen Aktionäre am Leben der Gesellschaft (zu) aktivieren und die Ausübung ihrer Rechte, insbesondere des Stimmrechts, wirksamer (zu) gestalten". Deshalb sollte in der Neuregelung eindeutig klargestellt werden, daß es sich beim Depotstimmrecht nicht um ein eigenes Stimmrecht der Banken handelt, sondern um ein "von den Banken im Auftrag des Aktionärs nach dessen Weisungen ausgeübtes Stimmrecht".
Die mit der Aktienrechtsnovelle von 1965 verabschiedete und heute unverändert gültige Neuregelung für das Depotstimmrecht hielt an der 15monatigen Dauervollmacht fest. Demnach können die Banken auf Basis einer für längstens 15 Monate gültigen und jederzeit widerruflichen Pauschalvollmacht das Stimmrecht für ihre Depotkunden ausüben. Vor der Hauptversammlung muß die Bank ihrem Depotkunden eigene Vorschläge für die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung mitteilen, bei denen sie sich vom Interesse des Aktionärs leiten zu lassen hat. Erhält die Bank keine gesonderte Weisungen des Aktionärs für ein bestimmtes Abstimmungsverhalten, darf die Bank in der Hauptversammlung gemäß den dem Aktionär unterbreiteten Vorschlägen abstimmen. Sie darf jedoch von diesen Vorschlägen abweichen, wenn sie davon ausgehen
[Seite der Druckausgabe: 28]
kann, daß der Aktionär bei Kenntnis der Sachlage die abweichende Ausübung des Stimmrechts billigen würde. Eine Ausnahme von dieser Stimmrechtsregelung sieht das Aktiengesetz lediglich für die eigenen Hauptversammlungen der Kreditinstitute vor. Dort dürfen Banken für ihre Depotkunden nur auf der Basis ausdrücklicher Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung abstimmen; pauschale Vollmachten dürfen hier nicht verwendet werden.
Die mit der Neuregelung des Depotstimmrechts angestrebte Entschärfung der öffentlichen Kritik gelang jedoch nicht. Immer wieder wurde das Depotstimmrechts zum Gegenstand intensiver Diskussionen. Im Mittelpunkt der Kritik steht die Tatsache, daß die Banken durch das Depotstimmrecht in den Hauptversammlungen der meisten Aktiengesellschaften über die Mehrheit der Stimmen verfügen, ohne dabei ein eigenes Kapitalrisiko zu tragen. Empirische Studien über die Stimmenverteilung bei Hauptversammlungen belegen die große Bedeutung des Depotstimmrechts in den deutschen Publikumsgesellschaften. Derartige Studien sind jedoch bislang rar. Auch in diesem Bereich der Diskussion über die "Macht der Banken" ist die Zahl der interpretationsfähigen Daten sehr gering. Wissenschaftler kritisieren hierbei die Banken, die zwangsläufig über eine Fülle von Daten zur Ausübung des Depotstimmrechts verfügen. In einer jüngeren Studie hat der Osnabrücker Universitätsprofessor Theodor Baums die Ausübung des Depotstimmrechts untersucht. Hierfür wurde die Stimmrechtsverteilung in den Hauptversammlungen der 24 größten Aktiengesellschaften in Streubesitz - also Gesellschaften ohne einen oder mehrere Großaktionäre - in den Hauptversammlungen des Jahres 1992 untersucht (Abbildung l).
Die Statistik belegt die entscheidende Funktion des Depotstimmrechts bei der Kontrolle deutscher Publikumsgesellschaften. Demnach übten die Banken in den Hauptversammlungen der 24 größten Aktiengesellschaften in Streubesitz durchschnittlich 60,95 Prozent der Stimmen durch die ihnen übertragenen Depotstimmrechte aus. Der Eigenbesitz der Banken an diesen Gesellschaften betrug durchschnittlich 13 Prozent. Insgesamt betrug das von den Banken mittels Eigenbesitz, Depotstimmen sowie den von bankeigenen Kapitalanlagegesellschaften vertretenen Anteilen ausgeübte Stimmrechtspotential sogar 84,09 Prozent. Gerade bei den Publikumsgesellschaften in Streubesitz, bei denen der direkte Anteilsbesitz der Kreditinstitute vergleichsweise gering ist, verfügen die Banken somit über die dominierende Position in den Hauptversammlungen. Weitere Untersuchungen der Universität Osnabrück haben ergeben, daß sich die Depotstimmrechte dabei hauptsächlich bei den Großbanken konzentrieren.
[Seite der Druckausgabe: 29]
Abbildung 1: Stimmrechtsanteile der Banken in den Hauptversammlungen der 24 größten Publikumsgesellschaften in Streubesitz 1992
|
lfd. Nr. |
Unternehmen |
Eigenbesitz |
abhängige Investmentfonds |
Vollmachtsstimmen |
Summe |
|
1 |
Siemens |
|
9,87 |
85,61 |
95,48 |
|
2 |
Volkswagen |
|
8,89 |
35,16 |
44,05 |
|
3 |
Hoechst |
|
10,74 |
87,72 |
98,46 |
|
4 |
BASF |
0,09 |
13,61 |
81,01 |
94,71 |
|
5 |
Bayer |
|
11,23 |
80,09 |
91,32 |
|
6 |
Thyssen |
6,77b |
3,62 |
34,98 |
45,37 |
|
7 |
VEBA |
|
12,62 |
78,23 |
90,85 |
|
8 |
Mannesmann |
|
7,76 |
90,35 |
98,11 |
|
9 |
Deutsche Bank |
|
12,41 |
82,32 |
94,73 |
|
10 |
MAN |
8,67b |
12,69 |
26,84 |
48,20 |
|
11 |
Dresdner Bank |
|
7,72 |
83,54 |
91,26 |
|
12 |
Preussag |
40,65 |
4,51 |
54,30 |
99.46 |
|
13 |
Commerzbank |
|
15,84 |
81,71 |
97,55 |
|
14 |
VIAG |
10,92 |
7,43 |
30,75 |
49,10 |
|
15 |
Bayr. Vereinsbank |
|
11,54 |
73,15 |
84,69 |
|
16 |
Degussa |
13.65c |
8,65 |
38,35 |
60,65 |
|
17 |
AGIV |
61,19 |
15,80 |
22,10 |
99,09 |
|
18 |
Bayr. Hypo |
0,05 |
10,69 |
81,38 |
92,12 |
|
19 |
Linde |
33,29 |
14,68 |
51,10 |
99,07 |
|
20 |
Deutsche Babcock |
3,22 |
11,27 |
76,09 |
90,58 |
|
21 |
Schering |
|
19,71 |
74,79 |
94,50 |
|
22 |
KHD |
59,56b |
3,37 |
35,03 |
97,96 |
|
23 |
Bremer Vulkan |
|
4,43 |
57,10 |
61,53 |
|
24 |
Strabag |
74,45 |
3,62 |
21,21 |
99,28 |
|
Durchschnitt |
13,02 |
10,11 |
60,95 |
84,09 | |
a In % der vertretenen Stimmen; einschließlich der Stimmrechtsanteile mehrheitlich kontrollierter Tochtergesellschaften wie z.B. von Kapitalanlagegesellschaften
b Stimmen wurden indirekt ausgeübt.
c Stimmen wurden indirekt über die GFC Gesellschaft für Chemiewerte mbH ausgeübt.
Quelle: Theodor Baums, Christian Fraune: Institutionelle Anleger und Publikumsgesellschaft. Eine empirische Untersuchung, Osnabrück 1994
[Seite der Druckausgabe: 30]
Ein Wissenschaftler sieht im Depotstimmrecht das entscheidende Instrument bei der faktischen Kontrolle deutscher Aktiengesellschaften durch die Banken. Die Entkoppelung von Kapitalrisiko und Einflußpotential berge zudem die Gefahr, daß die Depotstimmrechte im Zweifelsfall nicht im Sinne der Aktionäre ausgeübt werden. Dies sei um so wahrscheinlicher, wenn die Depotbank bei einem Unternehmen auch eigene Interessen habe, die sich beispielsweise aus Anteilsbesitz oder laufenden Krediten ergeben. Als Beispiel dafür wird auf die Hauptversammlung der Daimler-Benz AG vom Dezember 1993 verwiesen. Dort mußte darüber entschieden werden, ob die sogenannten EK-56-Rücklagen des Konzerns - immerhin ein Betrag von rund 11,8 Milliarden DM - an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollten. Bei diesem EK-56-Kapital handelte es sich um Gewinnrücklagen, die zwischen 1977 und 1989 angefallen und mit dem damaligen Körperschaftssteuersatz von 56 Prozent belastet wurden. Im Falle einer Ausschüttung im Jahre 1993 hätten die Aktionäre die Differenz zwischen dem damaligen Steuersatz und dem 1993 gültigen Satz für ausgeschüttete Gewinne von lediglich 36 Prozent vom Finanzamt erstattet bekommen. Damit die gigantische Ausschüttung die Daimler-Benz AG nicht zu sehr finanziell belasten würde, hatten Aktionärsvertreter im Rahmen eines "Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens" die gleichzeitige Erhöhung des Daimler-Benz-Grundkapitals um dieselbe Summe vorgeschlagen. Mit derartigen Verfahren hatten schon andere Gesellschaften in vergleichbaren Fällen erfolgreich operiert. Gleichwohl hatte sich die Unternehmensverwaltung von Daimler-Benz wegen des aus ihrer Sicht nicht garantierten Kapitalrückflusses gegen ein solches Verfahren ausgesprochen. Für die Depotbanken galt es nun, sich bei der Entscheidung über die Ausschüttung der EK-56-Rücklagen zwischen den Interessen der Aktionäre, für die die Ausschüttung im Schnitt eine "Superdividende" von 340 DM pro Aktie bedeutet hätte, und denen des Managements von Daimler-Benz zu entscheiden. Die Entscheidung der Depotbanken war eindeutig. Der Antrag zur Ausschüttung der Rücklagen wurde mit mehr als 99,7 Prozent der Stimmen abgelehnt.
Aktionärsvertreter werfen den Banken vor, in den Fällen, in denen die Interessen der Aktionäre mit denen der Unternehmensverwaltungen kollidierten, stets mit der Verwaltung abzustimmen, selbst wenn sie dadurch den Interessen der eigentlich von ihnen zu vertretenen Aktionäre schadeten. In seiner bestehenden Form diene das Depotstimmrecht daher faktisch als Managerschutz. Aus diesem Grunde fordert ein Aktionärsvertreter und Wissenschaftler die ersatzlose Abschaffung des Depotstimmrechts. Statt der pauschalen 15-Monats-Vollmacht für Banken sollen diese das Stimmrecht für ihre Depotkunden nur noch aufgrund konkreter Einzelweisungen zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung ausüben dürfen, wie dies heute schon in den Hauptversammlungen der Kreditinstitute vorgeschrieben ist. Die Erfahrungen dieser Hauptversammlungen, bei denen es nicht zu dem be fürchteten Rückgang der Präsenzen gekommen sei, dokumentiere die Praktikabilität einer solcher Neuregelung.
[Seite der Druckausgabe: 31]
Die Kritik am Depotstimmrecht wird von Vertretern von Banken und Industrieverbänden zurückgewiesen. Sie verweisen auf die positive Bedeutung, die das heutige Depotstimmrecht für die Stabilität deutscher Aktiengesellschaften einnehme. Denn angesichts der geringen Bereitschaft vieler Aktionäre, persönlich zu den Hauptversammlungen der Aktiengesellschaften zu gehen, garantiere einzig eine Regelung wie das Depotstimmrecht hohe Hauptversammlungspräsenzen. Und hohe Hauptversammlungspräsenzen seien notwendig, um Zufallsmehrheiten und damit die Dominanz von Minderheiten auszuschließen und zugleich sicherzustellen, daß auch der in der Hand von Kleinaktionären befindliche Streubesitz in der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft zum Tragen komme. Dabei würden die Banken seit den 60er Jahren erklären, daß sie nicht am Depotstimmrecht "kleben". Bislang sei jedoch keine praktikable Alternative zum bisherigen Depotstimmrecht vorgeschlagen worden, die in gleichem Maße hohe Hauptversammlungspräsenzen garantiere. Eine schlichte Abschaffung des Depotstimmrechts würde dagegen zu einem dramatischen Einbruch der ohnehin schon sinkenden Hauptversammlungspräsenzen führen, was für die deutschen Aktiengesellschaften zu unkalkulierbaren Entwicklungen führen würde. Die vergleichsweise hohen Präsenzen in den Hauptversammlungen der Banken könnten dabei nicht ohne weiteres auf alle Aktiengesellschaften hochgerechnet werden. Die Banken würden sich bei ihren eigenen Hauptversammlung mit großem Aufwand darum bemühen, eine hohe Zahl an Einzelweisungen zu erhalten. Ob andere Aktiengesellschaften einen vergleichbaren Aufwand betreiben würden, sei unwahrscheinlich. Zudem sei es keine originäre Aufgabe der Banken, für andere Aktiengesellschaften Einzelweisungen einzutreiben.
Ein Vertreter eines Bankenverbandes sieht in der hohen Zahl an Stimmrechtsvollmachten, die die Banken von ihren Kunden erhalten, einen deutlichen Beleg für das Vertrauen, das die Aktionäre ihren Depotbanken bei der Frage einer qualifizierten Vertretung in den Hauptversammlungen entgegenbrächten. Denn schließlich böte das Aktienrecht den Aktionären schon heute eine Reihe anderer Mög lichkeiten, ihr Stimmrecht auszuüben. In der Tat kann der Aktionär anstelle seiner Bank auch eine Aktionärsvereinigung oder eine beliebige Person seiner Wahl mit der Ausübung seines Stimmrechts beauftragen. Oder er kann seiner Bank eine gesonderte Weisung für ein bestimmtes Abstimmungsverhalten bei den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung vorschreiben. Und schließlich kann der Aktionär sein Stimmrecht persönlich ausüben. Angesichts dieser Alternativen interpretieren die Banken die Entscheidung eines Aktionärs, sein Stimm recht an seine Bank zu übertragen, als bewußtes Votum für diese Bank. Die pauschale Addition der in den Hauptversammlungen von Publikumsgesellschaften durch die Banken insgesamt ausgeübten Stimmrechtsvollmachten sei zudem zu undifferenziert. Schließlich würden damit die Unterschiede zwischen den von den Banken ausgeübten Einzelweisungen und den aufgrund der 15monatigen Pauschal-Vollmachten ausgeübten Stimmrechte verwischt. Dabei räumen jedoch auch die Banken ein, daß die Zahl der Aktionäre, die konkrete Einzelweisungen erteilten,
[Seite der Druckausgabe: 32]
üblicherweise ziemlich gering sei. Nach Schätzungen von Aktionärsvertretern liegt die Zahl dieser Einzelweisungen derzeit bei maximal 2 Prozent.
Außerdem würden bei der pauschalen Addition aller durch Banken ausgeübten Stimmrechte einmal mehr die Unterschiede zwischen den einzelnen Instituten übersehen. Derartige Unterschiede zwischen den einzelnen Banken können Aktionärsvertreter nicht bestätigen. Sie verweisen darauf, daß die Banken in mehr als 99 Prozent aller Entscheidungen im Sinne der Verwaltung votieren. Nach Auffassung eines Aktionärsvertreters und Wissenschaftlers habe sich dabei ein regelrechter Automatismus entwickelt, der teilweise humoreske Folgen habe. Dies gehe so weit, daß die Depotbanken ihren Aktionären sogar empfehlen, mit der Verwaltung zu stimmen, wenn die Verwaltung ihrerseits gar keine Abstimmungsempfehlung vorgegeben habe. So sollte beispielsweise bei der Hauptversammlung der RWE im Jahre 1992 über verschiedene Anträge entschieden werden, die darauf abzielten, die Mehrfachstimmrechte der Gemeinden abzuschaffen. Da sich die RWE-Verwaltung aus verschiedenen Gründen über diesen Tagesordnungspunkt uneinig war, hatte sie ihren Aktionären keine Abstimmungsempfehlung vorgelegt. Dies hinderte die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank jedoch nicht daran, ihren Depotkunden zu empfehlen, mit der Verwaltung zu stimmen. Diese grundlegende Konformität der Interessen zwischen Verwaltung und Depotbank resultiert nach Auffassung eines Vertreters der Monopolkommission aus der Tat sache, daß das Konzernmanagement in Deutschland aufgrund des Depotstimmrechts im wesentlichen durch die Banken bestellt wird. Dies erkläre auch, warum die Unternehmensverwaltungen und ihre Interessenverbände mit der bestehenden Regelung so zufrieden sind.
Aktionärsvertreter und Wissenschaftler werfen den Banken vor, sie würden ihren Kunden in der Praxis das Stimmrecht regelrecht "abschwatzen". Entgegen ihren eigenen Bekundungen hätten die Banken eben kein Interesse daran, sich das Machtinstrument Depotstimmrecht aus der Hand nehmen zu lassen. Dies zeige sich schon daran, daß die Banken ihre Depotkunden bislang in keiner Weise über bestehende Alternativen zur Bevollmächtigung ihrer Bank informieren. So würden sich bei den Aktionärsvereinigungen immer wieder Aktionäre melden, die nicht wüßten, auf welcher Grundlage und auf welche Weise sie diese Vereinigung mit der Wahrnehmung ihrer Interessen in einer Hauptversammlung beauftragen können. Aktionärsvertreter gehen davon aus, daß die Zahl der an sie vergebenen Stimmrechtsvollmachten erheblich ansteigen würde, wenn die Alternativen zur Pauschal-Vollmacht stärker bekannt gemacht würden. Bei der dazu notwendigen Verbesserung der Transparenz fiele den Banken zwangsläufig eine Schlüsselrolle zu, da sie über die Depotverwaltung den Kontakt zwischen der Unternehmensverwaltung und dem Aktionär halten. Und gerade dann, wenn die Banken nicht an der Ausübung des Depotstimmrecht "klebten" und die Wahrnehmung der Stimmrechte in den Hauptversammlungen eher einer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung als einem originären Interesse entspringe, sei es nur konsequent, wenn die Banken Alternativen zur Bank-Vollmacht stärker als bisher bekannt machten.
[Seite der Druckausgabe: 33]
Denkbar sei hier ein modifiziertes Formular, das neben den bisherigen Möglichkeiten der Pauschal-Vollmacht an die Bank und der Erteilung von konkreten Einzelweisungen auch die Möglichkeit der gezielten Beauftragung beispielsweise von Aktionärsvereinigungen explizit vorsieht.
Solchen Vorschlägen stehen die Banken jedoch ablehnend gegenüber. Ein Vertreter eines Industrieverbandes bezeichnet es schlichtweg als "weltfremd" anzunehmen, daß gerade die Banken für "Konkurrenz-Organisationen" Werbung betreiben sollten. Worauf sich diese Konkurrenzsituation mit anderen Aktionärsvertretern angesichts des von den Banken angeblich ungeliebten Depotstimmrechts bezieht, läßt er jedoch offen. Ein Aktionärsvertreter hält es schlichtweg für "schizophren", auf der einen Seite zu behaupten, man "klebe" nicht am Depotstimmrecht, da dies in der Praxis nur Kosten und Aufwand bedeutete, während die Banken auf der anderen Seite das Vorhandensein von Alternativen regelrecht verheimlichten. Dies sei ein deutlicher Beleg dafür, daß die Banken eben doch am Depotstimmrecht "klebten".
Nach Einschätzung eines Wissenschaftlers und Aktionärsvertreters muß man grundsätzlich davon ausgehen, daß Klein- und Kleinstaktionäre ohnehin nicht aktiviert werden können, da für sie eine Intensivierung ihres Engagements keinen Sinn mache. Denn schließlich hielten diese Aktionäre ihre Aktien ausschließlich als Kapitalanlage und nicht, um sich darüber hinaus um die Lösung der betriebswirtschaftlichen Probleme von Daimler-Benz oder der Deutschen Bank zu kümmern. Von dieser Prämisse müßten alle Reformansätze bei der Frage des De potstimmrechts ausgehen. Die entscheidende Frage sei dann, ob man durch die Schaffung eines organisierten Vertretungsmechanismus die passiven Aktionäre in der Hauptversammlung zu vertreten versucht. Es sei jedoch ein Irrtum zu glauben, die Entscheidungsfindung in der Hauptversammlung lasse sich dadurch verbessern, daß man die Stimmen passiver Anleger treuhänderisch über einen organisierten Vertretungsmechanismus mobilisiert. Diese Stimmrechtstreuhänder brächten stets andere Interessen als die von Aktionären ein, da sie für sich selbst andere Interessen verfolgen und ihnen die der Aktionäre erst in zweiter Linie wichtig sind. Deshalb sei es besser, auf derartige Treuhänder generell zu verzichten, die die Stimmen passiver Aktionäre mißbrauchen könnten. Deshalb müsse das Depotstimmrecht generell und ersatzlos abgeschafft werden. Die Folge dieser Abschaffung wäre natürlich die Gefahr sinkender Hauptversammlungspräsenzen. Eine Hauptversammlungpräsenz von 20 Prozent gut informierter Aktionäre sei jedoch ohnehin besser als eine formale Präsenz von 60 Prozent, von denen die Mehrheit als Stimmrechtsvertreter andere Interessen als die der Aktionäre vertritt. Beispiele aus anderen Rechtssystemen, die trotz des Verzichts auf einen organisierten Vertretungsmechanismus passiver Aktionäre eine leistungsfähige Aktionärskultur aufgebaut haben, machen deutlich, daß es auch ohne Stimmrechtstreuhänder geht.
[Seite der Druckausgabe: 34]
Ein SPD-Politiker steht einer solchen Forderung nach der ersatzlosen Abschaffung des Depotstimmrecht skeptisch gegenüber. Der Grund hierfür sei aber nicht die Sorge vor angeblich systemdestabilisierenden Zufallsmehrheiten, da dieses Risiko in einem System wie dem deutschen bei allen Prozessen demokratischer Willensbildung unvermeidlich sei, sondern die Gefahr, daß eine ersatzlose Abschaffung des Depotstimmrechts dazu führe, daß die bestehenden Machtkonzen trationen bei einigen wenigen, finanzstarken Aktionären wie Banken und Versicherungen trotz der Einführung neuer Beteiligungsobergrenzen erneut festgeschrieben würde. So könnten ein oder zwei Aktionäre mit einem Anteilsbesitz von jeweils 5 Prozent bei einem Abrutschen der Hauptversammlungspräsenzen auf 20 Prozent unverändert entscheidenden Einfluß auf die Aktiengesellschaft ausüben. Aus diesem Grunde habe die SPD-Bundestagsfraktion nach intensiven Gesprächen mit Aktionärsvertretern, aber auch Banken- und Industrievertretern ihre früher vertretene Forderung nach einer ersatzlosen Abschaffung der Depotstimmrechts revidiert.
Statt dessen hat die SPD-Bundestagsfraktion in ihrem Transparenz- und Wettbewerbsgesetz die Einführung einer vollkommen neuen Regelung vorgeschlagen. Das bisherige Depotstimmrecht für Kreditinstitute soll durch die Einführung einer neuen professionellen und unabhängigen Aktionärsvertretung ersetzt werden. Diese unabhängigen Aktionärsvertreter sollen sich zukünftig um die Vertretungsvollmachten bei den Aktionären bewerben, die dann frei darüber entscheiden können, wen sie mit der Vertretung ihrer Stimmrechte in der Hauptversammlung beauftragen wollen. Den Aktionärsvertretern können die Aktionäre dann wie bisher entweder eine längstens für 15 Monate gültige, pauschale Vollmacht erteilen, oder sie schreiben den Aktionärsvertretern oder ihrer Depotbank mittels konkreter Einzelweisungen ein bestimmtes Abstimmungsverhalten in der Hauptversammlung vor. Als Aktionärsvertreter kommen nach Vorstellung der SPD Wirtschaftsprüfer und andere besonders qualifizierte Personen in Frage. Die Zunft der Wirtschaftsprüfer sei dabei aus formalen Erwägungen zum Maßstab für den Beruf des Aktionärsvertreters gewählt worden, weil an diesen Berufsstand bestimmte qualitative Voraussetzungen gekoppelt sind, die nach Vorstellung der SPD unerläßliche Voraussetzungen für die Ausübung einer qualifizierten Aktionärsvertretung sind. Zudem sei die Unabhängigkeit von Wirtschaftsprüfern gesetzlich geregelt, wobei der SPD-Gesetzentwurf Maßnahmen beinhaltet, die die Unabhängigkeitsanforderungen an die Wirtschaftsprüfer substantiell verbessern.
Gerade angesichts der prinzipiellen Risiken eines organisierten Vertretungsmechanismus für passive Aktionäre böte die Verlagerung des Vertretungsrechts für Aktionäre auf unabhängige Aktionärsvertreter den entscheidenden Vorteil, daß sich die Aktionärsvertreter nicht vor der Unternehmensverwaltung oder einer Depotbank, sondern einzig vor den Aktionären beweisen müßten. Denn die Aktionärsvertreter würden von den Aktionären bestimmt, die dann jedes Jahr frei entscheiden könnten, wen sie mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragten. Erstmals käme es so zu einem echten Wettbewerb um Stimmrechtsvollmachten.
[Seite der Druckausgabe: 35]
Diese neue Regelung würde die bestehenden Interessenkonflikte beseitigen und sei nicht zu vergleichen mit der heutigen Situation, in der die Depotbank dem uninformierten Aktionär gegenüber faktisch ein Vertretungsmonopol hat. Und die Depotbank könnte auch zukünftig mit eigenen Abstimmungsvorschlägen um Einzelweisungen werben. Dabei müßte sich jedoch die Qualität ihrer Vorschläge erstmals mit denen unabhängiger Aktionärsvertreter messen lassen.
Vertreter von Aktionärsvereinigungen bezweifeln, daß Wirtschaftsprüfer geeignet seien, um dem Anspruch einer unabhängigen Aktionärsvertretung in den Hauptversammlungen gerecht werden zu können. Denn gerade Wirtschaftsprüfer seien derzeit in das Beziehungsgeflecht von Banken- und Unternehmensvorständen sehr eng eingewoben und hätten in der Vergangenheit in erheblichem Umfang durch dubiose Gutachten und Bewertungen dazu beigetragen, daß Aktionäre betrogen wurden. Ein SPD-Politiker hält dem entgegen, daß diese Mißstände natürlich auch den Initiatoren des SPD-Gesetzentwurfs nicht verborgen geblieben seien. Deshalb enthalte der Gesetzentwurf eine Reihe von Maßnahmen, die eine deutliche Verschärfung der Haftung für Wirtschaftsprüfer und eine gesetzliche Festschreibung ihrer Unabhängigkeit bedeute. Dadurch würde die derzeitige enge Verquickung von Wirtschaftsprüfern und den Unternehmensvorständen wirkungsvoll unterbunden. Zudem würde ihre Tätigkeit als Aktionärsvertreter zukünftig nicht nur vom Bundesaufsichtsamt, sondern auch durch den Wettbewerb zwischen einer Vielzahl von potentiellen Aktionärsvertretern kontrolliert.
Dagegen befürchten Vertreter von Banken- und Industrieverbänden, daß sich für dieses neue Amt des Aktionärsvertreters nicht genügend Interessenten finden ließen. Zudem sei fraglich, ob Wirtschaftsprüfer oder andere die an die Aktionärsvertreter gestellten Aufgaben überhaupt zu bewältigen vermögen. Alleine die Einholung von Stimmrechtsvollmachten und deren Verwaltung sei von Wirtschaftsprüfern logistisch nicht zu bewältigen. Dies könnten nur die Banken mit ihrem großen Apparat und der umfassenden Erfahrung in diesem Bereich. Diese Sorge ist aus Sicht eines SPD-Politikers unbegründet. Da das Amt des Aktionärsvertreters vernünftig entgolten werden soll, habe er volles Vertrauen in den Markt, daß sich hierfür genügend qualifizierte Personen finden ließen. Es sei er staunlich, daß die sonst so wettbewerbsorientierten Banken- und Industrievertreter dem Wettbewerb in diesem Fall ein so großes Mißtrauen entgegenbrächten. Und das Handling der Stimmrechtseinholung und -verwaltung sollte ebenfalls kein Problem sein, da die Informierung der Aktionäre wie gehabt über die Depotban ken abliefe, die dann ebenfalls für ihre Tätigkeiten von der Gesellschaft entgolten werden sollen. Schließlich sei es ohnehin ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, daß Banken bislang für die Ausübung des Vollmachtsstimmrechts keine Entgelte erhielten. Diese würden lediglich nicht offen ausgewiesen.
Ein anderer Vorschlag zur Modifizierung des Depotstimmrechts wird derzeit im Bundesministerium der Justiz diskutiert. Demnach soll das Depotstimmrecht der Banken unverändert beibehalten werden, wobei das Stimmrecht der Bank aber in
[Seite der Druckausgabe: 36]
Zukunft nur noch von einem ganz bestimmten Bankangestellten ausgeübt werden darf, dem sogenannten "Stimmrechtsmandatar". Dieser "Stimmrechtsmandatar" soll ähnlich einem Datenschutzbeauftragten von konkreten Weisungen unabhängig sein. Dadurch soll nach Einschätzung des Bundesministeriums der Justiz eine größere Unabhängigkeit bei der Stimmrechtsausübung sichergestellt werden. Vertreter von Aktionärsvereinigungen und Wissenschaftler bezweifeln dies. Ihrer Einschätzung nach dient diese Variante bestenfalls als kosmetische Korrektur, um die allgemeine Kritik unter Beibehaltung der faktischen Machtverteilung zu beruhigen. Nur dadurch, daß ein Mitarbeiter der Bank per definitionem für unabhängig erklärt und von konkreten Weisungen der Bank freigestellt werde, lasse sich der immanente Interessenkonflikt zwischen der Depotbank und den Aktionärsinteressen nicht lösen. Es sei schließlich nur schwerlich vorstellbar, daß ein derart "unabhängiger" Stimmrechtsmandatar aus dem Hause der Deutschen Bank in der Hauptversammlung der Metallgesellschaft gegen die Entlastung seines Vorstandsmitglied Ronaldo Schmitz als Aufsichtsratsvorsitzenden der Metallgesellschaft stimme. Auch ohne explizite Weisung dürfte dem Stimmrechtsmandatar der Deutschen Bank klar sein, wie er in einem solchen Fall abzustimmen habe.
6.3 Das deutsche Aufsichtsratssystem
Das Aktienrecht schreibt dem Aufsichtsrat in deutschen Aktiengesellschaften eine bedeutende Funktion zu. Er ist das zwingend notwendige Kontrollorgan der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat beruft die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, die ihrerseits die Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich zu führen haben, und überwacht die Arbeit des Vorstands. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in der Hauptversammlung von den Aktionären gewählt. Seit Einführung des Mitbestimmungsgesetzes im Jahre 1976 entsenden zudem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Gesellschaften mit mehr als 2.000 Mitarbeitern (in der Montanindustrie bereits ab 1.000 Mitarbeitern) die gleiche Zahl von Vertretern in den Aufsichtsrat. Dem Aufsichtsratsvorsitzenden kommt dabei eine besondere Bedeutung zu: Er hat im Aufsichtsrat doppeltes Stimmrecht.
Auch das deutsche Aufsichtsratssystem ist in die Kritik geraten. Spektakuläre Fälle wie der Beinahe-Zusammenbruch der Metallgesellschaft im Dezember 1993 haben Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit aufkommen lassen. Denn stets hatten die Aufsichtsratsmitglieder zu lange den teilweise eklatanten Mißständen in den betroffenen Gesellschaften zugeschaut, oder diese sogar, wie manche Kritiker argwöhnen, geduldet. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen auch hier die Banken. Denn ihre Vertreter nehmen in vielen Aufsichtsräten großer deutscher Aktiengesellschaften dominierende Positionen ein. Und bei den Skandalen der letzten Jahre waren sie oftmals involviert; im Falle der Metallgesellschaft AG und dem Zusammenbruch der Sachsenmilch AG war ein Vertreter der Deutschen Bank sogar als Aufsichtsratsvorsitzender tätig.
[Seite der Druckausgabe: 37]
Kritiker monieren das Auftreten von Interessenkonflikten, die sich durch die Ausübung der Kontrollfunktionen in den Aufsichtsräten von Unternehmen und den eigenen Interessen der Bank beispielsweise als Hausbank, Kreditgeber oder Anteilseigner ergeben können. Besonders problematisch wird dies in Fällen, wenn dieselbe Person oder dieselbe Bank zugleich auch noch bei konkurrierenden Unternehmen engagiert ist.
Nach Einschätzungen eines Wissenschaftlers hat sich in der deutschen Wirtschaft ein regelrechtes Netzwerk von Multi-Aufsichtsräten entwickelt. Dieses Netzwerk von einander persönlich oder aufgrund ihrer Gesellschaftszugehörigkeit gewogenen Aufsichtsräten hebelt die eigentliche Kontrollfunktion des Aufsichtsratssystems aus und dient in seiner heutigen Form lediglich der Abschirmung einer kleinen Gruppe von Konzernfunktionären vor der Kontrolle durch Außenstehende. Im Mittelpunkt dieses Netzwerks befinden sich die Banken. Mittels ihres Depotstimmrechts, das ihnen in den Hauptversammlungen regelmäßig die Stimmenmehrheit garantiert, haben sie entscheidenden Einfluß auf die Besetzung der Kontrollgremien, in denen folgerichtig ihre eigenen oder ihnen gewogene Vertreter dominieren. Deren Tätigkeit beschränkt sich dann auf die gegenseitige Abstimmung der Unternehmenspolitik; Kontrolle und Aufsicht hingegen werden vernachlässigt. Selbst bei offenkundigen Fehlleistungen mußten diese Aufsichtsräte zudem nicht mit Sanktionen rechnen, da ihnen aufgrund des Depotstimmrechts die Entlastung für ihre Tätigkeit sicher sei, und ihnen durch die faktisch unwirksamen Möglichkeiten zur Aktionärsklage keine Haftung drohe.
Aus Sicht der Banken wird der Einfluß der Banken auch hier weitgehend überschätzt. Die neue Untersuchung des Bundesverbandes deutscher Banken belege dies eindrucksvoll. So habe es Ende 1993 in den Aufsichtsräten der 100 größten deutschen Unternehmen insgesamt 1561 Aufsichtsratsmandate gegeben. Davon hätten Vertreter der privaten Banken lediglich 99 Mandate wahrgenommen, was einem Anteil von gerade mal 6,3 Prozent entspräche. Auch hier sei die Tendenz rückläufig; schließlich hatten die Banken 1988 noch 104 Vertreter in die Auf sichtsräte der 100 größten deutschen Unternehmen entsandt. Dagegen hätten Ende 1993 externe Arbeitnehmervertreter, also Aufsichtsratsmitglieder, die von den Gewerkschaften in die Unternehmen entsandt werden, 211 Mandate inne gehabt. Angesichts dieser Zahlen sei die Einschätzung von bankendominierten Aufsichtsräten unhaltbar. Zudem würden die Banken in der Regel von den Unternehmen gedrängt, ihre Vertreter in die Kontrollgremien von Unternehmen zu entsenden. Dieser Wunsch sei Ausdruck des Vertrauens der Unternehmen in Sachverstand und Kompetenz der Bankenvertreter in den Aufsichtsgremien.
Innerhalb des Netzwerks von Multi-Aufsichtsräten kann nach Einschätzung von Aktionärsvertretern überhaupt keine Kontrolle mehr stattfinden, da die Aufsichtsräte sonst schon bei 5 bis 10 Mandaten hoffnungslos überlastet wären. Nach geltendem Recht kann eine Person maximal 10 konzernfremde Aufsichtsratsmandate sowie
[Seite der Druckausgabe: 38]
eine beliebige Zahl von konzerninternen Aufsichtsratsmandaten bei Toch terunternehmen innehaben. Üblicherweise treffen die Aufsichtsräte deutscher Gesellschaft viermal im Jahr zu ordentlichen Sitzungen zusammen. Zusammen mit der kontinuierlichen Arbeit summiert sich damit der durchschnittliche Zeitaufwand für die Wahrnehmung eines Aufsichtsratsmandats auf 4 bis 6 Tage pro Jahr. Bei 10 Mandaten beträgt der Zeitaufwand für die Wahrnehmung dieser Mandate also rund 50 Tage. Neben der Wahrnehmung von Vorstandsaufgaben im eigenen Unternehmen sei dies zu viel, betonen Kritiker.
Ein Wissenschaftler und Aktionärsvertreter verweist darauf, daß dieses Argument neuerdings sogar in einem Gutachten, das die unzureichende Aufsichtsratsarbeit in den Tochtergesellschaften der Metallgesellschaft untersuchen soll, zur Exkulpation von Fehlleistungen bemüht wird. In diesem Gutachten eines Frankfurter Juristen werden bestimmte Vorstandsmitglieder der Metallgesellschaft von jeder Verantwortung für die Schieflagen von US-Konzerntöchtern freigesprochen, in deren Aufsichtsräten beziehungsweise Boards sie vertreten waren. Wörtlich heißt es in dem Gutachten: "Der Vorstand der Metallgesellschaft hatte die Konzernführung in bezug auf hunderprozentige Auslandstöchter divisional organisiert. Hiernach diente die Betrauung ressortfremder Vorstandsmitglieder mit der Wahrnehmung von Board-Mandaten allein dem Zweck, das Board in der vorgeschriebenen Weise zu besetzen, nicht aber der Etablierung einer Kontrollebene. Diese Art und Weise der Konzernführung. die den Board in hundertprozentigen Tochtergesell schaften auf die Wahrnehmung der nach dem Gesetz unabdingbaren Funktionen beschränkte, machte es den Vorstandsmitgliedern überhaupt erst zumutbar, in die Boards ressortfremder Tochterunternehmen einzutreten. So war Herr Dr. Binder als Vorstandsvorsitzender der Kolbenschmidt AG in den Jahren 1992/93 praktisch schon mit der Aufgabe ausgelastet, diese Gesellschaft zu sanieren."
Das Gutachten kommt damit zu dem Resultat, daß ein amtierendes Vorstandsmitglied bereits mit seiner Vorstandstätigkeit so überlastet ist, daß ihm die Wahrnehmung konzerninterner Aufsichtsratsmandate überhaupt nur dann zumutbar ist, wenn er in diesem Aufsichtsrat von Kontrollaufgaben befreit ist. Klarer kann man den Reformbedarf im deutschen Aufsichtsratssystem kaum formulieren. Dieser Bedarf wird auch von einem Vertreter eines Industrieverbandes gesehen. Dabei sei es jedoch entscheidend, das deutsche Aufsichtsrecht qualitativ weiter zu entwickeln, indem die positiven Faktoren des deutschen Systems aus gebaut würden. Schließlich würden Vergleiche mit anderen Rechtssystemen deutlich belegen, daß das deutsche Aufsichtsratssystem mit der klaren Trennung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ein vergleichsweise gutes und effektives System von "corporate government" sei. Zur Verbesserung des Systems bedarf es jedoch nach Einschätzung eines SPD-Politikers zunächst einmal der Beseitigung bestehender Mißstände. Zu diesen Maßnahmen gehöre auch die Beschränkung der pro Person maximal zulässigen Zahl von Mandaten. Deshalb habe die SPD-Bundestagsfraktion im Rahmen ihres Gesetzentwurfs eine Beschränkung der pro Person möglichen Mandate auf 5 vorgesehen, wobei der Aufsichtsratsvorsitz we-
[Seite der Druckausgabe: 39]
gen der großen Bedeutung dieses Postens und dem erheblichen Arbeitsaufwand doppelt gezählt werden soll. Zudem soll die bestehende Ausnahmeregelung für Tochterunternehmen gestrichen werden, da es in Hinsicht auf die gewünschte qualifizierte Aufsichtstätigkeit unerheblich sei, ob es sich um ein konzernfremdes oder konzerneigenes Unternehmen handle. Die Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten in konkurrierenden Unternehmen soll generell untersagt werden. Durch die Übernahme von Aufsichtsratsmandanten in Unternehmen, die miteinan der in einem direkten oder indirekten Wettbewerb ständen, würden die im Aktienrecht vorgesehenen Kontrollfunktionen des Aufsichtsgremiums ad absurdum geführt. Die Feststellung einer Konkurrenzsituation und die Untersagung der Wahrnehmung von Mandaten in konkurrierenden Unternehmen wird dabei dem Kartellamt übertragen. Das Kartellamt könne bei ihrer konkreten Entscheidung den jeweiligen Gegebenheiten oder branchenspezifischen Besonderheiten gerecht werden.
Darüber hinaus sieht der SPD-Gesetzentwurf eine Verschärfung der Haftung und Maßnahmen zur Steigerung der Qualität der Aufsichtsratsarbeit vor. Dazu gehört unter anderem die Vorschrift, daß die Vorlagen für die Bilanzsitzung - Jahresabschluß, Lagebericht und Abschlußprüfungsbericht - zukünftig jedem Aufsichtsratsmitglied zwingend zur Verfügung gestellt werden müssen. Die bisherige Regelung sieht lediglich vor, daß die Aufsichtsratsmitglieder diese Vorlagen in den Räumen der Gesellschaft einsehen dürfen. Außerdem soll der Wirtschaftsprüfer zukünftig zwingend an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates teilnehmen. Mit diesen Gesetzesänderungen würden Regeln, die in gut geführten Aufsichtsräten ohnehin praktiziert würden, nun auch den weniger gut geführten Gremien vorgeschrieben. Schließlich soll die Haftung für Aufsichtsratsmitglieder verschärft werden. Mit diesen Maßnahmen soll die Funktionsfähigkeit des deutschen Aufsichtsratssystems verbessert werden, und die Tendenz zur Schaffung eines Netzes von Multi-Aufsichtsräten, die statt der Kontrolle lediglich der Abschirmung vor echter Kontrolle dienten, unterbunden werden.
6.4 Kapitalanlagegesellschaften
Neben diesen "klassischen" Bausteinen der "Macht der Banken" wird neuerdings auch zunehmend die Tätigkeit der deutschen Kapitalanlagegesellschaften kritisch kommentiert. Im Gegensatz zu anderen Rechtssystemen ist es in Deutschland den Banken und den Versicherungen erlaubt, Anteile an Kapitalanlagegesellschaften in beliebiger Höhe zu halten. Dies führt in der Praxis dazu, daß der in Deutschland boomende Markt für Investmentfonds hauptsächlich von den bank- oder versicherungseigenen Gesellschaften dominiert wird.
Kapitalanlagegesellschaften sind Unternehmen, deren Geschäftszweck die Verwaltung von Investmentfonds ist. Das bei ihnen von Kunden angelegte Kapital le-
[Seite der Druckausgabe: 40]
gen sie in verschiedenen Fonds im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in Wertpapieren oder Grundstücken gesondert vom eigenen Vermögen der Gesellschaft an. Die Palette der angebotenen Fonds reicht dabei von den klassischen Aktien- und Rentenfonds bis zu den seit 1994 auch in Deutschland zugelassenen Geldmarktfonds oder den offenen Immobilienfonds. Durch den Wandel des Anlageverhaltens des deutschen Sparers sind Investmentfonds in den letzten Jahren zu einem großen Wachstumsmarkt avanciert. 1994 vertrauten deutsche Sparer den offenen Investmentfonds deutscher Kapitalanlagegesellschaften einen Betrag von rund 62,5 Milliarden DM an. Das verwaltete Fondsvermögen stieg damit auf einen Betrag von gut 225 Milliarden DM. Neben diesen offenen Fonds oder Publikumsfonds verwalten die Kapitalanlagegesellschaften sogenannte Spezialfonds. Dies sind im Sinne des zum l. März 1990 in Kraft getretenen Ersten Finanzmarktförderungsgesetzes Sonderfonds, die auf maximal 10 Anleger beschränkt sind. Da die Sonderfonds ausdrücklich auf "nicht natürliche Personen" beschränkt sind, wird diese Anlageform hauptsächlich von Banken, Versicherungen, Unternehmen, Vereinen, Pensions- und Unterstützungskassen, Stiftungen und kirchlichen oder caritativen Einrichtungen genutzt. Laut Bundesbankstatistik gab es Ende 1994 2.498 Spezialfonds mit einem Gesamtvermögen von 257 Milliarden DM.
Die führenden deutschen Investmentgesellschaften sind überwiegend hundertprozentige Tochterunternehmen der großen deutschen Banken. So ist die größte deutsche Investmentgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen (DWS) eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bank. 1994 verwaltete die DWS ein Fonds vermögen von rund 48 Milliarden DM. Zweitgrößte deutsche Kapitalanlagegesellschaft ist der Deutsche Investment Trust (DIT), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Dresdner Bank, der 1994 ein Fondsvermögen von 26,2 Milliarden DM verwaltete, gefolgt von der DEKA, einer Tochter der öffentlich-rechtlichen Landeszentralbanken mit einem Fondsvolumen von fast 21 Milliarden DM, der Allgemeinen Deutschen Investment Gesellschaft ADIG, die zu jeweils 39 Prozent der Commerzbank und der Bayerischen Vereinsbank gehört, sowie der Union-Investment-Gesellschaft der DG-Bank.
Ein Wissenschaftler kritisiert die Gefahr von Interessenkonflikten, die sich aus der engen Verbindung von der als Universalbank tätigen Mutter und der Kapitalanlagegesellschaft ergeben. Derartige Interessenkonflikte beginnen bei der Beratung der Kunden, die oftmals von den Anlageberatern der Banken nachdrücklich in die Investmentfonds der Tochtergesellschaft gedrängt werden, ohne über mögliche Alternativen anderer Gesellschaften oder andere Anlageformen informiert zu werden. Als besonders problematisch wird zudem die Möglichkeit eingeschätzt, mittels der Tochtergesellschaft die Regelung des
§ 135 AktG zu umgehen, der es den Depotbanken untersagt, in ihren eigenen Hauptversammlungen mit den Stimmen ihrer Depotkunden über sich selbst abzustimmen. Denn nach geltendem Recht können Kapitalanlagegesellschaften selbst als hundertprozentige Töchter einer Bank in der Hauptversammlungen der Muttergesellschaft mitstimmen. Dabei
[Seite der Druckausgabe: 41]
muß befürchtet werden, daß die Fondsverwalter ganz überwiegend im Sinne der Mutterbank abstimmen, ohne daß eventuell abweichende Interessen der Anleger angemessen berücksichtigt werden.
Darüber hinaus wird davon ausgegangen, daß die Ausgestaltung des Fondsportfolios an den Interessen der Muttergesellschaft orientiert ist. So kann beispielsweise die bankeigene Kapitalanlagegesellschaft durch den Erwerb eines bestimmten Aktienanteils einer Aktiengesellschaft das gemeinsame Stimmrechtspotential in der Hauptversammlung dieser Gesellschaft so erhöhen, daß bestimmte Stimmrechtsanteile erreicht werden, ohne daß die Mutterbank dabei bestehende Meldegrenzen überschreitet. Außerdem wird geargwöhnt, daß Kapitalanlagegesellschaf ten zur Unterstützung von Aktienemissionen der Mutterbank Aktien dieses Unternehmens kaufen. Dabei muß davon ausgegangen werden, daß dies auch dann der Fall ist, wenn die Fondsverwaltung diese Aktien nach sachlicher Prüfung als wenig rentabel einstuft. Ein Wissenschaftler unterstreicht diese Einschätzung anhand Daten einer empirischen Untersuchung der Universität Osnabrück, die die Aktivitäten der bankeigenen Kapitalanlagegesellschaften bei Emissionsführerschaft der Mutterbank illustrieren (Abbildungen 2 und 3):
In beiden Statistiken wird offensichtlich, daß sich jeweils die bankeigenen Kapitalanlagegesellschaften in den Fällen überproportional an einer Aktienemission beteiligen, in denen die Mutterbank Emissionsführer ist. Ein Wissenschaftler verweist darauf, daß derartige Tendenzen auch bei allen anderen Großbanken oder der öffentlich-rechtlichen Westdeutschen Landesbank zu beobachten sind. Die auffallende Übereinstimmung zwischen der Emissionsführerschaft der Mutterbank und dem Anlageverhalten der Kapitalanlagegesellschaft könne dabei nur zwei Erklärungen haben. Entweder würde hier Insiderwissen mißbraucht, was in Deutschland seit Inkrafttreten des Zweiten Finanzmarktförderungsgesetzes strafbar ist, oder die Kapitalanlagegesellschaften würden aufgrund einer Interessenidentität zwischen Mutterbank und Tochtergesellschaft aktiv. Beide Interpretati onsmöglichkeiten seien ordnungspolitisch problematisch. Insofern stellt sich nach Einschätzung von Wissenschaftlern und Politikern auch hier die Frage nach notwendigen gesetzlichen Änderungen, die die Unabhängigkeit der Kapitalanlagegesellschaften gegenüber den Universalbanken sicherstellen. Der von der SPD-Bundestagsfraktion vorgelegte Entwurf eines Transparenz- und Wettbewerbsgesetzes sieht deshalb eine klare Trennung zwischen den Kapitalanlagegesellschaften und den Banken vor. Hierfür müßten sich Banken und Versicherungen von ihren Kapitalanlagegesellschaften trennen, die zukünftig nur noch als unabhängige Gesellschaften tätig werden dürften.
[Seite der Druckausgabe: 42]
Abbildung 2: Neuemissionen und Anteilserwerb durch Kapitalanlagegesellschaften 1991/1992. Konsortialführer Deutsche Bank
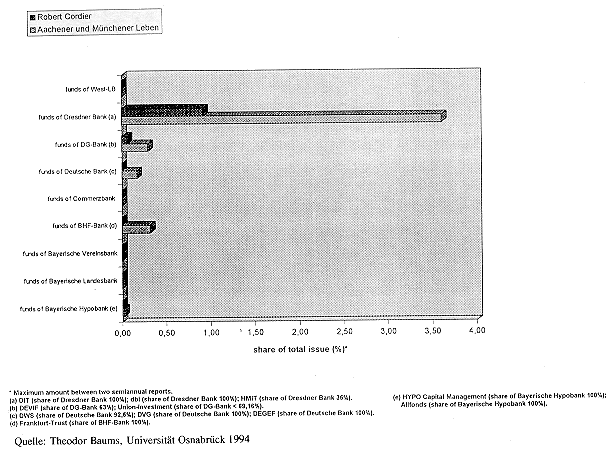
[Seite der Druckausgabe: 43]
Abbildung 3: Neuemissionen und Anteilserwerb durch Kapitalanlagegesellschaften 1991/1992. Konsortialführer Dresdner Bank
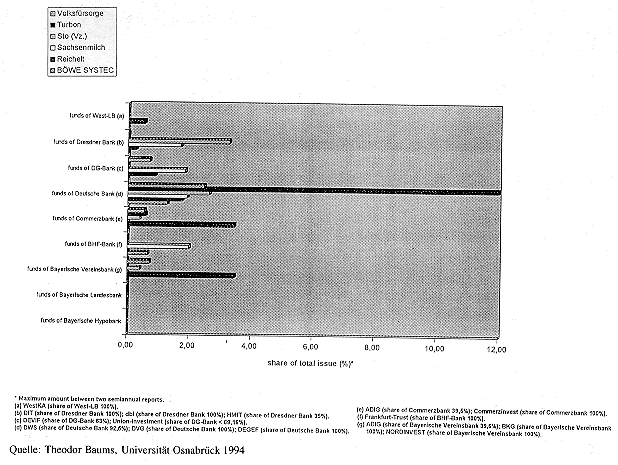
[Seite der Druckausgabe: 44]
Nach Auffassung eines Vertreters des Bundeswirtschaftsministeriums wäre mit der Einführung einer solchen Regelung die Abwanderung der deutschen Kapitalanlagegesellschaften ins Ausland praktisch vorprogrammiert. Denn der deutsche Gesetzgeber könne eine solche Regelung nicht für andere EU-Länder vorschreiben. Außerdem bestehe die Gefahr, daß das Verbot, sich an Kapitalanlagegesellschaften zu beteiligen, für deutsche Banken zu einer wettbewerblichen Diskrimi nierung gegenüber den Banken mit Sitz in anderen EU-Mitgliedsstaaten führe. Aus diesem Grunde lehne das Bundeswirtschaftsministerium eine solche Verbotsregelung ab. Ein Wissenschaftler sieht in der Einführung effizienter "Chinese walls" innerhalb der Kapitalanlagegesellschaften eine Alternative zu der Verbotslösung. Dafür wäre jedoch die Schaffung einer umfangreichen Regulierungsbehörde nach amerikanischem Vorbild notwendig.