

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
-
1. Die neoklassische Perspektive
- 1.1 Die Substitutionsthese
- 1.2 Lohnsenkung im neoklassischen Modell
- 1.3 Lohnsenkung im gesamtwirtschaftlich interpretierten neoklassischen Modell
- 1.4 Implikationen der Substitutionsthese
- 1.5 Die Substitutionsthese: Ein Zyklenvergleich
- 1.6 Die Substitutionsthese: Ein internationaler Vergleich
- 1.7 Die Gewinnthese
- 1.8 Lohnquote und realer Wechselkurs: Die lange Frist
[Seite der Druckausgabe: 2 = Inhaltsverzeichnis]
[Seite der Druckausgabe: 3,4 = Abbildungsverzeichnis]
1. Die neoklassische Perspektive
Arbeitslosigkeit, also ein Überschußangebot auf dem Arbeitsmarkt, wird von neoklassisch argumentierenden Ökonomen als Indiz für einen „zu hohen" Reallohn und damit eine „zu geringe" Flexibilität am Arbeitsmarkt angesehen. Begründet wird dies damit, daß auf jedem Markt Angebot und Nachfrage durch den Preis des gehandelten Gutes zum Ausgleich gebracht werden können. Bei hinreichender Flexibilität geschieht dies ohne erhebliche Verzögerungen, d.h. auf ein Überschußangebot wird zügig mit Preissenkung, auf eine Überschußnachfrage mit Preissteigerung reagiert. Sind über längere Zeiträume Ungleichgewichte, womöglich sogar sich verschärfende Ungleichgewichte zu beobachten, ist die Flexibilität des Preises offenbar zu gering bzw. nimmt ab.
So einleuchtend diese Überlegung für einen einzelnen Markt, ist, so problematisch ist ihre Übertragung auf gesamtwirtschaftliche Vorgänge. Denn um die Übertragung eines mikroökonomischen Modells auf die makroökonomische Ebene handelt es sich, wenn gesamtwirtschaftlich beobachtbare Arbeitslosigkeit auf Inflexibilität des Arbeitsmarktes bzw. einen generell zu hohen Reallohn zurückgeführt wird. Entsprechend problematisch sind die auf dieser Logik fußenden Empfehlungen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die im Kern auf Reallohnsenkung hinauslaufen. Sie basieren im wesentlichen auf zwei - sich bei näherem Hinsehen eigentlich ausschließenden - Gedankengängen, die im folgenden als Substitutions- und als Gewinnthese bezeichnet werden.
1.1 Die Substitutionsthese
Mit hoher und sogar mit steigender Arbeitslosigkeit ist nicht notwendigerweise eine niedrige oder dauerhaft sinkende Produktion verbunden. Zwischen 1960 und heute etwa ist das Bruttosozialprodukt sehr kräftig und fast ununterbrochen gestiegen, obwohl sich die Zahl der Arbeitslosen vervielfacht hat. Möglich ist offenbar eine gleichbleibende oder sogar steigende Güterproduktion bei geringerem Einsatz des Faktors Arbeit durch vermehrten Einsatz des Faktors Kapital. Steht pro Arbeitsplatz mehr Kapital zur Verfügung, d.h. steigt die Kapitalintensität, nimmt die Arbeitsproduktivität zu. Formal bedeutet dies: Wächst die Produktion und damit das Einkommen mit der gleichen Rate wie die Arbeitsproduktivität, bleibt die eingesetzte Menge an Arbeit konstant; nimmt die Produktion langsamer zu als die Arbeitsproduktivität, sinkt die Beschäftigung; steigt sie schneller, wird die Beschäftigung ausgeweitet.
[Seite der Druckausgabe: 6]
Aus neoklassischer Perspektive ergibt sich die Arbeitsproduktivität endogen aus dem am Ar-beits- und Kapitalmarkt bestimmten Faktorpreisen bzw. deren Verhältnis zueinander, dem Lohn-Zins-Verhältnis [Fn.1: Reallohn-Realzins-Verhältnis oder Nominallohn-Nominalzins-Verhältnis - die Preisbereinigung erübrigt sich in dieser Relation.] Machen die Unternehmer dauernd die Erfahrung, daß das Lohn-Zins-Verhältnis steigt, ist für sie dauernd eine Substitution des Faktors Arbeit durch Kapital lohnend. Ausgehend von einer Vollbeschäftigungssituation ist dies unproblematisch, sofern die Produktion mit der gleichen Rate wächst wie die Arbeitsproduktivität bzw. wie das Lohn-Zins-Verhältnis. Denn dann steht der Faktorsubstitution ein Einkommenseffekt gegenüber, d.h. die gleiche Menge Arbeit (und eine größere Menge Kapital) wird benötigt zur Herstellung einer größeren Gütermenge. Es kommt also nicht zu Entlassungen. Wächst das Lohn-Zins-Verhältnis jedoch rascher als die Produktion, wird schneller substituiert, und es entsteht Arbeitslosigkeit. Diese kann nur abgebaut werden, wenn der Substitutionsprozeß wieder verlangsamt wird, d.h. das Lohn-Zins-Verhältnis langsamer als die Produktion steigt. Die Möglichkeit, die Beschäftigung durch höheres Produktionswachstum auszudehnen, besteht kaum oder allenfalls nur sehr langfristig, weil das Produktionswachstum vom technischen Fortschritt abhängt. Dieser kann bestenfalls langfristig durch geeignete ordnungspolitische Rahmenbedingungen unterstützt, nicht jedoch kurz- bis mittelfristig beeinflußt werden.
Die wirtschafts-, insbesondere aber tarifpolitische Empfehlung zur Verringerung einer einmal - und in der Regel durch „überschießende" Löhne - entstandenen Arbeitslosigkeit lautet vor dem Hintergrund der Substitutionsthese also, die Entwicklung der Arbeitsproduktivität durch Nominallohnabschlüsse zu dämpfen, die solange unterhalb der Entwicklung der vergangenen, mit Arbeitslosigkeit einhergehenden Arbeitsproduktivität plus Zielinflationsrate liegen, bis wieder Vollbeschäftigung erreicht ist.
Eine solche Strategie zeige möglicherweise, so wird eingeräumt, keine kurzfristigen Erfolge, da erst das Vertrauen der Unternehmer auf die Dauerhaftigkeit einer solchen Lohnpolitik gewonnen werden müsse, bevor sie das Substitutionstempo tatsächlich drosselten. Käme es jedoch über Jahre hinweg zu lohnpolitischer Zurückhaltung, könnten die Erfolge am Arbeitsmarkt nicht ausbleiben.
Grundlegend für diese Überlegung ist ein Modell mit neoklassischer Produktionsfunktion, anhand dessen man das optimale Faktoreinsatzverhältnis bestimmen kann. Verändert man in diesem Modell exogen das vorgegebene Faktorpreisverhältnis, errechnet sich auch ein anderes optimales Faktoreinsatzverhältnis. Das Faktorpreisverhältnis ist exogen, den es aus der Sicht
[Seite der Druckausgabe: 7]
eines einzelnen Unternehmers bei vollständigem Wettbewerb nicht verändert werden kann. Übertragen auf die Gesamtwirtschaft wird der Schluß gezogen, daß bei Arbeitslosigkeit durch die Senkung des Reallohns und damit des Lohn-Zins-Verhältnisses ein Substitutionsprozeß weg vom Kapital hin zu mehr Arbeit ausgelöst und dadurch die Beschäftigung gesteigert werden könne.
Herrscht vollkommener Wettbewerb, führt das Gewinnmaximierungsverhalten der Unternehmen dazu, daß die Produktionsfaktoren mit ihrem Grenzprodukt entlohnt werden; d.h. der reale Stundenlohn entspricht der Grenzproduktivität der Arbeitsstunde, und der Realzinssatz entspricht der Grenzproduktivität des Kapitals. Die Annahme abnehmender Grenzproduktivität der Faktoren, wie sie der neoklassischen Produktionsfunktion zugrundeliegt, führt logischerweise dazu, daß bei gleichbleibender Produktionsmenge von dem Faktor mehr eingesetzt wird, der relativ billiger wird, und von dem anderen Faktor entsprechend weniger. Unterbeschäftigung in Form unfreiwilliger Arbeitslosigkeit gibt es nicht, da nur derjenige keine Arbeitsstelle findet, der nicht bereit ist, zu einem Lohn zu arbeiten, der seiner Grenzproduktivität entspricht. [Fn.2: Von friktioneller und auf Qualifikationsdiskrepanzen zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage beruhender Arbeitslosigkeit, die Vertreter der neoklassischen Theorie nicht bestreiten, wird an dieser Stelle abgesehen, da der größte Teil der derzeitigen Arbeitslosigkeit nach neoklassischer Auffassung andere Ursachen hat.]
Tatsächlich bestehende Arbeitslosigkeit kann vor diesem Modellhintergrund nur damit 'erklärt' werden, daß kein vollkommener Wettbewerb herrscht, sondern z.B. aufgrund der Verhandlungsmacht der Gewerkschaften ein im Vergleich zur Grenzproduktivität der Arbeit (genauer: des letzten Arbeitswilligen) zu hoher Reallohn vereinbart worden ist. Wird er gesenkt, ändert sich das Faktorpreisverhältnis zugunsten des Faktors Arbeit und zu Lasten des Faktors Kapital, was - entsprechende Anpassungszeiträume unterstellt - zu einer vergleichsweise arbeitsintensiveren Produktionsweise führt, als es sonst der Fall ist. Daraufhin steigt die Beschäftigung.
Wie dieser Anpassungsprozeß gesamtwirtschaftlich vonstatten gehen soll, darüber gibt das mikroökonomisch angelegte, stationäre Modell keine Auskunft. Das neoklassische Wachstumsmodell wiederum kann nicht als Ersatz für die hier fehlende Dynamik herangezogen werden, da es von Gleichgewichtszuständen ausgeht, also gerade eine Situation der Unterbeschäftigung nicht vorsieht. Es anzuwenden ist allenfalls sinnvoll, wenn das Beschäftigungsproblem nicht Gegenstand der Analyse oder gelöst ist. Bis dahin muß jeder, der aus dem stationären neoklassischen Modell wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen ableitet, erklä-
[Seite der Druckausgabe: 8]
ren, wie der Übergang von Unter- zu Vollbeschäftigung durch die Veränderung des Faktor-preisverhältnisses auf makroökonomischer Ebene ablaufen soll.
Bei einer dynamischen, gesamtwirtschaftlichen Interpretation des neoklassischen Modells treten drei zentrale Problemfelder auf: Erstens, es gibt kein Investitionsmotiv für die Unternehmer, da über die Verzinsung des Kapitaleinkommens hinaus keine 'echten' Gewinne (also temporäre Monopolgewinne im Sinne eines Schumpeterschen Unternehmers) anfallen. Optimale Anpassung führt gerade zu Nullgewinnen. Innovatives Verhalten lohnt sich nicht, da jeder technische Vorsprung annahmegemäß sofort wegkonkurriert wird, indem alle Unternehmer augenblicklich dieselbe neue Technologie anwenden. Umgekehrt bleibt aber auch niemand hinter technischen Innovationen zurück, da der Unternehmer, der sich so verhielte, sofort teurer anbieten müßte als seine Konkurrenten und somit aus dem Markt ausschiede. So wie die neoklassische Wachstumstheorie Wachstumsrate und technischen Fortschritt als Setzung verwendet, ist im stationären neoklassischen Modell der Übergang von einer Isoquante zur nächsthöheren, also die Steigerung der Produktion, nicht Erklärungsgegenstand.
Zweitens, zwar ist aus einzelwirtschaftlicher Sicht bei Wettbewerb auf den Gütermärkten der Absatzpreis für die Unternehmen eine vorgegebene Größe, aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive gibt es für diese Annahme aber keine stichhaltige Begründung. Wenn in der Gesamtwirtschaft die Kosten der Unternehmen sinken, etwa weil die Lohnstückkosten sinken, spricht auch oder sogar gerade in einer neoklassischen Welt alles dafür, daß im Wettbewerb die Unternehmen gezwungen werden, die Kostenentlastung in den Preisen weiterzugeben, da sie ansonsten ungerechtfertigte „windfall profits" machten. D.h. die Endogenität des Preisniveaus in einem gesamtwirtschaftlichen Modell ist, denkt man die neoklassische Null-Gewinn-Annahme bzw. die Annahme vollkommener Konkurrenz zu Ende, essentiell. Damit ist aber die für die neoklassische Erklärung der Arbeitslosigkeit zentrale Größe, der Reallohn, keine exogene Setzung der Arbeitsmarktparteien mehr.
Es gibt aber einen noch weitergehenden fundamentalen Einwand hinsichtlich der Verwendung eines „Reallohnes" in der ökonomischen Analyse. Der „Reallohn" setzt sich zusammen, aus dem im Zähler stehenden eigentlichen Preis für Arbeit, dem Nominallohn, und den Preisen der einzelnen Güter des Warenkorbes, die im Nenner stehen. Wer also z.B. über „Reallohnflexibilität" spricht, spricht von einer unterschiedlichen Flexibilität des Nominallohnes im Vergleich zu der Flexibilität der Güterpreise, die im Nenner stehen, der Preise der „wage goods" also, wie Keynes sie nannte. Diese unterschiedliche Flexibilität bedeutet nichts anderes als eine unterschiedlich stark geneigte (elastische) Angebotskurve für Arbeit auf der einen Seite und für wage goods auf der anderen.
[Seite der Druckausgabe: 9]
Kommt es zu nachfrageseitigen (monetären) Schocks, die, was als empirischer Befund auch unter Neoklassikern unbestritten ist [Fn.3: Vgl. etwa Lucas/Rapping (1969), Blanchard (1987) und Piketty (1997).] , einen Einfluß auf die Beschäftigungsmenge und nicht nur auf den Preis (den Reallohn) haben, muß man als Neoklassiker schwer nachvollziehbare Annahmen hinsichtlich der Elastizität des Angebots von Arbeit und von wage goods machen. Ein Rückgang der Beschäftigung kann nämlich im Falle eines restriktiven monetären Schocks - neoklassisch - nur verhindert werden, wenn der Reallohn nach unten flexibel ist. Das aber bedeutet, daß die Angebots-Elastizität von Arbeit größer ist als die von wage goods, denn nur dann sinkt der Reallohn; der Nominallohn sinkt stärker als die Preise der wage goods.
Warum aber sollten die Anbieter von Arbeit eine ganz anders geneigte Angebotsfunktion haben als die Anbieter anderer Güter und Dienstleistungen? Arbeit ist schließlich keineswegs ein homogenes Gut, sondern besteht aus einer Vielzahl extrem unterschiedlicher Dienstleistungen, die alle im walrasianischen Markt als „Gut" angeboten werden. Der Reallohn ist folglich von vornherein ein fragwürdiges Konstrukt, weil er nicht einen wirklichen Marktpreis darstellt, sondern die Relation zwischen einer großen Zahl von Marktpreisen für Arbeit und einer nicht minder großen Zahl von Marktpreisen für wage goods. Die neoklassische Erwartung, die Veränderung dieses Konstrukts brächte eindeutige Signale für die Unternehmen zur Veränderung des Faktoreinsatzverhältnisses mit sich, ist schon a priori nicht gerechtfertigt. Die Aggregationsleistung, die damit impliziert ist, kann kein Unternehmen auf dem walrasianischen Markt erbringen. Insofern fehlt der Neoklassik hier eindeutig eine mikroökonomische Fundierung
1.2 Lohnsenkung im neoklassischen Modell
Wie hat man sich den Wirkungsmechanismus einer Lohnsenkung im Rahmen des neoklassischen Modells, also insbesondere bei Vorliegen einer neoklassischen Produktionsfunktion, vorzustellen? Ausgangspunkt der Analyse sei Punkt A in Abbildung l, in dem ein bestimmtes Lohn-Zins-Verhältnis WA / iA bzw. Reallohn-Realzins-Verhältnis (WA / PA) / (iA / PA) und Arbeitslosigkeit herrsche.
[Seite der Druckausgabe: 10]
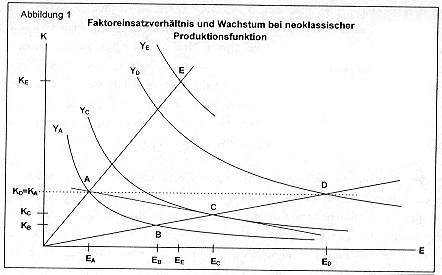
Der Realzins ist die durchschnittliche interne Verzinsung des eingesetzten Kapitals (K) [Fn.4: Das Kapital K soll hier in physischen Mengeneinheiten gemessen werden, was der Behandlung des Faktors Arbeit E entspricht, der in Arbeitsstunden gemessen wird.] , die sich aus den realen Gewinnen [Fn.5: Im folgenden wird der Begriff 'Gewinne' für Kapitaleinkommen verwendet, obwohl es Gewinne im engeren Sinne, also über die reine (Fremd-) Kapitalverzinsung hinausgehende, im neoklassischen Modell nicht gibt.] dividiert durch K berechnen läßt. [Fn.6: Von Realzins wird hier also nicht im Sinne eines um die Inflationsrate bereinigten Zinses gesprochen. Vielmehr soll lediglich ausgedrückt werden, daß nominale Gewinne preisbereinigt werden und dann auf die physischen Mengeneinheiten des Kapitalstocks bezogen werden. Dieser Zins ist mit den auf Geld- und Kapitalmarkt herrschenden 'nominalen' Zinssätzen direkt vergleichbar.] Unter Annahme vollständiger Konkurrenz ist er gleich der technologisch bedingten Grenzproduktivität des Kapitals. Die nominalen Gewinne lassen sich als residuale Größe aus nominaler Produktion und Lohnsumme (dem Produkt aus Nominallohn W und Beschäftigung E) berechnen: P * Y - (W * E), so daß der Realzins in Punkt A also folgender Gleichung genügt:
iA / PA = (YA * PA - WA * EA) / (KA* PA )
Der exogene Schock, der eine Bewegung zunächst vom Punkt A zum Punkt B auslöst, soll von einer Lohnsenkung, und zwar einer Nominallohnsenkung (WB < WA) ausgehen. Die No-
[Seite der Druckausgabe: 11]
minal- anstelle einer Reallohnsenkung ist insofern der einzig sachgerechte Ausgangspunkt der Überlegung, als die Tarifvertragsparteien nur über den Nominallohn verhandeln, nicht aber über das Preisniveau, so daß nur der Nominallohn exogen gesetzt werden kann. In der ersten (gedanklichen) Stufe des Anpassungsprozesses, in der die Preise z.B. wegen gewisser Rigiditäten noch nicht reagieren, sinkt der Reallohn im Ausmaß der Nominallohnkürzung. Das Lohn-Zins-Verhältnis geht zurück. Das neue Optimum der gewinnmaximierenden Unternehmer liegt bei Annahme des gleichen Outputs (YB = YA) in Punkt B, es wird mehr vom Faktor Arbeit eingesetzt (EB > EA) und weniger vom Faktor Kapital (KB < KA). d.h. die Kapitalintensität (K/E) und die Arbeitsproduktivität (Y/E) sind gesunken. Die Gewinne sind gestiegen oder zumindest konstant geblieben, wenn die neue Lohnsumme die alte nicht übersteigt. Die nominale und wegen der noch konstanten Preise auch die reale Verzinsung des eingesetzten Kapitals KB ist unter der Voraussetzung einer konstanten oder gesunkenen Lohnsumme gestiegen, weil der gleiche oder sogar ein höherer Gewinn auf eine verringerte Kapitalmenge entfällt. [Fn.7: Sogar bei geringeren Gewinnen, also gestiegener Lohnsumme, kann die Verzinsung des eingesetzten Kapitals zugenommen haben, wenn nämlich der Rückgang des Kapitals relativ stärker ist als die Zunahme der Lohnsumme.]
Kann aber Punkt B ein 'sinnvoller' Endpunkt des Anpassungsprozesses sein? Ist es effizient, die gleiche Produktionsmenge herzustellen, indem man vorhandenes Kapital durch Arbeit substituiert, nur um den Faktor Arbeit besser auszulasten? Das hieße nichts anderes, als zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit die Einführung von Webstühlen und die Abschaffung von Textilmaschinen zu befürworten. Oder in Wachstumsraten ausgedrückt: für eine Verlangsamung des technischen Fortschritts in Form sinkender Arbeitsproduktivität zu plädieren. Aus der Sicht des homo oeconomicus ist aber Freizeit ein Gut und Arbeit entsprechend eine Last. Nutzen zieht ein Wirtschaftssubjekt einerseits aus den Konsumgütern, die es sich mittels seines (Arbeits-)Einkommens beschaffen kann, und andererseits aus seiner Freizeit. Es strebt eine optimale Mischung des Nutzens aus Konsum von Konsumgütern und des Nutzens aus „Konsum" von Freizeit an. Dieses Optimum kann für jedes Wirtschaftssubjekt anders ausfallen, je nach Art seiner Präferenzen und seiner Leistungsfähigkeit, Arbeitseinkommen zu erzielen, d.h. seiner Humankapitalausstattung. Das Problem der Arbeitslosigkeit besteht hauptsächlich darin, daß die arbeitslosen Wirtschaftssubjekte in der Regel zu mehr Freizeitkonsum und weniger Verbrauch von Konsumgütern gezwungen sind, als es ihrem jeweiligen individuellen Optimum entspricht.
[Seite der Druckausgabe: 12]
Punkt B stellt also unter dem Gesichtspunkt, daß Freizeit ein Gut ist, eine Verschlechterung der Situation gegenüber Punkt A dar. Will man zu anderen Endpunkten einer Anpassungslösung gelangen, muß man die Annahme, die Produktion bliebe konstant, fallen lassen. Damit begibt man sich in die oben bereits angedeutete Problematik, das stationäre neoklassische Modell dynamisch interpretieren zu müssen, obwohl es selbst keine Erklärung für Veränderungen der Produktionsmenge, d.h. technisch gesprochen der Bewegung von einer Isoquante zur anderen, liefert.
1.3 Lohnsenkung im gesamtwirtschaftlich interpretierten neoklassischen Modell
Gibt es einen Grund für die bisherige getroffene Annahme, daß die Produktion konstant bleibt? Wurde vor der Nominallohnsenkung Punkt A realisiert, könnte das geänderte Lohn-Zins-Verhältnis ja auch eine Drehung der durch A bislang tangential zur Isoquante YA verlaufenden Gerade bedeuten [Fn.8: Diese ursprüngliche Tangente ist in der Abbildung nicht eingezeichnet, statt dessen aber die neue Tangente an Y C .] , bis deren Steigung dem neuen Faktorpreisverhältnis entspricht. Nun könnte die neu tangierte Isoquante Yc die optimale Produktionsmenge wiedergeben. Punkt C wäre dann das neue Produktionsoptimum, das mit noch mehr Beschäftigten als in Punkt B (EC > EB > EA) und weniger Kapital als in Punkt A - wenn auch nicht ganz so wenig wie in Punkt B (KB< KC < KA) - produziert wird. Von einer offensichtlich ineffizienten Ausweitung der Beschäftigung wie im Punkt B kann nun nicht mehr die Rede sein, da der insgesamt verringerten Menge an Freizeit eine höhere Produktion gegenübersteht.
Doch welche makroökonomischen Zusammenhänge müssen jetzt beachtet werden, wenn dieses Modell gesamtwirtschaftlich interpretiert werden soll? Konkret: Wie läßt sich dieser Fall mit der Quantitätsgleichung in Übereinstimmung bringen, die besagt, daß nominale Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit des Geldes immer gleich dem Produkt aus realem Output und Preisniveau sein müssen? Diese Gleichung kann als die gesamtwirtschaftliche Budgetrestriktion bezeichnet werden, die zu jedem Zeitpunkt gelten muß - völlig unabhängig von der Art des gewählten Modells? Wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes nicht gestiegen ist, müssen in Punkt C die Preise gesunken sein, da nur dann die reale Geldmenge so weit zugenommen haben kann, wie es der Ausweitung der realen Produktion entspricht. [Fn.9: Oder in Wachstumsraten ausgedrückt: Die Inflationsrate muß bei gegebenem Geldmengenwachstum gefallen sein.] Das bedeutet,
[Seite der Druckausgabe: 13]
daß die Unternehmen die Lohnkostenentlastung zumindest teilweise weitergeben müssen, um die potentiell wachsende Produktion auch absetzen zu können. Wie hat sich dann der Reallohn entwickelt? Er ist gegenüber dem Ausgangspunkt A zumindest weniger stark gefallen als im ersten Fall (Punkt B). Das ist für den Neoklassiker äußerst erstaunlich, hat doch die Beschäftigung in C stärker zugenommen als in B. Daß die Preisreaktion schwächer bleibt als die Nominallohnsenkung, der Reallohn also überhaupt gegenüber dem Punkt A gesunken ist, ist aufgrund der neoklassischen Produktionsfunktion zwingend: Da die Beschäftigung zugenommen hat und obendrein die Kapitalintensität zurückgegangen ist, muß die Grenzproduktivität des Faktors Arbeit abgenommen haben. Weil sie im Optimum dem herrschenden (realen) Faktorpreis entspricht, muß auch der Reallohn gesunken sein.
Aber auch in Punkt C findet noch Kapitalvernichtung im Vergleich zu Punkt A statt. Eine umfassende gesamtwirtschaftliche Analyse müßte klären, welche Auswirkungen von diesen Verlusten oder zumindest der Verringerung der Kapitalnachfrage auf den Kapitalmarkt ausgehen (z.B. Zinssenkungen, die das Faktorpreisverhältnis nicht unberührt lassen). Da die Empirie einen Gleichlauf von Beschäftigungsausdehnung und Investitionswachstum ausweist, scheint Punkt C wegen des verringerten Kapitalstocks jedoch nicht der praxisrelevante Fall zu
Warum sollte man sich an die Drehung der Lohn-Zins-Gerade durch den Punkt A klammem und nicht auch eine Verschiebung dieser Gerade nach außen zulassen, und zwar solange, bis der Punkt D erreicht ist? Punkt D ist einerseits durch Konstanz des eingesetzten Kapitalstocks gekennzeichnet (KA = KD) und andererseits durch den Fahrstrahl, der aus allen Isoquanten-Punkten besteht, die die Steigung des neuen Lohn-Zins-Verhältnisses aufweisen. [Fn.10: Da die neoklassische Produktionsfunktion linear-homogen ist, liegen alle Isoquantenpunkte mit der gleichen Steigung auf einer Geraden durch den Ursprung.] Das bedeutet, daß der unter diesen Bedingungen zustandekommende Output YD noch größer als der in Punkt C ist und mit dem bisherigen Kapitalstock KA sowie wesentlich mehr Beschäftigten
(ED > EC > EB > EA) produziert wird. Zwar muß das Preisniveau erneut gesunken sein, um diese reale Expansion bei gleichbleibender nominaler Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit zu ermöglichen (YD * PD = YA *PA), daraus folgt aber nicht notwendigerweise, daß die nominalen Gewinne zurückgegangen sind: Ist die Lohnsumme gegenüber dem Ausgangspunkt A nicht gestiegen, sondern gleich geblieben (ED * WD = EA * WA) , hat sich auch die Lohnquote nicht erhöht. Dann ist die nominale Verzinsung
iD = (YD * PD - ED * WD) / KD = (YA * PA - EA * WA) / KA = iA
[Seite der Druckausgabe: 14]
konstant geblieben, und die reale Verzinsung iD / PD ist sogar gestiegen gegenüber Punkt A wegen PA > PD.
Selbst bei gestiegener Lohnsumme - also wenn der Beschäftigungseffekt den Effekt der Nominallohnsenkung überwiegt - und entsprechend verringerten Gewinnen und gesunkener Nominalverzinsung kann die reale Verzinsung gegenüber Punkt A allein aufgrund der Preissenkung gestiegen sein. Sie muß es sogar, folgt man der Logik der neoklassischen Produktionsfunktion, gemäß der die Grenzproduktivität eines Faktors positiv von der Einsatzmenge des anderen Faktors abhängt. Da die Beschäftigung gestiegen und der Kapitaleinsatz konstant geblieben ist, muß die Grenzproduktivität des Kapitals in Punkt D zugenommen haben, also auch die Entlohnung des Faktors Kapital, die reale Verzinsung. Der Reallohn ist symmetrisch dazu trotz gefallener Preise immer noch geringer als in Punkt A, so daß das Lohn-Zins-Verhältnis ebenfalls kleiner bleibt als vor der Nominallohnsenkung. Das bereits für Punkt C konstatierte Phänomen, daß die Beschäftigung stärker steigt trotz geringerer Reallohnsenkung, tritt hier erneut und in größerem Umfang auf.
Doch wie verträgt sich die Feststellung eines gestiegenen Realzinses mit der für die reale Expansion notwendigen Annahme einer gestiegenen realen Geldmenge? Die gesamtwirtschaftliche Budgetrestriktion lehrt, daß bei konstanter nominaler Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit die reale Nachfrage nur in dem Ausmaß zunehmen kann, wie die Preise sinken. Ist der Expansionsprozeß abgeschlossen, hat auch der vom Liquiditätsbedarf her bestimmte Geldmarktzins das gleiche Niveau wie im Ausgangspunkt, unterstellt man keine geänderten Zinselastizitäten. Was spielt sich auf dem Kapitalmarkt ab?
Der dichotome Charakter des neoklassischen Modells erlaubt hier keine Antwort. Punkt D bedeutet gleiche Kapitalnachfrage wie in Punkt A (KA = KD) bei gestiegenem Einkommen. Das müßte, konstante Sparquote unterstellt, zu einem steigenden Kapitalangebot geführt haben. Dies bedeutet Zinssenkung. Der Widerspruch zu der Zinssteigerung, wie sie die Eigenschaften der neoklassischen Produktionsfunktion erfordert, löst sich auf, wenn man gedanklich die Trennung von Güter- und Geldzins vornimmt, wie sie in der Theorie von Tobin's q zum Ausdruck kommt. In Punkt D tritt offenbar die Situation ein, daß der Güterzins über dem Geldzins (genauer; dem Kapitalmarktzins [Fn.11: Von einer Risikoprämie abgesehen sind Güter- und Geldzins gemäß Tobin's q-Theorie gleich, wenn alle Anpassungsprozesse abgeschlossen sind.]) liegt, Tobin's q also größer l ist. Das bedeutet aber nichts anderes, als daß auch der Punkt D nur ein (gedankliches) Übergangsstadium im Anpassungsprozeß an die Nominallohnsenkung ist. Solange der Güterzins über dem Kapital-
[Seite der Druckausgabe: 15]
marktzins liegt, lohnt es sich, die eingesetzte Kapitalmenge zu erhöhen, d.h. zu investieren. Dadurch ändert sich das Lohn-Zins-Verhältnis aber wieder in Richtung der Ausgangslage, und es geraten andere Isoquanten als YD ins Blickfeld, im Zweifel auch niedrigere, auf denen Punkte realisiert werden können, die zwar durch mehr Kapital als in Punkt A, aber möglicherweise weniger Beschäftigung als in Punkt D gekennzeichnet sind. Punkt D war ja nur der gedachte Extremfall, falls man den im Hintergrund ablaufenden Kapital- und Geldmarkt außer Acht läßt. Wie der Expansionspfad unter den Annahmen einer neoklassischen Produktionsfunktion einerseits und diversen Zinselastizitäten von Geld- bzw. Kapitalangebot und -nachfrage andererseits aussehen könnte, muß offen bleiben.
Wo findet der Anpassungsprozeß sein Ende? Im Fall voll flexibler Güterpreise wird die ursprüngliche Nominallohnsenkung vollständig in den Preisen weitergegeben. In Wachstumsraten ausgedrückt:
w = (WA - WB) / WA = p = (PA - PE) / PA < 0
Die reale Geldmenge und mit ihr die Produktionsmenge steigen im Ausmaß der Preissenkung:
y = (YA- YE) / YA= -p > 0. Der Reallohn bleibt konstant. Das ist mit der unterstellten neoklassischen Produktionsfunktion nur kompatibel, wenn die Grenzproduktivität des Faktors Arbeit ebenfalls gleich bleibt. Wegen Linear-Homogenität der neoklassischen Produktionsfunktion ist diese Bedingung genau dann erfüllt, wenn beide Produktionsfaktoren mit derselben Rate wachsen wie der Output: y = (KA - KE) / KA = (EA - EE) / EA. Die Kapitalintensität verändert sich dann nicht, d.h. der gesuchte Punkt E liegt auf dem Fahrstrahl, der vom Ursprung ausgehend durch Punkt A verläuft. Gleichzeitig bleibt aber auch der Realzins konstant, was sich mit der für die Expansion notwendigen Annahme einer wachsenden realen Geldmenge verträgt. Insgesamt kommt es zu keiner Veränderung der Verteilungssituation. Beschäftigung, Kapitalstock und Output sind am Ende des Prozesses gleichermaßen gewachsen.
Punkt E, der also durch die volle Weitergabe der Lohnkostenentlastung in den Preisen gekennzeichnet ist, ist Punkt D und allen übrigen (hier nicht eingezeichneten) Punkten, die bei einer Reallohnsenkung Zustandekommen können, vorzuziehen, weil er auf der höchstmöglichen Isoquante liegt: Ist die Maximierung des gesamten Einkommens Ziel allen Wirtschaftens, ist offenbar die volle Weitergabe der Nominallohnsenkung in den Preisen die überlegene Strategie, weil mit ihr die größtmögliche Produktionsausdehnung stattfinden kann. Das ist insofern ein bemerkenswertes Ergebnis, als es einen trade off zwischen Umverteilungsversuchen zugunsten der Kapitaleinkommen - denn um nichts anderes handelt es sich bei der unvollständigen Weitergabe der Lohnkostenentlastung in den Preisen - und dem möglichen Wachstum belegt. Das widerspricht der naiven Vorstellung 'Gewinnsteigerung führt zu Inve-
[Seite der Druckausgabe: 16]
stitionen' fundamental. Der Umverteilungsversuch zugunsten der Kapitaleinkommen erhöht zwar die Neigung der Unternehmer, mit niedrigerer Kapitalintensität zu produzieren, andererseits beschränkt er aber die realen Wachstumsmöglichkeiten, weil die reale Geldmenge bei konstanter nominaler Geldmenge eben nur durch Preissenkungen gesteigert werden kann.
Was läßt sich aus der gesamtwirtschaftlichen Analyse des Wirkungszusammenhangs einer Nominallohnsenkung im neoklassischen Modell lernen? Wenn unter den Annahmen dieses Modells durch eine Nominallohnsenkung ein Wachstumsprozeß ausgelöst werden kann, dann muß dies auch durch eine Erhöhung der nominalen Geldmenge möglich sein. Sie senkt den Geldzins, löst also eine Differenz zwischen Güter- und Geldzins aus (Tobin's q > l). Sinkt der Kapitalmarktzinssatz unter den bisherigen Güterzins [Fn.12: Abgesehen von einer ohnehin vorhandenen Risikoprämie.], kann der Ausgleich auf verschiedenen Wegen zustande kommen:
Güterzinssatz = i/P = (Y * P - E * W) / K * P > Kapitalmarktzinssatz
Entweder die Nominallohnforderungen steigen, dann verpufft die expansive Geldpolitik in einer Lohn-Preis-Spirale. Oder die Kapitalnachfrage steigt, d.h. die Investitionen werden angeregt. Bei elastischem Güterangebot reagiert der Markt darauf nicht (zumindest nicht ausschließlich) mit Preissteigerungen. Die steigende reale Produktion erhöht allmählich den Liquiditätsbedarf, so daß sich der ursprüngliche Zinseffekt am Geld- und damit auch am Kapitalmarkt wieder zurückbildet, bis die zusätzliche Liquidität vollständig absorbiert ist. Der Güterzins sinkt unter den Bedingungen der Linear-Homogenität der Produktionsfunktion nicht, da der Kapitalstockausweitung eine entsprechende Steigerung von Produktion und Erwerbstätigkeit gegenübersteht, die Gewinne also mit der gleichen Rate wachsen. Das entspricht der Rückkehr des Kapitalmarktzinses auf sein altes Niveau am Ende des Anpassungsprozesses.
Wer diesem Mechanismus unter Hinweis auf eine langfristig senkrechte Phillipskurve jede Bedeutung abspricht, der kann auch von einer Nominallohnsenkung keine Anregung des Wachstums erwarten.
1.4 Implikationen der Substitutionsthese
Die auf der Substitutionsthese basierende Empfehlung, die Arbeitsproduktivität zu senken bzw. das Wachstum der Arbeitsproduktivität zu verlangsamen, zielt im Kern darauf ab, eine
[Seite der Druckausgabe: 17]
ineffizientere, d.h. arbeitsintensivere Produktionsweise als technisch möglich zu realisieren, um das Verteilungsproblem zu lösen, daß Arbeitslose unfreiwillig zuviel Freizeit und zu wenig Konsumgüter konsumieren. Wer eine solche Strategie zur Lösung der Arbeitsmarktprobleme empfiehlt, muß begründen, inwiefern sie einer Umverteilungslösung überlegen ist, bei der weiterhin so kapitalintensiv wie bislang produziert wird, jedoch die Arbeitszeit (und damit auch die Arbeitseinkommen) anders, nämlich gleichmäßiger auf die Erwerbspersonen verteilt wird, z.B. durch allgemein verordnete Arbeitszeitverkürzungen [Fn.13: Zu solchen Umverteilungsmaßnahmen zählen z.B. auch Teilzeit- und Frühverrentungsmodelle, wie sie zur Entlastung des Arbeitsmarktes in den Niederlanden intensiv durchgeführt wurden.]. Insgesamt gesehen dürfte der Wohlstand einer Gesellschaft bei gleicher Güterproduktion, sprich bei gleichem Einkommen, nämlich höher sein, wenn diese Gütermenge mit insgesamt weniger Arbeit (und mehr Kapital) hergestellt worden ist als mit mehr Arbeit (und weniger Kapital). Denn dann ist die Menge der in dieser Gesellschaft insgesamt zur Verfügung stehenden Freizeit höher als in der Gesellschaft, in der arbeitsintensiver produziert wird. Aufgrund sozialpolitischer, nicht originär ökonomischer Überlegungen mag darüber hinaus eine gleichmäßigere Verteilung von Arbeitslosigkeit („Arbeitsmangel") via zwangsweiser Arbeitszeitverkürzung sinnvoll sein, z.B. um das Entstehen politisch extremistischer, demokratiegefährdender Gruppierungen zu verhindern.
Gegen solche Umverteilungsmaßnahmen läßt sich lediglich einwenden, daß der Zwangscharakter unfreiwilliger Arbeitszeitverkürzungen unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten eines marktwirtschaftlichen Systems ähnlich bedenklich ist wie der Zwangscharakter, den Arbeitslosigkeit für die Betroffenen hat. Auch mögen Allokationsverzerrungen im Zusammenhang mit Arbeitsumverteilungsmaßnahmen auftreten. [Fn.14: Die Bandbreite solcher Ineffizienzen reicht dabei von Qualifikationsmismatch bei der Suche nach geeigneten Teilzeitarbeitskräften bis hin zu verstärkter Schwarzarbeit und rückläufiger Arbeitsteilung. society to which the industry in question has to respond ... But it stands to reason that the particular industry's equilibrium output ... is the right output only with reference to the outputs of all the other industries. ... demand, supply, and equilibrium are concepts with which to describe quantitative relations within the universe of commodities and services. They do not carry meaning with respect to this universe itself. ... aggregate demand and aggregate supply are not independent of each other, because the component demands for the output of any industry ... comes from the supplies of all the other industries.... This is the proposition which ... I call Say's Law and which I believe renders Say's fundamental meaning." J.A. Schumpeter (1954), S. 617.]
Unter realistischen ökonomischen Bedingungen ist die Substitutionsthese auf keinen Fall zu halten. Die Vorstellung, bei sinkendem oder langsamer steigendem Lohn-Zins-Verhältnis wendeten alle Unternehmer auf Dauer eine arbeitsintensivere Produktionstechnologie angeht, in die Irre. Sie basiert auf einem Modell vollständiger Konkurrenz, in dem keine Gewinne im engeren Sinne, also über die Zinskosten des Kapitals hinausgehende Erträge anfallen. Insofern erklärt die Neoklassische Theorie das Zustandekommen, genauer gesagt: das Diffundieren technischen Fortschritts nicht, weil sie keinerlei Anreize für innovatives Verhalten abbildet, z.B. in Form vorübergehender Monopolgewinne. Statt dessen verfügen alle Unternehmer stets
[Seite der Druckausgabe: 18]
über das gleiche technologische Wissen und wenden es stets alle gleichzeitig in identischer Weise an.
Warum aber sollte es nicht für einen einzelnen Unternehmer langfristig lohnend sein, bei sinkendem Lohn-Zins-Verhältnis bei einem kapitalintensiveren Produktionspfad zu bleiben, während alle übrigen Unternehmer auf einen arbeitsintensiveren Pfad einschwenken? Denn sobald - wenn denn die auf der Substitutionsthese basierende Lohnzurückhaltung tatsächlich die Arbeitslosigkeit zu verringern in der Lage wäre - Vollbeschäftigung erreicht würde, wüchsen die Löhne ja wieder im Tempo der durchschnittlichen (Vollbeschäftigungs-) Arbeitsproduktivität. Die Arbeitsproduktivität des einen Unternehmers läge dann jedoch technologiebedingt über der durchschnittlichen, so daß er solange einen Kostenvorteil gegenüber seinen Konkurrenten hätte, bis diese auf seinen kapitalintensiveren Technologiepfad wieder eingeschwenkt sind. Diesem Kostenvorteil ab Erreichen der Vollbeschäftigung steht allerdings ein Kostennachteil in der vorausgehenden Phase gegenüber, weil der kapitalintensiver produzierende Unternehmer höhere Zinskosten tragen muß. Gegen den Zinskostennachteil sind allerdings die Verluste der übrigen Unternehmer gegenzurechnen, die ihnen aus der Abschreibung ihrer kapitalintensiveren Produktionstechnologie, beim Umsatteln auf arbeitsintensivere Produktionsprozesse, erwachsen. Kann der „Abweichler" seinen Nachteil „vorfinanzieren" und durch den späteren Vorteil mehr als kompensieren, lohnt sich für ihn das Abweichen von der allgemeinen Strategie, bei langsamer wachsendem Lohn-Zins-Verhältnis relativ arbeitsintensiver zu produzieren. Die Möglichkeit der „Vorfinanzierung" hängt von der Länge der Übergangsphase bis zum Erreichen der Vollbeschäftigung im Vergleich zu seinem Planungszeithorizont und davon ab, wie schnell die übrigen Unternehmer beim Erreichen der Vollbeschäftigung den Technologiepfad erneut wechseln können. Lohnt sich das Abweichen von der allgemein unterstellten Strategie für einen einzelnen Unternehmer, dann ist es für jeden einzelnen rational. Dann hielte sich keiner an die im Modell unterstellte Strategie, so daß der Substitutionsprozeß trotz sinkenden Lohn-Zins-Verhältnisses nicht verlangsamt würde. Damit entfiele der beschäftigungsschaffende Mechanismus, der den lohnpolitischen Empfehlungen der Substitutionsthese zugrunde liegt.
Aus Erfahrung wissen die Unternehmer, daß das Lohn-Zins-Verhältnis langfristig steigt - das kennzeichnet jede wachsende Volkswirtschaft. Denn sofern die Lohnquote nicht gegen Null strebt (marxistische Hypothese), sondern langfristig mehr oder weniger stabil ist und nur zyklischen Schwankungen unterliegt, wachsen Lohn- und Kapitaleinkommen langfristig mit der gleichen Rate wie die Produktion. Lohneinkommen sind das Produkt aus Arbeitseinsatz und Lohnsatz pro Arbeitseinheit, Kapitaleinkommen das Produkt aus Kapitalstock und Zinssatz. In entwickelten Volkswirtschaften wächst der Kapitalstock schneller als die Bevölkerung und
[Seite der Druckausgabe: 19]
damit der maximal mögliche Arbeitseinsatz, findet also langfristig eine Kapitalintensivierung statt. Darin schlägt sich der technische Fortschritt nieder. Mit einer langfristig stabilen Lohnquote, also dem Verhältnis von Lohneinkommen zum gesamten Einkommen bzw. der Produktion, ist eine solche Entwicklung aber nur vereinbar, wenn der Lohnsatz schneller steigt als die Kapitalverzinsung, d.h. das Lohn-Zins-Verhältnis zunimmt. Daher ist es auf lange Sicht immer lohnend, zunehmend kapitalintensiv zu produzieren.
Wie rasch die Kapitalintensität steigt, hängt allerdings von den technischen Innovationen und ihren Finanzierungsmöglichkeiten ab. Man mag durch Zinssteigerungen die Diffusion von Innovationen bremsen; damit beschränkt man jedoch gleichzeitig das potentielle Einkommenswachstum, so daß einem kleineren Substitutionseffekt zwischen Arbeit und Kapital auch ein geringerer Einkommenseffekt gegenübersteht. Beschäftigungspolitisch ist damit nichts gewonnen. Man mag umgekehrt durch Lohnsenkungen das Kapital relativ zur Arbeit kurz- bis mittelfristig verteuern - langfristig wird man damit die Kapitalintensivierung nicht aufhalten. Vielmehr würden kurz- bis mittelfristig, wenn es denn zu einer Verlangsamung des Wachstums der Arbeitsproduktivität käme. Wachstumsmöglichkeiten bzw. potentielle Freizeit verschenkt zugunsten einer Verringerung der Arbeitslosigkeit.
Welche empirische Relevanz das Nicht-Zurückfallen hinter einen einmal erreichten kapitalintensiven Technologiestandard hat, zeigt sich z.B. am Ausnutzen des Lohngefälles zwischen Industrie- und Schwellen- bzw. Entwicklungsländern durch international agierende Unternehmen. Sofern es die Infrastruktur- und Humankapitalausstattung eines „Billiglohnlandes" attraktiv erscheinen läßt, vergleichsweise arbeitsintensive Produktionen von „Hochlohnländern" dorthin zu verlagern, produzieren diese ausländischen Investoren dort eben gerade mit ihrer aktuellen Technologie und nicht mit einer noch arbeitsintensiveren. Dann nämlich nutzen sie das Lohngefälle optimal aus.
Auf welch unsicherem theoretischen Boden ein Konzept der Verlangsamung des Wachstums der Arbeitsproduktivität steht, kann man sich anhand einfacher Beispiele klarmachen. Grundsätzlich haben mit dem neoklassischen Modell argumentierende Ökonomen gegen ein Wachstum der Arbeitsproduktivität dann nichts einzuwenden, wenn es mit Vollbeschäftigung einhergeht. In Zeiten sinkender Erwerbstätigkeit allerdings rechnen sie aus, wie stark bei dem tatsächlich eingetretenen Wachstum der Produktion die Arbeitsproduktivität nur hätte steigen dürfen, um die Erwerbstätigkeit konstant zu halten. Den darüber hinausgehenden Teil des tatsächlichen Anstiegs der Arbeitsproduktivität nennen sie Entlassungsproduktivität, die sie auf die Lohnentwicklung zurückführen. Wie ist dieses Konzept der „guten", weil beschäftigungsneutralen und einkommensteigernden, Produktivitätssteigerung und der „schlechten" weil mit Entlassungen verbundenen, Produktivitätssteigerung auf mikroökonomischer Ebene
[Seite der Druckausgabe: 20]
zu verstehen? Angenommen, ein Unternehmen investiert in neue Maschinen mit höherer Arbeitsproduktivität. Kann das Unternehmen nur die gleiche Produktmenge an seinem Markt absetzen wie vor der Investition, wird es Mitarbeiter entlassen. Dann handelt es sich also um „schlechte" Produktivität. Kann es mehr absetzen, wird es zumindest die gleiche Anzahl Mitarbeiter beschäftigen. Dann handelt es sich um „gute" Produktivität. Es hängt also in diesem Fall nicht von der Art der Investition ab, welche Sorte Produktivität vorliegt, sondern von den Absatzmöglichkeiten des Unternehmens.
In einem zweiten Fall investiert das Unternehmen, entläßt Mitarbeiter und produziert zugleich mehr als zuvor. Auf mikroökonomischer Ebene handelt es sich um „schlechte" Produktivität. Findet dieser Prozeß in einem gesamtwirtschaftlichen Umfeld statt, in dem Arbeitskräfte mit der Qualifikation der Entlassenen gesucht werden, und treten diese entsprechend neue Stellen an, wird auf aggregierter Ebene statistisch „gute" Produktivität gemessen.
Diese zwei willkürlich herausgegriffenen Beispiele demonstrieren bereits, welche Definitionsprobleme mit dem Wort „Entlassungsproduktivität" verbunden sind. Je nachdem, in welchem gesamtwirtschaftlichen Umfeld technischer Fortschritt umgesetzt wird und auf welcher Aggregationsebene man den Vorgang mißt, sieht er einmal „gut" und einmal „schlecht" aus.
Aus dem Motiv für die Steigerung der Produktivität kann ebensowenig auf deren Ergebnis hinsichtlich Wachstum und Beschäftigung geschlossen werden wie umgekehrt aus dem Ergebnis am Arbeitsmarkt auf die Motive für die Produktivitätssteigerung. Ob die Produktivität „gut" oder „schlecht" ist, hängt einzig und allein von der Nachfragesituation ab. Technisch gesprochen: Das Ergebnis einer Verschiebung der einzelwirtschaftlichen Angebotskurve nach rechts ist unbestimmt, solange keine Aussage über die Steigung und eine mögliche Verschiebung der Nachfragekurve (nach rechts) gemacht wird.
Produktivitätssteigerungen, wodurch sie auch immer motiviert sein mögen, sind zugleich potentielle Einkommenssteigerungen. Ob sie tatsächlich zu Einkommenssteigerungen werden, entscheidet die Nachfragesituation. Die potentielle Einkommenssteigerung, die mit der Verschiebung der Angebotskurve nach rechts verbunden ist, ist es, die mit dem Begriff „Say's Law" belegt werden kann: Das Angebot schafft sich „seine" Nachfrage, wenn keine Nachfra-gerestriktionen existieren, die das verhindern. [Fn.15: Vgl. dazu etwa Schumpeters Interpretation von Sav's Law: „... the demand schedule for the product of the industry in question is derived from the income generated by all the others: its own contribution to total income being negligible, that schedule may be considered as given independently of its own supply ... We then have given independent demand and cost schedules that summarize the whole of the economic conditions of]
[Seite der Druckausgabe: 21]
Für diese Überlegungen ist es keineswegs, wie auch die Deutsche Bundesbank [Fn.16: Vgl. Deutsche Bundesbank (1997), S. 35/36.] glaubt, zwingend, den Produktivitätspfad als „exogen vorgegeben" anzusehen; es ist lediglich die der Unterscheidung in gute und schlechte Produktivität wie auch der Bundesbank-Analyse zugrundeliegende Annahme zu verwerfen, der Wachstumspfad sei exogen vorgegeben, die Beschäftigung ließe sich also durch eine höhere Beschäftigungsintensität via niedrigere Löhne unabhängig vom Wirtschaftswachstum erhöhen. Wenn man lediglich das potentielle Wachstum - schumpeterianisch - von der Dynamik der Angebotsseite abhängig sieht, trifft man die für eine Marktwirtschaft nicht ungewöhnliche Annahme, es gebe neben der Angebotsseite noch eine Nachfrageseite des Marktes, die erst beide zusammen Einkommen und Beschäftigung bestimmen.
Im Ergebnis dieser Überlegungen stellt sich lediglich die Frage, ob nicht einer expansiven Geldpolitik gegenüber dem 'monetary management by the trade unions', wie Keynes die No-minallohnsenkungsstrategie zur Erhöhung der realen Geldmenge nannte, der Vorzug zu geben ist. Liegt zu Beginn des zu initiierenden Wachstumsprozesses die Inflationsrate über der Zielrate der Zentralbank, kann die Nominallohnsenkung eine erwünschte Verlangsamung der Preissteigerungsrate bewirken. Ist die Zielrate jedoch erreicht oder sogar unterschritten, kann die für das reale Wachstum via Nominallohnsenkung notwendige Deflation die Erwartungs-bildung der Wirtschaftssubjekte so beeinflussen, daß die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sinkt, Geld also gehortet wird. Dann kommt kein oder nur ein sehr geringes Wachstum zustande, schlimmstenfalls mündet diese Deflationsstrategie in eine Rezession à la Weltwirtschaftskrise 1929/30. Herrscht Preisstabilität, ist folglich eine Nominallohnsenkungsstrategie zur Schaffung von Wachstum einer aktiven Geldpolitik eindeutig unterlegen.
1.5 Die Substitutionsthese: Ein Zyklenvergleich
Die Substitutionsthese wird scheinbar immer wieder empirisch bestätigt. Solche empirischen Ergebnisse sind aber mit äußerster Vorsicht zu behandeln, und wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen dürfen darauf keineswegs unmittelbar aufgebaut werden. Testet man nämlich den
[Seite der Druckausgabe: 22]
Zusammenhang zwischen Löhnen bzw. Reallöhnen und Beschäftigung, wird man in der Regel einen positiven Befund erhalten: Sinken die Reallöhne oder steigen sie weniger, steigt die Beschäftigung. Das ist aber keineswegs eine Bestätigung des neoklassischen Zusammenhangs, sondern zumeist Folge der Überlagerung verschiedener Effekte in der Wirklichkeit, die ohne jeden Bezug zur Neoklassik sind.
Der wichtigste dürfte sein, daß sowohl die Lohnquote wie die Beschäftigung ein stark prozyklisches Element aufweisen (Abbildung 2). Im Aufschwung, wodurch dieser auch immer ausgelöst sein mag, sinkt die Lohnquote und im Abschwung steigt sie. Das ist so, weil bei monetären Schocks, die in der Regel für Auf- und Abschwünge verantwortlich sind, die Preise und Löhne relativ rigide reagieren und daher - wie oben dargelegt - die Mengen(-Nachfrage)-effekte bei Produktion und Beschäftigung dominieren. Diese aber schlagen sich unmittelbar in den Gewinnen, den Residualeinkommen also, nieder, nicht dagegen in den Kontrakteinkommen, den Löhnen.
Daneben sind sinkende Reallöhne in der Regel ausgelöst von sinkenden oder im Vergleich zu den Preisen weniger stark steigenden Nominallöhnen, so daß der sogenannte Keynes-Effekt zu Buche schlägt, die Tatsache nämlich, daß bei sinkenden Löhnen und zumindest teilweiser Weitergabe dieser Lohnkostenentlastung in den Preisen die reale Geldmenge steigt und das Zinsniveau sinkt. Sinkende Reallöhne können auch verbunden sein mit der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft, also einer realen Abwertung. Auch dies kann positive Effekte für die Beschäftigung mit sich bringen, ohne daß daraus der neoklassische Nexus, „sinkende Reallöhne gleich steigende Beschäftigung, zu hohe Reallöhne gleich Arbeitslosigkeit", abzuleiten wäre.
Eine einfache empirische Überprüfung (Abbildung 3) zeigt sogar einen der Substitutionsthese genau zuwiderlaufenden Befund. Investitionen in Sach- und Humankapital werden zur gleichen Zeit verstärkt oder zurückgefahren. Hätte die Substitutionsthese ein in die Waagschale fallendes Gewicht für die Erklärung der Wirklichkeit, müßten sich immer wieder Phasen der Wirtschaftsentwicklung beobachten lassen, in denen - wegen relativ sinkender Reallöhne - die Unternehmen mehr Arbeitskräfte beschäftigen, aber weniger in den Aufbau des Kapitalstocks investieren und umgekehrt. Insbesondere in Phasen steigender Arbeitslosigkeit wie Mitte der siebziger und zu Beginn der achtziger Jahre sowie seit 1992 müßten sowohl ein außerordentlicher Anstieg der Reallöhne als auch eine verstärkte Investitionstätigkeit der Unternehmen festzustellen sein, weil die Unternehmen versuchen, den „Reallohndruck" durch eine Kapi-talintensivierung der Produktion abzufangen. Das Gegenteil ist empirisch nachweisbar. In den Phasen steigender Arbeitslosigkeit sinkt die Auslastung des vorhandenen Kapitalstocks, dieser wird also wie das Arbeitskräftepotential teilweise „arbeitslos", und die Investitionstätigkeit
[Seite der Druckausgabe: 23]
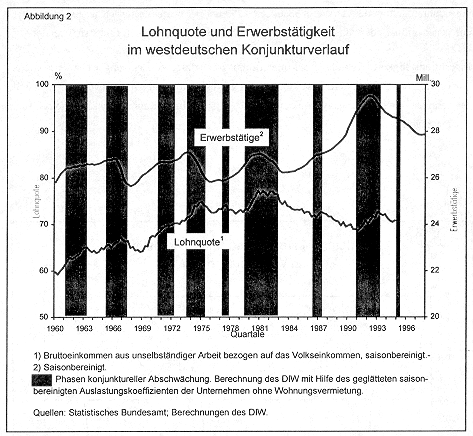
geht stark zurück. Bleibt die Investitionsdynamik auch nach Ende der Rezession - wie z.B. nach 1993 - gering, bleiben auch Beschäftigungsimpulse aus.
Die Unternehmen investieren zu einem bestimmten Zeitpunkt also immer in mehr zusätzliches Sachkapital und in Humankapital zugleich und nicht - wie die Substitutionsthese vermutet - in Arbeit oder in Kapital. Betrachtet man die Aufschwungphasen der Vergangenheit etwas genauer, läßt sich dieser Befund weiter erhärten. Die Reallohnposition (Abbildung 4), also das Maß für die Reallohnzurückhaltung der Arbeitnehmer bzw. das Maß für die Verbesserung der Verteilungsposition der Unternehmen, sinkt in allen Aufschwungphasen mit Ausnahme der sechziger Jahre. Besonders stark geht sie im jüngsten Aufschwung zurück. Die Verteilung hat sich also jetzt am stärksten zugunsten der Unternehmen verbessert. Genau entgegengesetzt ist der Verlauf bei der Arbeitslosigkeit (Abbildung 5 unten rechts): In den sech-
[Seite der Druckausgabe: 24]
ziger Jahren gelingt der stärkste Abbau, seit 1993 der bei weitem schwächste. Exakt die gleiche „Reihenfolge" der Aufschwungphasen wie bei der Arbeitslosigkeit findet sich bei der
Investitionstätigkeit (Abbildung 5 Mitte rechts). Der jetzige Aufschwung weist keineswegs, wie es nach der Substitutionsthese zu erwarten gewesen wäre, eine hohe Investitionsdynamik bei geringer Beschäftigungsdynamik auf, vielmehr ist die Investitionsentwicklung so schwach wie nie zuvor.
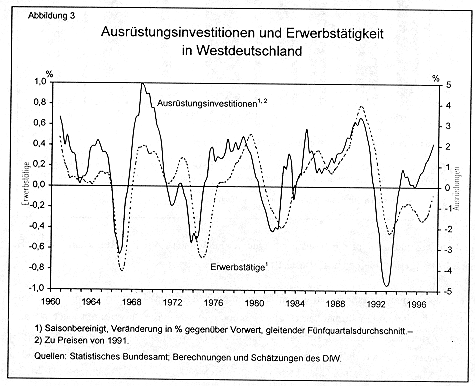
[Seite der Druckausgabe: 25]
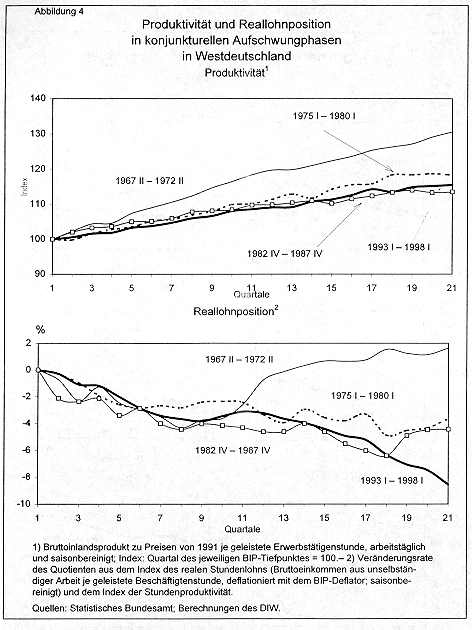
[Seite der Druckausgabe: 26]
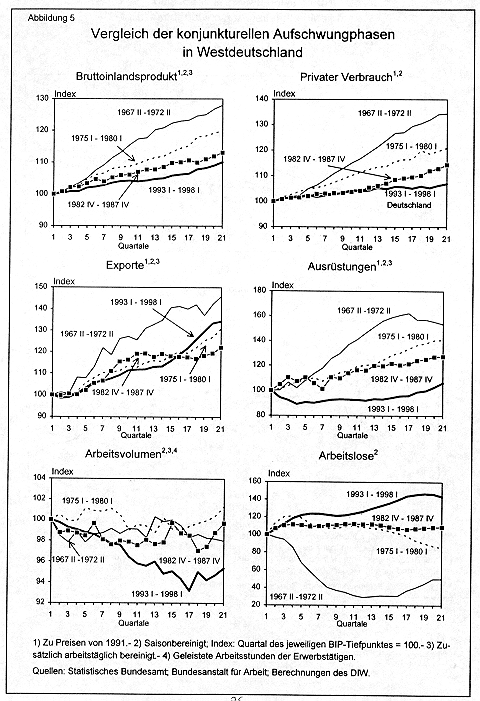
[Seite der Druckausgabe: 27]
Eine Erklärung für diese im Lichte der Substitutionsthese paradoxen Ergebnisse läßt sich finden, wenn man keynesianische Theorieelemente berücksichtigt. Betrachtet man die Nachfrageentwicklung im Zyklenvergleich und die kurzfristigen Zinsen, ist die schwache Investitions- und Arbeitsplatzdynamik in den neunziger Jahren nicht überraschend. In der ersten Phase nach der Rezession (1994 bis 1995) waren die von der Zentralbank gesetzten monetären Bedingungen weit ungünstiger als in vergleichbaren Phasen in den sechziger und siebziger Jahren (Abbildung 6). Der Realzins war weit höher als damals. Lediglich zu Anfang der achtziger Jahre hatten die monetären Bedingungen einen vergleichbar restriktiven Effekt wie in den neunziger Jahren. Hinzu kamen 1992 und 1995 noch kräftige Aufwertungen der D-Mark, die die deutschen Lohnkosten in internationaler Währung gerechnet erheblich verteuerten.
Der Export (Abbildung 5 Mitte links) fand daher erst später Anschluß an die Entwicklung früherer Zyklen, hat inzwischen aber sogar eine Spitzenposition im Vergleich der Nachfrageaggregate erobert. Weitaus ungünstiger verläuft freilich der private Verbrauch (Abbildung 5 oben rechts). Besonders augenfällig ist der Gegensatz zum Aufschwung Ende der sechziger Jahre. Waren damals die Nominal- und Reallöhne unmittelbar nach der Rezession sehr kräftig gestiegen und mit den Reallöhnen auch der private Verbrauch, war es diesmal umgekehrt.
Verteilungsspielraum und Beschäftigung in Westdeutschland
jahresdurchschnittliche Veränderung bzw. Veränderung gegenüber Vorjahr in %
|
Jahre |
Stunden- produk- tivität1) |
nominaler Stunden- lohn2) |
Inflations- bzw. Deflations- potential |
tat- sächliche Infla- tion3)4) |
realer Stunden- lohn5) |
realer Netto- Stunden- lohn6) |
realer privater Ver- brauch4) |
Arbeits- volumen7) |
Beschäf- tigte |
reales BIP |
|
1 |
2 |
3 = 2-1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1951-1960 |
6,9 |
9,2 |
2,3 |
1,9 |
7,2 |
6,6 |
7,8 |
1,0 |
3,3 |
8,0 |
|
1961-1970 |
5,3 |
9,6 |
4,4 |
2,7 |
6,6 |
5,7 |
5,1 |
-0,8 |
1,0 |
4,4 |
|
1971-1980 |
3,7 |
9,6 |
5,8 |
5,0 |
4,3 |
3,0 |
3,3 |
-1,0 |
0,7 |
2,7 |
|
1981-1985 |
2,1 |
4,4 |
2,3 |
3,8 |
0,6 |
-0,4 |
0,6 |
-0,9 |
-0,3 |
1,1 |
|
1986-1990 |
2,9 |
4,5 |
1,6 |
1,4 |
3,1 |
3,4 |
3,6 |
0,4 |
1,6 |
3,4 |
|
1991-1995 |
2,3 |
4,9 |
2,7 |
3,1 |
1,8 |
-0,4 |
2,1 |
-0,6 |
-0.1 |
1,6 |
|
1996-1997 |
2,9 |
2,0 |
-0,9 |
1,9 |
0,1 |
-0,3 |
0,8 |
-1,1 |
-1.2 |
1,8 |
|
1) Bruttoinlandsprodukt in Preisen von 1991 je geleistete Erwerbstätigenstunde. Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW | ||||||||||
Die Reallöhne nahmen außer im Jahre 1995 praktisch überhaupt nicht zu, in einer Netto-Rechnung sanken sie sogar, und der private Verbrauch stagnierte nahezu. Sehr ausgeprägt war
[Seite der Druckausgabe: 28]
dieses Muster vor allem in den letzten beiden Jahren (Tabelle). Während sich in allen anderen Zyklen spätestens zwei bis drei Jahre nach Beginn des Aufschwungs das Wachstum des privaten Verbrauchs beschleunigte, flachte es sich 1996 und insbesondere 1997 sogar nochmals ab.
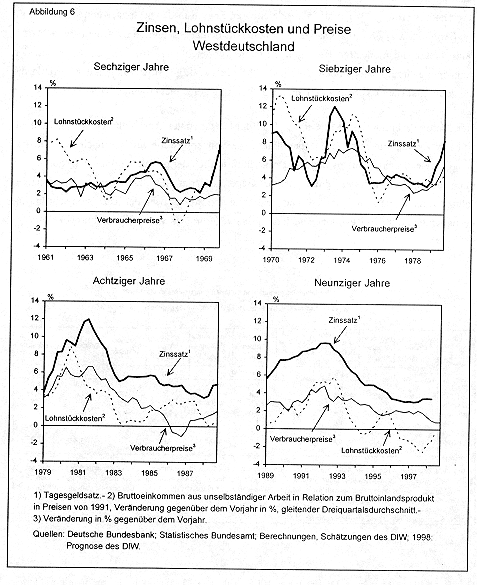
[Seite der Druckausgabe: 29]
Die Stagnation im vergangenen Jahr markierte die schlechteste Entwicklung des privaten Verbrauchs in Deutschland, die jemals außerhalb eines Rezessionsjahres zu beobachten war. Daß die Investitionsdynamik äußerst verhalten blieb, ist also trotz des Exportbooms erklärlich, nämlich im Rahmen einer keynesianischen Theorie.
1.6 Die Substitutionsthese: Ein internationaler Vergleich
Mitte der achtziger Jahre war die Theorie, nach der in Europa die Reallöhne zu stark gestiegen seien, en vogue [Fn.17: Vgl. insbesondere M. Bruno/J.D. Sachs: 1985.], ließ sich doch ohne weiteres zeigen, daß die Löhne in Europa - einschließlich Westdeutschlands - bis Anfang der 80er Jahre weit stärker gestiegen waren als die Summe aus Preis - und Produktivitätszuwachs. Die funktionale Einkommensverteilung hatte sich also zugunsten der Arbeitnehmerseite verbessert. Nach den Berechnungen des Sachverständigenrates erreichte der Anteil der Arbeitnehmereinkommen am Volkseinkommen in Deutschland im Jahre 1982 mit 87% seinen höchsten Wert, die Arbeitslosenquote war zur gleichen Zeit auf 8% gestiegen (Abbildung 7). Mitte der achtziger Jahre änderte sich allerdings das Bild: die Zahl der Arbeitslosen begann in Deutschland kräftig zu sinken, und nach der Rezession von 1981/82 war bei der Lohnentwicklung eine durchgreifende Korrektur in Gang gekommen. Dieser Befund konnte zunächst als glänzende Bestätigung der neoklassischen These angesehen werden, als der endgültige Beleg für die Überlegenheit dieses Theoriegebäudes gegenüber dem in Inflation und Umverteilung gescheiterten Keynesianismus.
[Seite der Druckausgabe: 30]

Daß die Dinge so einfach nicht sind, konnte schon damals unschwer erkennen, wer einen Blick über die deutschen Grenzen warf. In unserem Nachbarland Frankreich war nach der Rezession Anfang der 80er Jahre der Rückgang der Reallöhne im Verhältnis zu Produktivität und Preisen mindestens ebenso stark ausgeprägt wie in Deutschland, ohne daß in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre ähnliche Erfolge am Arbeitsmarkt sichtbar gewesen wären (Abbildung 8). Heute genügt es schon, die Fakten im Inland zur Kenntnis zu nehmen. Die Quote der Arbeitseinkommen sinkt - wiederum seit der Rezession - in noch größerem Tempo als damals, die Arbeitslosigkeit aber steigt seit 1992 in West- wie in Ostdeutschland auf immer neue Rekordmarken. Doch wer geglaubt hatte, das neoklassische Gedankengebäude werde nun einer grundlegenden Revision unterworfen oder zumindest die schlichten Thesen der siebziger und achtziger Jahren würden einer ernsthaften Überprüfung unterzogen, sieht sich getäuscht. In festem Glauben an das scheinbar unerschütterliche Lehrgebäude werden die Aussagen der 70er Jahre wiederholt, wird Lohnmoderation weiterhin als das wichtigste Instrument zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit angesehen.
[Seite der Druckausgabe: 31]

Geändert hat sich allerdings das methodische Vorgehen der Orthodoxie. Ende der siebziger Jahre verwies der Sachverständigenrat noch auf die Entwicklung der Lohnquote bzw. der Reallohnposition, um die These von den „zu hohen Löhnen" zu belegen. Er schrieb im Jahre 1978: „Es gibt gewichtige Argumente dafür, daß die gegenwärtige Arbeitslosigkeit... mit Störungen auf dem Arbeitsmarkt zu tun hat, weil sich bestimmte Probleme als Probleme eines zu hohen Lohnniveaus darstellen. Die realen Lohnkosten, etwa gemessen an der Reallohnposition der Arbeitnehmer, haben ein Niveau, das weit höher ist als in all den Jahren, in denen Vollbeschäftigung geherrscht hat." [Fn.18: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 1978/79, Ziffer 289.] Heute haben diese Lohnkosten ein Niveau, das eindeutig nicht höher oder sogar niedriger ist als in all den Jahren, in denen Vollbeschäftigung herrschte. Nun aber verweisen neoklassisch argumentierende Ökonomen nicht mehr auf die Reallohnposition oder die Arbeitseinkommensquote, sondern stellen das zuvor von ihnen selbst verwendete Konzept in Frage. Die Löhne dürften sich nicht an der tatsächlich gemessenen
[Seite der Druckausgabe: 32]
Zuwachsrate der Arbeitsproduktivität orientieren, sondern nur an einer „um den Beschäfti-gungsabbau bereinigten" [Fn.19: Sachverständigenrat (1978/79), Ziffer 368.], da in der Vergangenheit die Produktivität wegen zu hoher Lohnsteigerungen stärker gestiegen sei, als mit einer „beschäftigungsneutralen" Linie zu vereinbaren. Dieses Argument ist geeignet, die neoklassische Position vollständig gegen Falsifikationsversuche zu immunisieren. Wie groß auch immer die gemessene Reallohnzurückhaltung sein mag, steigt die Arbeitslosigkeit, ist sie auf jeden Fall zu gering, um die Löhne aus der Verantwortung für die Beschäftigung zu entlassen.
Gäbe es den neoklassischen Nexus überhaupt oder gar in der genannten quantitativen Dimension in einer in Zeit und Raum offenen Volkswirtschaft, müßte sich empirisch in einem internationalen Vergleich nachweisen lassen, daß die Länder am Arbeitsmarkt besonders erfolgreich sind, in denen die Reallohnzurückhaltung besonders ausgeprägt ist, und umgekehrt. Wäre die neoklassische Hypothese auch nur im Ansatz richtig, müßte zumindest in solchen Regionen, die über lange Zeit mit Unterbeschäftigung zu kämpfen haben, von den Reallöhnen nachweisbar und permanent ein weit größerer Druck zur Steigerung der Produktivität ausgehen als in Regionen, die fast durchgängig Vollbeschäftigung aufweisen.
Als Beleg für diese These wird häufig die Tatsache angeführt, daß in Europa über einen sehr langen Zeitraum (zumeist werden hier die Jahre 1970 bis 1995 zugrunde gelegt) gesehen die Reallöhne sehr stark gestiegen sind, in den USA aber fast gar nicht. Gleichzeitig hat dort die Beschäftigung viel stärker zugenommen als in Europa (Abbildung 9). Daraus wird die Überlegung abgeleitet, Europa und die USA hätten die „Wahl" zwischen hohen Einkommenssteigerungen und Vollbeschäftigung gehabt, und Europa habe sich für ersteres, die USA aber für letzteres entschieden. In der Tat scheint die Abbildung die Hypothese zu bestätigen, daß bei einem geringeren Druck von Seiten der Reallöhne ein deutlich höheres Beschäftigungswachstum realisiert werden kann. War Europa folglich nicht „bereit", ein Opfer in Form geringerer Einkommen für mehr Arbeitsplätze zu erbringen?
[Seite der Druckausgabe: 33]
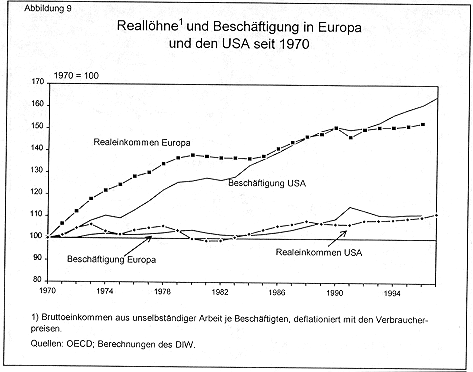
Zweifel an dieser Deutung der Wirklichkeit tauchen aber schon auf, wenn man für die in Abbildung 9 gezeigten Größen lediglich den Zeitraum wechselt. Abbildung 10 enthält exakt die gleichen Daten wie Abbildung 9, diesmal aber bezogen auf das Jahr 1980. Wäre die neoklassische Theorie richtig, müßte sie auch für diesen Zeitraum gelten. Doch nun ist der empirische Befund ein ganz anderer. Zwischen 1980 und 1996 steigt das Realeinkommen der Arbeitnehmer in den USA ebenso schnell wie in Europa, obwohl sich die Beschäftigung wiederum weit stärker als hier erhöht.
[Seite der Druckausgabe: 34]

Um die neoklassische Hypothese genauer zu überprüfen, werden im folgenden drei Volkswirtschaften einander gegenübergestellt, die seit Anfang der achtziger Jahre ganz unterschiedliche Entwicklungen der Arbeitslosigkeit aufweisen. Als erfolgreiches Land wurden die USA ausgewählt, wo zwar zu Anfang des Beobachtungszeitraumes die Arbeitslosigkeit sehr hoch war, höher sogar als in den beiden anderen betrachteten Ländern, wo es aber schon in den achtziger Jahren gelungen ist, die Rate der Erwerbslosen wieder auf ein Niveau zu drücken, wie es vor der Rezession zu Beginn der achtziger Jahre bestanden hatte (Abbildung 8). In der Mitte liegt die Bundesrepublik Deutschland. Die Zahl der Arbeitslosen ist hier zwar nach einer anfänglichen Stockungsphase kräftig gesunken, und die (von der OECD standardisierte) Arbeitslosenquote lag sogar zumeist unter der der USA, es gelang aber nicht, eine Zunahme des Niveaus der Arbeitslosigkeit über den Zyklus hinweg zu vermeiden. In keiner Weise erfolgreich bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit war Frankreich. Auch nach dem Ende der Rezession im Jahre 1983 stieg hier die Arbeitslosenquote nahezu kontinuierlich an. Lediglich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre gab es eine kurze Entlastungsphase, die aber keine
[Seite der Druckausgabe: 35]
durchgreifende Besserung brachte, vielmehr begann - wie in den meisten Ländern der Welt - zu Anfang der neunziger Jahre eine neue Rezession.
Welche Rolle spielen die Löhne bei der Erklärung dieser unterschiedlichen Verläufe? Um vergleichbare, also z.B. nicht durch unterschiedliche konjunkturelle Phasen gestörte Ergebnisse zu erzielen, wird hier die Entwicklung in allen drei Ländern jeweils vom konjunkturellen Tiefpunkt bis etwa zum konjunkturellen Höhepunkt betrachtet. Zugrunde liegen der Beurteilung damit jeweils sieben Jahre, die den Großteil des vergangenen Jahrzehnts abdecken.

In den sieben Jahren nach dem konjunkturellen Tiefpunkt nahmen in Frankreich die Geldlöhne mit jahresdurchschnittlich fast 4 ½ % weitaus am stärksten zu (Abbildung 11). In Westdeutschland und den USA gab es exakt den gleichen Zuwachs von jahresdurchschnittlich gut
3 %. Von Seiten der Nominallöhne ging also in Frankreich in dieser Periode der größte Ko-
[Seite der Druckausgabe: 36]
stendruck auf die Unternehmen aus. Doch wenn die Unternehmen in der Lage sind, diese Kostensteigerungen in den Preisen ihrer Produkte an die Konsumenten weiterzugeben, wird ein solcher Druck in der Gewinn- und Verlustrechnung letztlich nicht wirksam. Es besteht folglich weitgehende Einigkeit der Ökonomen aller theoretischen Ausrichtungen, daß nur die Analyse der Reallöhne ein aussagekräftiges Bild hinsichtlich der Rolle der Löhne bei der Substitution von Arbeit durch Kapital und damit für die Arbeitsnachfrage der Unternehmen vermitteln kann.
Hier jedoch ändert sich der Befund fundamental (Abbildung 12). Die Reallöhne sind in Westdeutschland nach Ende der Rezession Anfang der achtziger Jahre am stärksten gestiegen. In den USA und Frankreich, den Ländern mit der weitaus gegensätzlichsten Arbeitsmarktentwicklung, haben sich sehr ähnliche Reallohnzuwächse herausgebildet. Das heißt, der Druck zur Substitution von Arbeit durch Kapital war in Frankreich so gering wie in den USA. Folglich dürfte die Arbeitsproduktivität in Frankreich nicht stärker gestiegen sein als in den USA -zumindest dann, wenn die neoklassische Theorie einen quantitativ relevanten Erklärungsgehalt besitzt. Tatsächlich ist sie aber praktisch gleich stark wie in Deutschland gestiegen (Abbildung 13). In Deutschland sank die Arbeitslosigkeit, während sie in Frankreich zunahm.
Diese Fakten sind mit Hilfe der neoklassischen Theorie nicht erklärbar. Die Arbeitsproduktivität pro Stunde steigt in Deutschland und Frankreich jeweils um gut 2 % im Jahresdurchschnitt, in den USA, die den gleichen Reallohndruck wie Frankreich zu verzeichnen hatten, aber nur um 0,7 %. Auch mit der Entwicklung der Nominallöhne ist dieser glatte Widerspruch zu „neoklassischen Verhältnissen" nicht zu erklären. Wäre der Nominallohn wichtiger als der Reallohn, wäre immer noch unverständlich, daß in Frankreich die Produktivität ebenso stark zunimmt wie in Deutschland, obwohl doch die Nominallöhne viel stärker als hierzulande zugelegt haben.
[Seite der Druckausgabe: 37]
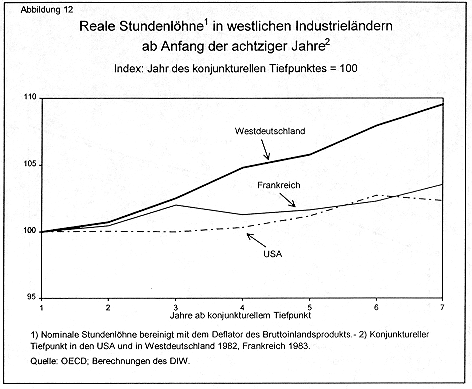
Das von der Neoklassik geforderte Zurückbleiben der Reallöhne hinter der Produktivität liefert im Vergleich der drei Länder ein eindeutiges Ergebnis (Abbildung 14). Berechnet man eine Reallohnposition, also die Differenz zwischen den Wachstumsraten von Reallohn und Arbeitsproduktivität und kumuliert diese vom konjunkturellen Tiefpunkt zu Anfang der achtziger Jahre an auf, sind die Verhältnisse genau umgekehrt, wie es die neoklassische Theorie läßt erwarten. Frankreich, das Land mit der bei weitem höchsten Arbeitslosigkeit, ist gleichzeitig das Land mit der weitaus stärksten Zurückhaltung bei den Reallöhnen. Die USA, wo die Arbeitslosigkeit am Ende des Beobachtungszeitraumes niedriger war als vor der Rezession von 1980/81, weisen die weitaus geringste Zurückhaltung bei den Reallöhnen auf. Westdeutschland nimmt auch hier eine mittlere Position ein, die Reallohnzurückhaltung ist zwar ausgeprägter als in den USA, aber geringer als in Frankreich.
[Seite der Druckausgabe: 38]
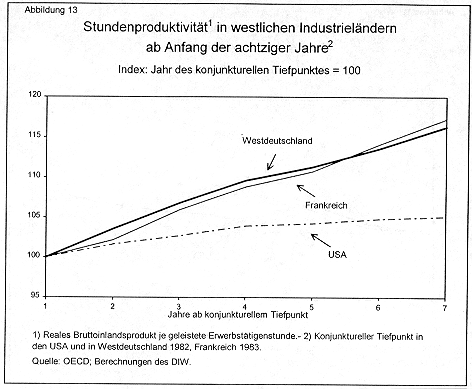
In den sieben Jahren (1983 bis 1990) der konjunkturellen Aufwärtsentwicklung in Frankreich bleiben die Reallöhne Jahr für Jahr deutlich hinter der Produktivität zurück. Gleichwohl ist die Arbeitslosigkeit in diesen sieben Jahren in Frankreich nicht gesunken, sondern am Ende dieses Zeitraumes höher als zu Beginn. Hinzu kommt, daß die Arbeitslosigkeit in Frankreich in den neunziger Jahren weiter stieg, obwohl sich die Reallohnzurückhaltung - wenn auch in abgeschwächtem Tempo - fortsetzte. In den USA dagegen blieb es, nach einem kurzen Rückschlag im Zuge der Rezession zu Beginn der neunziger Jahre, bei der überaus erfolgreichen Beschäftigungspolitik, obwohl hier auch weiterhin die Reallohnzurückhaltung schwächer ausgeprägt war als in Europa. [Fn. 20: Vgl. DIW (1997), Minderheitsvotum des DIW, S. 845.]
[Seite der Druckausgabe: 39]
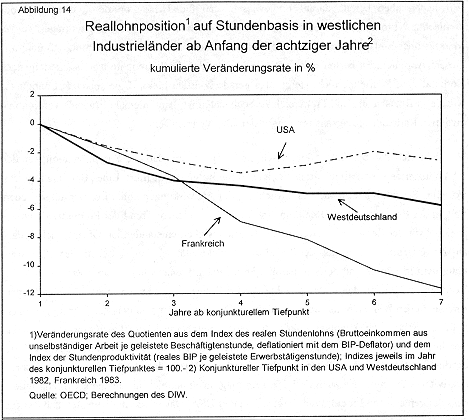
An dieser Stelle wird eingewandt, diese Meßergebnisse seien infolge der ambivalenten Bedeutung der Produktivität nicht in vollem Maße aussagekräftig. [Fn.21: Vgl. DIW (1997), Mehrheitsposition, S. 844.] Weil die Produktivität auch wegen „zu großen Drucks" von Seiten der Löhne gestiegen sein könne, folglich zu einem Teil das Ergebnis von Rationalisierung und Entlassungen sei, dürfe man bei dieser Berechnung nicht den gesamten Produktivitätszuwachs verwenden, sondern müsse um den von den Löhnen erzwungenen Rationalisierungseffekt „bereinigen". Auf diese Weise erhalte man eine „Vollbeschäftigungsproduktivität", deren Zuwachsraten deutlich unterhalb derjenigen der gemessenen Produktivität lägen.
[Seite der Druckausgabe: 40]
Wir haben oben bereits darauf hingewiesen, daß die These von der „guten" und der „schlechten" Produktivität theoretisch schon nicht zu halten ist, weil die Nachfrageseite des Marktes über Entlassung oder höheres Einkommen entscheidet. Hinzu kommt, daß man mit diesem Argument im besten Falle erklären könnte, daß die Lohnquote trotz stark steigender Nominal- und Reallöhne nicht steigt, also gerade konstant bleibt. Eine sinkende Lohnquote, wie sie in Deutschland und Frankreich zu beobachten ist, kann niemals Ergebnis von lohninduzierten Rationalisierungsanstrengungen der Unternehmen sein.
Hier läßt sich darüber hinaus empirisch eindeutig zeigen, daß die Argumentation mit der lohninduzierten Produktivität zu unsinnigen Schlußfolgerungen führt. Eine „Bereinigung" des aktuellen Produktivitätszuwachses hinsichtlich der Auswirkungen hoher Löhne muß auf jeden Fall an der Entwicklung der Reallöhne im Vergleich zu jenem Trend der Produktivität ansetzen, der vor der Zeit gegeben war, in der Arbeitslosigkeit entstanden ist. Oben ist schon darauf hingewiesen worden, daß der Trend der Produktivität seit langer Zeit in den USA weit unter dem in Europa und dem in den hier betrachteten Ländern liegt. Daß trotzdem nach der Rezession zu Beginn der achtziger Jahre die Reallöhne in Frankreich nicht stärker gestiegen sind als in den USA, läßt nur einen Schluß zu: Der Druck, der von den Reallohnsteigerungen auf die Erhöhung der Arbeitsproduktivität - ganz gleich bei welchem Trend - ausgegangen ist, war in Frankreich ebenso groß wie in den USA. Eine Bereinigung um lohndruckinduzierte Produktivitätszuwächse muß also zu dem Ergebnis führen, daß die Vollbeschäftigungsproduktivität, wie immer sie auch definiert sein mag, in Frankreich in gleichem Umfang unterhalb der gemessenen Produktivität liegt wie in den USA. Das wiederum bedeutet, daß das für die neoklassische Theorie paradoxe Ergebnis vollkommen erhalten bleibt: Berücksichtigte man, wie es eigentlich unumgänglich ist, den Trend der Produktivität „vor der Zeit" steigender Arbeitslosigkeit zur Beurteilung des „Drucks", der von den Reallöhnen ausging, ist die Lohnzurückhaltung in Frankreich im Vergleich zu den USA noch ausgeprägter als ohne diese Bereinigung.
Warum gilt das neoklassische Muster nicht, obgleich die Theorie doch auf den ersten Blick doch so einleuchtend erscheint? Die Antwort ist einfach. Die neoklassische Theorie ist nicht nur, wie Schumpeter feststellt, „streng statisch in ihrem Charakter, sondern auch ausschließlich auf einen stationären Prozeß anwendbar", wobei ein stationärer Prozeß nach Schumpeter ein Prozeß ist, „der sich tatsächlich nicht aus eigenem Antrieb verwandelt, sondern nur konstante Raten des Realeinkommens im Zeitablauf reproduziert". [Fn.22: J.A. Schumpeter, (1954), S. XXII.]
[Seite der Druckausgabe: 41]
Folglich ist bei der Grenzproduktivitätstheorie, die die theoretische Basis der neoklassischen Überlegungen bildet, die reale Produktion bzw. das Einkommen per Annahme immer schon gegeben. Nur in diesem gegebenen Rahmen entscheidet der neoklassische „Unternehmer", ob er Arbeitskräfte einstellt oder nicht. Nur in einem solchen System muß man „wählen" zwischen Beschäftigung und Lohneinkommen. Das wichtigste Moment, das eine dispositive Arbeit zur unternehmerischen Arbeit und eine Wirtschaft zur Marktwirtschaft macht, nämlich die Offenheit des Prozesses für eine Mengendynamik, die von günstigen makroökonomischen Bedingungen ausgelöst wird, fehlt. Damit fehlt auch die spezifische Art von Unsicherheit, die für ein marktwirtschaftliches System das unternehmerische Handeln, die Bereitschaft, Risiken einzugehen, so unentbehrlich macht.
1.7 Die Gewinnthese
Weniger eindeutig auf der neoklassischen Theorie baut die hier als Gewinnthese bezeichnete Argumentation auf, die zur gleichen lohnpolitischen Empfehlung im Hinblick auf den Abbau der Arbeitslosigkeit gelangt wie die Substitutionsthese. [Fn.23: Streng genommen ist die Gewinnthese nicht aus der neoklassischen Theorie ableitbar, weil sie einen Umstand voraussetzt, den es im neoklassischen Modell nicht gibt: Gewinne. Im neoklassischen Modell herrscht vollständige Konkurrenz, so daß über die Zinskosten hinausgehende Gewinne im engeren Sinne umgehend wegkonkurriert werden, also gar nicht anfallen.] Sie versucht, eines der empirischen Mankos der Substitutionsthese zu umgehen, das in der ausgesprochen parallelen Entwicklung von Investitionen und Beschäftigung besteht. Die Gewinnthese geht davon aus, daß zur Finanzierung von Investitionen Gewinne entstanden sein müssen. Bei gegebenem Absatz fallen die Gewinne definitionsgemäß um so höher aus, je niedriger die Produktionskosten, namentlich die Löhne sind. Zum Finanzierungscharakter der Gewinne hinzu kommt ihr Einfluß auf die Erwartungshaltung der Unternehmer: Je höhere Gewinne sie machen oder zumindest erwarten, desto bereitwilliger investieren sie. Und daß Investitionen zu mehr Beschäftigung führen, ist wie gesagt empirisch gut belegt. Daher lautet die tarifpolitische Empfehlung, die sich aus der Gewinnthese herleitet: Lohnzurückhaltung, also Umverteilung zugunsten der Gewinneinkommen, bis eine so starke Investitionstätigkeit in Gang gekommen ist, daß die Arbeitslosigkeit weitgehend abgebaut ist.
Die Gewinnthese steht in krassem Gegensatz zur Substitutionsthese, weil sie einen positiven, also komplementären Zusammenhang zwischen Kapital- und Arbeitseinsatz anerkennt und gerade keinen substitutiven. Daran ändert auch das Zugeständnis diverser Lagstrukturen in
[Seite der Druckausgabe: 42]
beiden Thesen nichts. Die Substitutionsthese zielt auf eine kurz- bis mittelfristige Verlangsamung des Wachstums der Arbeitsproduktivität ab, die Gewinnthese auf eine zumindest kurzfristige Beschleunigung. Für die Substitutionsthese spielt das Faktorpreisverhältnis die ausschlaggebende Rolle, bei der Gewinnthese geht es um die Verteilung von Lohn- und Gewinneinkommen. Das ist aus neoklassischer Sicht im Falle von Vollbeschäftigung aller Produktionsfaktoren zwar dasselbe, weil sich Grenzproduktivitäten, Faktorpreise und Lohnquote entsprechen. Bei Unterbeschäftigung gilt das jedoch nicht. Während aus Sicht der Gewinnthese zur Verringerung der Arbeitslosigkeit eine Senkung der Lohnquote bei nicht rückläufiger Produktion erforderlich ist, kann die Lohnquote aus Sicht der Substitutionsthese konstant bleiben. Auch die Erwartungsbildung der Unternehmer wird durch die Lohnzurückhaltung unterschiedlich beeinflußt: im Falle der Substitutionsthese dahingehend, daß der Einsatz des Faktors Arbeit für relativ lohnender gehalten wird als zuvor; im Falle der Gewinntheorie nimmt zunächst die Attraktivität des Kapitaleinsatzes zu.
Im Lichte des oben vorgestellten neoklassischen Modells und des Versuchs, es unter Berücksichtigung einer gesamtwirtschaftlichen Budgetrestriktion, der Quantitätsgleichung, zu interpretieren, wurde die mangelnde logische Fundierung der Gewinnthese bereits angedeutet. Die Gewinnthese baut auf einen Umverteilungsmechanismus bei den Faktoreinkommen, der ebenso wenig funktioniert wie die Kaufkrafttheorie des Lohnes. Der Grund dafür liegt in der Wachstumsschranke, die jeder monetären Volkswirtschaft durch die reale Geldmenge gesetzt ist. Umverteilungsversuche von Seiten der Arbeitnehmer, Lohnsteigerungen oberhalb von Produktivitätsentwicklung und Zielinflationsrate durchzusetzen, enden in Inflation und - nach entsprechender geldpolitischer Reaktion - in Arbeitslosigkeit. Das gleiche gilt aber ebenso für Umverteilungsversuche von Seiten der Unternehmer. Versuchen sie, Preissteigerungen oberhalb der Zielinflationsrate durchzusetzen, sorgt eine entsprechende geldpolitische Restriktion für die Dämpfung des Wirtschaftswachstums, die eine Steigerung der Gewinne verhindert.
Die Vorschläge, die Gewinne nicht durch Preissteigerungen, sondern durch Lohnzurückhaltung zu erreichen, scheinen auf den ersten Blick einen Ausweg aus diesem Dilemma zu bieten, fordern sie doch gerade keinen restriktiven Kurs der Geldpolitik heraus. Bei genauerem Hinsehen stellt sich aber heraus, daß diese lohnpolitische Strategie bestenfalls beschäftigungsneutral, nicht aber -steigernd ist. Für den Fall, daß die Kostenentlastung der Unternehmen durch Lohnzurückhaltung in den Preisen weitergegeben wird, handelt es sich um das oben beschriebene 'monetary management by the trade unions' (vgl. Abschnitt 1.4). Eine Ausweitung der realen Geldmenge und damit der realen Nachfrage wird bei gleichbleibender Geldpolitik durch eine Senkung (bzw. langsamere Steigerung) des Preisniveaus erreicht. Auf die damit verbundenen Gefahren einer deflationären Entwicklung braucht hier nicht erneut
[Seite der Druckausgabe: 43]
eingegangen zu werden. Interessant ist im Zusammenhang mit der Gewinnthese lediglich, daß die Gewinne nur im Umfang der realen Nachfrage steigen, d.h. die Gewinnquote konstant bleibt. Denn der Stückgewinn nimmt bei gleichermaßen sinkenden Stückkosten wie Stückpreisen nicht zu. Es kommt also gar nicht zu einer Umverteilung zugunsten der Gewinneinkommen. Der Beschäftigungszuwachs kann demzufolge auch nicht darauf zurückgeführt werden.
Sieht man von diesem - von den Vertretern der Gewinnthese nicht in erster Linie intendierten - Mechanismus bei starkem Wettbewerb auf den Gütermärkten ab, bleibt der Fall, in dem die Preise nicht, zumindest nicht im gleichen Ausmaß fallen wie die Nominallöhne. Eine solche, woher bei konjunkturbedingt schlechter Auslastung auch immer stammende Rigidität der Absatzpreise verwandelt die Nominallohnsenkung in eine Reallohnsenkung. Da die gesamtwirtschaftliche Budgetrestriktion permanent gilt, kann die reale Geldmenge - gleiche Geldpolitik vorausgesetzt - nicht schneller wachsen als zuvor. Damit nimmt auch die reale Nachfrage nicht rascher zu. Zusätzliche Beschäftigung für eine zusätzliche Produktion ist insofern nicht erforderlich, es kommt nicht zu einem Abbau der Arbeitslosigkeit. Sollte die Nachfrage immerhin konstant geblieben sein (was, wie noch zu erläutern ist, nicht der Fall sein muß), ist der einzige Effekt, daß tatsächlich eine Umverteilung zwischen den Faktoreinkommen stattgefunden hat, das Realeinkommen der Lohneinkommensbezieher gesunken und das der Gewin-neinkommensbezieher gestiegen ist.
Die Argumentation über die durch die Umverteilung nicht stärker wachsende reale Geldmenge und die damit bestenfalls unveränderte Nachfrage- und Beschäftigungsentwicklung ist recht abstrakt und wenig intuitiv einleuchtend. Es soll daher noch einmal andersherum, nämlich direkt über die Nachfrage der privaten Haushalte, der Unternehmen als Investitionsgüternachfrager, des Staates und des Auslands erläutert werden, weshalb es allein durch Umverteilung zugunsten der Gewinne nicht automatisch zu mehr Beschäftigung kommen muß. Die Ausgangssituation ist von Arbeitslosigkeit und schwacher Investitionstätigkeit bzw. im Hinblick auf den Arbeitsmarkt „zu schwachem" Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Die Kapazitätsauslastung der Unternehmen ist unterdurchschnittlich. Die Idee einer Lohnzurückhaltung ist, die Gewinnerwartungen zu steigern, dadurch die Investitionen anzuregen und so Beschäftigung zu schaffen.
Könnten die Unternehmer sicher sein, daß die von ihnen erwartete Nachfrageentwicklung unabhängig von der Nominal- bzw. Reallohnentwicklung ist, bedeutete Lohnzurückhaltung automatisch Gewinnsteigerung. Denn pro Stück verdienten sie mehr, und die Stückzahl bliebe dieselbe. Das könnte sie zu mehr Investitionen bewegen, insbesondere wenn die Lohnent-
[Seite der Druckausgabe: 44]
wicklung glaubwürdig als mittel- bis langfristig zurückhaltend angekündigt ist. Doch warum sollte die Nachfrage nicht auf die Lohnentwicklung reagieren?
Die Nachfrage der privaten Haushalte dürfte auf die Realeinkommenseinbuße hin zurückgehen bzw. langsamer steigen als erwartet. Sollte versucht werden, den bisherigen Konsum durch eine Senkung der Sparquote aufrechtzuerhalten, verursacht das geringere Kapitalangebot am Kapitalmarkt eine Zinssteigerung, die tendenziell investitionsdämpfend wirkt. Der Gesamteffekt ist zumindest offen. Häufig wird eingewendet, daß, was den Beziehern von Lohneinkommen real verloren gehe, die Bezieher von Gewinneinkommen erhielten, und insofern mit keinem Rückgang des privaten Verbrauchs zu rechnen sei. Dem ist zwar entgegenzu-halten, daß die Sparquoten beider Haushaltstypen unterschiedlich sein dürften, nämlich die der Gewinneinkommensbezieher tendenziell höher. Doch ließe sich mit gleichem Recht wie oben daraus ein zinssenkender und investitionssteigernder Effekt am Kapitalmarkt ableiten. In einer Volkswirtschaft, die durch eine dynamische Entwicklung im schumpeterianischen Sinne und das Vorherrschen objektiver Unsicherheit gekennzeichnet ist, ist das Hauptargument gegen die Konstanz des privaten Verbrauchs ein anderes: Gewinneinkommen sind in einer solchen Welt residuale Einkommen, d.h., ihre Bezieher wissen, anders als die Lohneinkommensbezieher mit ihren kontraktbestimmten Einkommen, am Anfang einer Planungsperiode nicht, wie hoch ihr Einkommen am Ende der Periode sein wird. Es ist daher nicht zu erwarten, daß sie allein im Vertrauen auf steigende Gewinne durch Lohnzurückhaltung vorab höhere Konsumausgaben tätigen. Die Konsumausgaben der Gewinneinkommensbezieher müßten zudem beträchtlich über ihren bisherigen liegen, um den Nachfrageausfall von Seiten der Lohneinkommensbezieher zu kompensieren, weil der Anteil der Lohneinkommen an den Gesamteinkommen sehr hoch ist.
Wenn die Stabilisierung der Gesamtnachfrage bei Lohnzurückhaltung durch die Konsumausgaben der Gewinneinkommensbezieher zumindest als unsicher angesehen werden muß, kann dann nicht die Investitionsnachfrage unmittelbar kompensierend wirken? Die Antwort ist wieder nicht eindeutig. Die Unternehmer erhalten von den Absatzmärkten der Endnachfrage wegen der Lohnentwicklung negative Signale. Sie müßten also allein in der Hoffnung auf höhere Gewinne durch Kostenentlastung ihre Kapazitäten ausweiten, um so selbst die Nachfrage zu schaffen, von deren Konstanz bzw. Steigerung die Sinnhaftigkeit, sprich Rentabilität ihrer Investitionen abhängt. Das ist angesichts unterausgelasteter Kapazitäten sehr unwahrscheinlich, wenn auch nicht ausgeschlossen. Warten die Unternehmer also zunächst einmal die Wirkung der Lohnzurückhaltung auf ihre Gewinne ab, dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu genau den negativen Absatzsignalen kommen, die sie in ihrer Investitionszurückhaltung bestätigen. Dann aber bleibt die Nachfrage nicht konstant, sie sinkt vielmehr. Von
[Seite der Druckausgabe: 45]
einer Beschäftigungsausweitung kann nicht die Rede sein, es kommt statt dessen zu Entlassungen.
Neben den Nachfrageausfall von Seiten der privaten Haushalte mag zwar kurzfristig eine Nachfrageausweitung aus dem Ausland treten, falls sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit infolge der Lohnzurückhaltung verbessert und das Ausland höhere Leistungsbilanzdefizite hinnimmt. Weil es zu dieser Nachfrageausweitung aus dem Ausland im vergangenen Jahr kam, sind die Gewinne der exportierenden Unternehmen und ihrer Vorleister zuletzt kräftig gestiegen. Dieser Effekt überlagert die negativen Wirkungen von Seiten der Binnennachfrage. Die Gewinnsteigerung der Exportunternehmen sagt aber genau deswegen nichts darüber aus, wie sich die Gewinnsituation bei einer anderen Lohnpolitik entwickelt hätte. Der positive Effekt von der Auslandsnachfrage vermag die ausgefallene Inlandsnachfrage in der Regel nicht aufzuwiegen, weil das Gewicht der Auslandsnachfrage im Vergleich zur Inlandsnachfrage schon in Volkswirtschaften wie Westdeutschland, insbesondere aber in Europa insgesamt oder den USA zu gering ist. Folglich wird sich die Gewinnsituation in einem großen Industrieland bei Reallohnzurückhaltung oder gar eine Reallohnsenkung verschlechtern. Bei einer produkti-vitätsorientierten Lohnpolitik stünden sich aller Voraussicht nach beide, Unternehmen und Arbeitnehmer, besser.
1.8 Lohnquote und realer Wechselkurs: Die lange Frist
Zwar gibt es keinen empirischen Nachweis einer länger anhaltenden Fehlentwicklung bei den Reallöhnen in Deutschland und Europa. Dennoch wird in der Debatte um die angemessene Lohnpolitik behauptet, ein Zurückbleiben der Reallöhne hinter der Produktivität sei bei Unterbeschäftigung auf jeden Fall, also unabhängig von den die Arbeitslosigkeit auslösenden Schocks einzufordern. [Fn.15: Vgl. Siebert: (1998a), S. 15.]
Die sog. „produktivitätsorientierte Lohnpolitik", die das DIW vertritt, d.h. eine Übereinstimmung von Produktivitätsfortschritt und Reallohnzuwachs, sei folglich nur für eine Situation der Vollbeschäftigung angemessen. [Fn.25: Vgl. DIW (1998) und dort die Mehrheitsmeinung der Forschungsinstitute.] In einer unterbeschäftigten Volkswirtschaft müsse der Reallohnanstieg hinter dem Produktivitätsanstieg zurückbleiben, wenn man Arbeitslosigkeit abbauen will". Eine solche Therapie wäre ohne weiteres vertretbar, wenn die Diagnose zuvor gezeigt hat, daß tatsächlich „hochlohnbedingte" Arbeitslosigkeit vorliegt, also die Unterbeschäftigung Folge zu stark gestiegener Reallöhne ist. Weder
[Seite der Druckausgabe: 46]
einen Befund, noch überhaupt einen Versuch in dieser Richtung findet man bei Vertretern der Reallohnzurückhaltungsthese.
Diese These einer generellen Reallohnzurückhaltung - denkt man sie zu Ende - hat enorme Konsequenzen. Wenn die Reallöhne bei Unterbeschäftigung, ganz gleich welche Ursachen die Arbeitslosigkeit hat, immer hinter der Produktivitätszunahme zurückbleiben müssen, bei Vollbeschäftigung aber lediglich im „Ausmaß des Produktivitätsfortschritts" zunehmen dürfen, sinkt der Anteil der Arbeitnehmereinkommen am Volkseinkommen permanent. Bei Arbeitslosigkeit muß die Lohnquote nämlich nach dieser These sinken, bei Vollbeschäftigung muß sie konstant bleiben. Eine Empfehlung für die Lohnpolitik, die einen abnehmenden Trend der Lohnquote zur Folge hat, ist aber abwegig, weil am Ende selbst eine Lohnquote von Null nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Nur eine ins Absurde gesteigerte Vernachlässigung der Nachfrageseite einer Marktwirtschaft kann zu einer solchen Empfehlung führen. Alle Erfahrung und der Großteil der ökonomischen Theorien jenseits der Marxschen Verelendungsthese sprechen hingegen dafür, daß die sich am Markt ergebende funktionale Einkommensverteilung keinen Trend hat, sondern um einen relativ festen Wert schwankt.
Mit einer langfristig stabilen Lohnquote vereinbar ist dagegen eine Position, die „neoklassische Arbeitslosigkeit", also Arbeitslosigkeit, die mit einer kräftig, weil über die üblichen zyklischen Schwankungen hinaus gestiegenen Lohnquote einhergeht, mit Reallohnzurückhaltung bekämpfen will. Die Lohnquote muß dann so lange sinken, wie das „Ungleichgewicht" am Arbeitsmarkt besteht. Im Ergebnis wird die Lohnquote über Phasen der Arbeitslosigkeit und der Vollbeschäftigung hinweg konstant bleiben. Eine solche Position konnte man etwa Ende der siebziger Jahre für Westdeutschland mit einer gewissen Berechtigung vertreten, weil vorher die Arbeitseinkommens- und die Lohnquote stark gestiegen waren (Abbildung 7). Eine solche empirische Basis gibt es jetzt nicht mehr. Seit Beginn der achtziger Jahre ist die Arbeitseinkommensquote in Deutschland (und ganz Europa) fast durchgängig gefallen. [Fn.26: Vgl. DIW (1997), S. 847 ff.] In Westdeutschland hat sie 1997 den niedrigsten Stand in der Nachkriegsgeschichte erreicht und ist in den letzten Jahren auch während des Anstiegs der Arbeitslosigkeit kräftig zurückgegangen. Angesichts dieses Befundes kann es nur eine Schlußfolgerung geben: Die Arbeitslosigkeit, die in den neunziger Jahren in Westdeutschland entstanden ist, ist auf keinen Fall reallohnbedingt, also nicht vom Typ „neoklassische Arbeitslosigkeit", und kann folglich auch nicht durch Reallohnzurückhaltung beseitigt werden.
[Seite der Druckausgabe: 47]
Diese Erkenntnis hat enorme Bedeutung für das Verhalten der Gewerkschaften in der Zukunft. Bleibt der Reallohn auch künftig hinter dem Produktivitätszuwachs zurück, ist nicht damit zu rechnen, daß bei einem höheren Beschäftigungsstand die für Preisstabilität erforderliche Produktivitätsorientierung der Löhne eingefordert werden kann. Vielmehr dürften die Gewerkschaften versuchen, die Umverteilungsverluste in den vergangenen 20 Jahren durch höhere Lohnabschlüsse wieder auszugleichen. Geschieht das in Europa insgesamt, droht das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank verfehlt zu werden, da die Lohnstückkosten dann stärker steigen werden, als mit dem Inflationsziel der Zentralbank vereinbar. Die Notenbank wird darauf mit einer Restriktionspolitik antworten, die - wie in der Vergangenheit - die Investitionen in Sach- und in Humankapital vermindern und damit einen erneuten Anstieg der Arbeitslosigkeit nach sich ziehen wird.
Wie wichtig eine angemessene Diagnose für die Forderungen nach einem Zurückbleiben der Reallöhne in Westdeutschland ist, läßt sich am Beispiel Ostdeutschlands belegen. Hier war in der Tat der Lohnanpassungsprozeß zu schnell, die Reallöhne - gemessen an der Produktivität - zu hoch, und ein Korrekturbedarf im Sinne eines Zurückbleibens der Reallöhne hinter der Produktivität ist nicht zu bestreiten. In Ostdeutschland ist die Quote der Arbeitseinkommen am Volkseinkommen zu Beginn des Vereinigungsprozesses rasch nach oben geschossen und damit weit über das Niveau hinaus, das in Marktwirtschaften tragfähig ist. Gemessen am Volkseinkommen wurden zeitweise über 100 % erreicht, der Unternehmenssektor insgesamt machte also Verluste. Seit 1993 ist zwar eine Korrektur eingetreten, doch müssen - gemessen am Maßstab Westdeutschlands - die Reallöhne immer noch als überhöht gelten. Folglich müssen hier die Reallöhne hinter dem Produktivitätsfortschritt zurückbleiben. Es ist aber fehl am Platz, für Westdeutschland die gleiche Therapie wie für Ostdeutschland zu fordern (Abbildung 15).
[Seite der Druckausgabe: 48]

[Seite der Druckausgabe: 49]
Der Reallohnzurückhaltungsthese ist aus einem zweiten Grund zu widersprechen. Eine einzelne Volkswirtschaft kann nicht permanent an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, andere nicht permanent verlieren. Technisch ausgedrückt: Ebensowenig wie die Lohnquote kann der reale Wechselkurs einer autonomen Region oder einer eigenständigen Volkswirtschaft einen ab- oder aufwärtsgerichteten Trend aufweisen. Auch hier führt die These der Reallohnzurückhaltung, insbesondere in der EWU, zu abwegigen Ergebnissen.
Es ist unbestritten, daß in der EWU der Wechselkurs als Puffer entfällt und die Löhne seine Funktion als Schockabsorber in den Fällen übernehmen müssen, in denen eine Volkswirtschaft preisliche Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen muß. [Fn. 27: Vgl. Siebert: (1998 b).] Wenn also eine Volkswirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit durch zu stark steigende Lohnstückkosten verloren hat (reale Aufwertung), muß sie in der Tat Lohnzurückhaltung üben (reale Abwertung), und alle Handelspartner müssen das im Sinne einer Nicht-Reaktion akzeptieren, will die zurückgefallene Volkswirtschaft das einmal verlorene Terrain wiedergewinnen. Über die Phasen des Verlustes und des Gewinns an Wettbewerbsfähigkeit hinweg entsprechen sich „Arbeitskosten" und „Arbeitsproduktivität", der reale Wechselkurs bleibt langfristig konstant. Dies soll - nimmt man die These von der Reallohnzurückhaltung zum Maßstab - nicht für die Verhältnisse in der Europäischen Währungsunion gelten. Obwohl die westdeutsche Wirtschaft hier nachweislich nie an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat, sondern bei den Lohnstückkosten sogar besser abschnitt als die Partner, die ihre Wechselkurse lange Zeit nicht geändert hatten (Abbildung 15), wird jetzt empfohlen, die deutschen Lohnstückkosten müßten in der Währungsunion zurückbleiben, um die Wettbewerbsposition Deutschlands zu verbessern.
[Seite der Druckausgabe: 50]
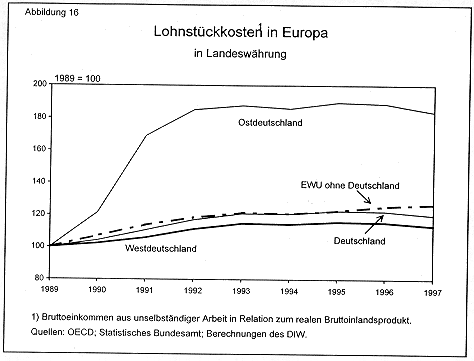
Diese Forderung - nämlich real abzuwerten, ohne vorher aufgewertet zu haben - verstößt gegen das zentrale Prinzip, das der Theorie des Freihandels von jeher zugrundegelegen hat:
Freier Handel unter Volkswirtschaften gleicher Entwicklungsstufe ist nur möglich, wenn es keinem der beteiligten Handelspartner gelingt, permanent Marktanteile zu gewinnen. Das ist nur bei langfristig konstantem realen Wechselkurs möglich. [ Fn.28: Nur um die Frage, ob der reale Wechselkurs einen Trend haben kann, geht es bei der aktuellen Lohndiskussion. Deswegen ist es nichts anderes als der Versuch, vom eigentlichen Thema abzulenken, wenn immer wieder behauptet wird, diejenigen, die vor Abwertungen als Mittel der Wirtschaftspolitik warnen, unterstellten, der Freihandel sei generell ein Nullsummenspiel. Es geht nur um Abwertungswettläufe, die zwingend Nullsummenspiele sind.] Marktanteile langfristig gewinnen können und sollen lediglich Länder, die gegenüber den Ländern an der Spitze der Einkommenspyramide noch zurückliegen, da sonst Aufholen unmöglich wäre.
Wenn ein großes und reiches Land wie Deutschland eine Politik der realen Abwertung betreibt, sind früher oder später die Partner in der Währungsunion gezwungen, ihre reale Auf-
[Seite der Druckausgabe: 51]
wertung durch eine Lohnsenkung zu beenden, schließt man realistischerweise groß angelegte Transfermechanismen in Europa aus. In allen Ländern würden dann die Lohnstückkosten sinken müssen. Das aber wäre eine gefährliche Option für Europa insgesamt. Sie bringt die Gefahr einer Deflation für ganz Europa mit sich, ohne daß sie Vorteile hätte, die nicht mit stabilen oder leicht steigenden Lohnstückkosten bei einer angemessenen Geldpolitik zu erzielen wären.
Daß auch im Bereich der Währungsrelationen nur Ursachentherapie eine angemessene Antwort auf Fehlentwicklungen ist, läßt sich wiederum am Beispiel Ostdeutschlands zeigen. Hier hat es, wie die Entwicklung der Lohnstückkosten belegt (Abbildung 16), eine dramatische Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit gegeben. Diese muß, wenn die neuen Länder von Transferzahlungen des Westens unabhängig werden wollen, korrigiert werden. Folglich müssen die Lohnstückkosten sinken oder weiter weniger stark steigen als in Westdeutschland und im Rest der EWU. Die ostdeutsche Wirtschaft wertet dann real ab, der Westen real auf; Ostdeutschland gewinnt und der Westen verliert Marktanteile. Dies wird ebenfalls von den Vertretern der These, Lohnzurückhaltung sei auch im Westen notwendig, konstatiert. Es ist aber schlicht inkonsistent, dies für beide Teile Deutschlands zu fordern. Das Referenzsystem, auf dem solche Forderungen basieren, kann nicht das einfache Vorurteil „wenn Arbeitslosigkeit herrscht, sind die Löhne zu hoch" sein, sondern nur eine ursachenorientierte Diagnose in Verbindung mit einer ursachenadäquaten Therapie, die mit einer langfristig konstanten Lohnquote und einem langfristig konstanten realen Wechselkurs vereinbar ist.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Oktober 1999