

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
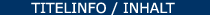
TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausgabe: 9 / Fortsetzung]
3.1 Technische Daten
Beim Transrapid handelt es sich wie bei der herkömmlichen Rad/Schiene-Technik um ein spurgeführtes Verkehrssystem. Das System kann sowohl auf Stelzen als auch ebenerdig und bei Bedarf in Tunnellage geführt werden. Unstrittige Vorteile gegenüber den traditionellen Techniken ergeben sich durch flexiblere Trassierungsmöglichkeiten, indem auch relativ starke Steigungen in Kauf genommen werden können, und durch den auf das berührungslose Schweben zurückzuführenden geringeren Verschleiß.
Als herausragender Vorteil der Magnetschwebetechnik wird darüber hinaus immer wieder die mit diesem System erreichbare Geschwindigkeit von bis zu 500 km/h bei
[Seite der Druckausgabe: 10]
einem gleichzeitig deutlich besseren Beschleunigungs- und Bremsvermögen hervorgehoben. Für den täglichen Betrieb sind auf freier Strecke Geschwindigkeiten von über 400 km/h vorgesehen, womit die bisher üblichen Geschwindigkeiten im Rad/Schiene-System von 270 km/h beim ICE der Deutschen Bahn AG bzw. von 300 km/h beim französischen TGV deutlich übertroffen werden. Auch innerhalb von Ballungsgebieten sollen problemlos höhere Geschwindigkeiten gefahren werden können als bisher: Während U-Bahnen mit etwa 60 km/h, S-Bahnen mit rund 80km/h und Fernbahnen mit 100 km/h ohne Schutzvorkehrungen wie z.B. Schallschutzwänden betrieben werden, beabsichtigt man mit dem Transrapid im Bereich der Ballungsgebiete mit einem Tempo von 200 km/h zu fahren, ohne daß Schutzmaßnahmen gegen Schall oder Erschütterungen erforderlich wären.
Bei den geplanten Geschwindigkeiten gibt es angeblich weder in der freien Fläche noch in besiedelten Bereichen Probleme mit den in entsprechenden Richtlinien, wie z.B. der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung (16. BImschV), festgelegten Grenzwerten. Tatsächlich liegen die Lärmwerte des Transrapid bei gleichen Geschwindigkeiten deutlich unterhalb derer des ICE. Dieser Vergleich ist allerdings insofern unzutreffend, als im Alltagsbetrieb von unterschiedlichen Geschwindigkeiten der beiden Verkehrssysteme ausgegangen werden muß. Für einen realen Vergleich müßte der Transrapid mit 400 km/h dem ICE mit 270 km/h gegenübergestellt werden. In diesem Fall ist der ICE um 5 bis 7 dB(A) leiser als der Transrapid, der sich nur im unteren Geschwindigkeitsbereich, d.h. bis 200 km/h, durch günstige Lärmwerte auszeichnet. In einem höheren Geschwindigkeitsbereich nimmt die Lärmentwicklung jedoch weniger akzeptable Größenordnungen an. Ab einer Geschwindigkeit von 300 km/h ergeben sich Lärmwerte von 86,5 dB(A). Bei noch höheren Geschwindigkeiten entspricht die Lärmentwicklung schließlich dem Lärmpegel von Düsenjets. Damit ist der Transrapid, der in einer Taktfolge von 10 Minuten verkehren soll, von den Lärmemissionen her eindeutig negativ zu beurteilen.
Ein anderes zugunsten des Transrapid angeführtes Argument ist die im Vergleich zu anderen Verkehrssystemen scheinbar günstige Energiebilanz. Dieser Behauptung wurde allerdings u.a. vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesminister für Verkehr kritisch entgegengetreten, da aufgrund unterschiedlicher Zugausstattungen keine akzeptablen Vergleichsbedingungen gewährleistet waren. Während der ICE z.B. inclusive Speisewagen geführt wurde, blieb diese Serviceeinheit beim Transrapid zunächst unberücksichtigt, zumal die Reisedauer zwischen Hamburg und Berlin auf maximal eine Stunde begrenzt bleiben sollte. Wörtlich heißt es diesbezüglich
[Seite der Druckausgabe: 11]
beim Wissenschaftlichen Beirat: .Bei Herstellung korrekter Vergleichsbedingungen (Anordnung und Anzahl der Sitzplätze, technische Ausführung der Innenausstattung, Verzicht auf Speisewagen) vermindert sich allerdings der energiewirtschafftiche Vorteil der Magnetbahn gegenüber dem ICE. Bei Geschwindigkeiten oberhalb von 300 km/h ist allein der von Querschnittsfläche und Zugform abhängige Luftwiderstand maßgebend. Auch muß berücksichtigt werden, daß Systemwechsel und die notwendigen Anbindungsverkehre zusätzlichen Energieaufwand erfordern" [Fn. 1: Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminister für Verkehr: „Die Magnetschnellbahn ist noch nicht marktreif". In: Internationales Verkehrswesen 44 (1992), 7. / 8. Heft, S.276.]
In aktuelleren Energievergleichen ist diese Kritik inzwischen berücksichtigt und die Werte sind entsprechend korrigiert. Von der DB AG stammt ein auf wissenschaftlichen Berechnungen basierender Vergleich, bei dem der jeweilige Energieverbrauch auf Liter Benzin pro 1CO Personenkilometer umgerechnet wurde. Demzufolge verbraucht der ICE in Deutschland im Gesamtnetz, d.h. auf seine gesamte Streckenlänge bezogen, bei der tatsächlich bis heute erreichten Auslastung von 47% ganze 2,5 l/100 Pkm. Der französische TGV kommt aufgrund seiner leichteren Bauweise sogar mit 1,6 l/100 Pkm aus und hat infolge eines differenzierteren Marketingsystemes eine wesentlich höhere Auslastung (65%).
Bei einem Vergleich mit den entsprechenden Werten eines Personenkraftwagens werden deutlich schlechtere Werte erreicht: Ausgehend von einem Mix aller möglichen Typen von Personenwagen und einem Besetzungsgrad von durchschnittlich 1,7 Personen pro Auto errechnet sich ein Wert von etwa 6,0 l/100 Pkm. Noch ungünstiger ist der Energieverbrauch beim Flugzeug, der jedoch in Abhängigkeit von der geflogenen Entfernung variiert: Ein Airbus A 300 benötigt auf der Kurzstrecke von Stuttgart nach Frankfurt demnach 10,5 l/100 Pkm, und auf dem Flug von Hamburg nach München 6,7 l/100 Pkm. Bei einem Flug von Hamburg nach Berlin würde sich mit einem zu 60% ausgelasteten Airbus A 320 ein Wert von 9,5 l/100 Pkm ergeben.
Der Transrapid kommt im Vergleich dazu bei einer Auslastung von 50% auf 3,2 l/100 Pkm, und bei einer Auslastung von 70%, die angesichts der vom TGV erreichten Auslastung von 65% allerdings als sehr günstig angenommen erscheint, auf 2,3 l/100 Pkm. Zugleich muß aber berücksichtigt werden, daß es sehr wohl möglich ist, auch beim ICE noch eine deutliche Gewichtsreduzierung und damit eine
[Seite der Druckausgabe: 12]
Energieeinsparung zu erreichen. Rein theoretisch lassen sich der Primärenergieverbrauch pro Sitzplatz und die zugehörigen Schadstoffemissionen beim ICE um etwa 30 bis 40% senken, womit der stoffliche und energetische Ressourcenverbrauch erheblich reduziert wäre. Für den in der Entwicklung befindlichen ICE 3 gibt die DB AG auf der Basis des ehrgeizigen Zieles einer Auslastung von 65% bereits einen Zielwert von 1,85 l/100 Pkm an.
|
Verkehrssystem |
Randbedingungen |
Energieverbrauch (in Liter Benzin pro 100 Pkm) |
|
TGV |
65% Auslastung |
1,6 |
|
ICE |
47% Auslastung |
2,5 |
|
bei Energieeinsparung um 30-40% durch Gewichtsreduzierung |
1,75-1,5 |
|
|
ICE 3 (geplant) |
65% Auslastung |
1,85 |
|
Transrapid |
50% Auslastung |
3,2 |
|
70% Auslastung |
2,3 |
|
|
Pkw |
1,7Pers./Kfz |
6,0 |
|
Flugzeug |
Distanz Hamburg - München |
6,7 |
|
Distanz Hamburg - Berlin (60% Auslastung) |
9,5 |
|
|
Kurzstrecke Frankfurt - Stuttgart |
10,5 |
Tab. 1: Energievergleich (Benzinverbrauch pro 100 Pkm)
3.2 Historischer Überblick
Obwohl das erste Patent für eine Magnetschwebebahn bereits im Jahre 1934 angemeldet wurde, gab die Bundesregierung die Prüfung eines solchen Verkehrssystems erst 1969 in Auftrag. Damals glaubte man, mit der herkömmlichen Rad/Schiene-Technik keine wesentlich höheren Geschwindigkeiten als 250 km/h erreichen zu können, deshalb erschien die Entwicklung einer Magnetbahn aufgrund ihrer überlegenen Geschwindigkeit besonders interessant. Federführend für dieses Projekt war zunächst das Bundesministerium für Verkehr (BMV).
[Seite der Druckausgabe: 13]
Im Jahr 1977 entschied sich dann das damalige Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) für die Entwicklung des Transrapid und für seine Förderung bis zur technischen Einsatzreife, und zwei Jahre später konnte auf der Verkehrsausstellung in Hamburg erstmals ein Transrapid der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Einen weiteren wichtigen Schritt für die Entwicklung und Erprobung des Magnetschwebezuges bedeutete die Fertigstellung einer rund 30 km langen Versuchsstrecke im Emsland, die 1984 erfolgte. Auf dieser Strecke erreichte der Transrapid 1993 eine Geschwindigkeit von 450 km/h. Trotz solcher Erfolge verabschiedete sich das Bundesministerium für Verkehr (BMV) in den 80er Jahren explizit vom Transrapid und betrieb - wie auch das übrige Europa - seine Wegeplanungen für die konventionelle Rad-/Schiene-Technologie.
Bis heute sind noch nicht alle Einzelheiten des technischen Betriebes einer Magnetschwebebahn abschließend geklärt. Trotzdem wurde dem Transrapid im Jahr 1991 die „uneingeschränkte technische Einsatzreife" bescheinigt. Obwohl sich der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister für Verkehr damals in einem kritischen Kommentar äußerte, wurde Anfang der 90er Jahre begonnen, nach verkehrswirtschaftlichen Einsatzfeldern in dem inzwischen anders verplanten verkehrswirtschaftlichen Umfeld - konventionelle Hochgeschwindigkeitsnetze - zu suchen. Aus den in diesem Kontext diskutierten Anwendungsstrecken hat sich das Bundeskabinett für die Strecke zwischen Hamburg und Berlin entschieden, deren Bau im März 1994 beschlossen wurde, obwohl der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister für Verkehr zuvor erneut mit den „Anmerkungen zum Betreiber- und Finanzierungskonzept der Magnetbahn Transrapid" eindringliche Warnungen vor unüberschaubaren finanziellen Risiken ausgesprochen hatte.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Januar 2001