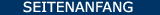![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 70]
6. Der Blickwinkel der Flüchtlinge
6.1 Vorstellung der Interviewpartnerinnen und -partner
Die vorangehenden Abschnitte 1-5 spiegeln bereits Erfahrungen und Wissen unserer Interviewpartnerinnen und -partner aus dem Kreis der Fluchtmigranten und ihrer Selbstorganisationen. Vorrangig allerdings bündeln sie das Expertenwissen inländischer Akteure in Bürgerschaft, Verbänden und Kommune.
Im nun folgenden Abschnitt 6 wird zusammengefasst, was Flüchtlinge im Rahmen biografisch angelegter (mehrstündiger) Intensivinterviews mitgeteilt haben [Vgl. ausführlich: Kühne, P. u. Rüßler, H. 2000: 436 ff.]. Sie äußerten sich zu Herkunft, erfahrener Bildung und beruflichen Erfahrungen, zu den politisch-soziale „Verhältnisse„ im Herkunftsland, zu katastrophischen zur Flucht nötigenden Zuspitzungen der Verhältnisse, zu Aufnahmebedingungen und Integrationschancen in der Bundesrepublik Deutschland und zu Perspektiven für Arbeit, Leben und gesellschaftliche Beteiligung hier. [Die methodische Präferenz biographisch angelegter Intensivinterviews entsprach erstens den norma tiven Implikationen der Studie. Fluchtmigranten sollten nicht nur als – mehr oder weniger – passiv Befragte in Erscheinung treten, sondern als Dialogpartner, die ihrerseits den Verlauf der Gespräche mitbestimmen, eigene Schwerpunkte setzen und damit auch solche Problemlagen ansprechen können, die für sie von existenzieller Bedeutung sind, die ohne ihr Zutun aber gar nicht erfragt worden wären. Aus einem derart angelegten Dialog und seinen vielfältigen Überraschungselementen versprachen wir uns zweitens einen höheren Erkennt nisgewinn. Der gewählte methodische Zugang würde es erlauben, Details durch Nachfrage um fassender zu ermitteln, Miss ver ständnisse möglichst auszuschließen, Hintergründe besser aus zuleuchten, Einstellungen und Befindlichkeiten nachhaltiger zu ergründen. Drittens lag uns daran, Flucht migranten nicht nur als Angehörige abstrakter statistischer Kategorien sondern als Personen mit ihrem jeweiligen individuellen Profil und in ihrer jeweils indi viduellen Notlage vorzustellen. Dies, so hoff ten wir, würde den Eindruck auf die Leserinnen und Leser unserer Untersu chung nicht verfehlen.]
Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner orientierte sich an folgenden Kriterien:
- Um Prozesse sozialer Integration in der Bundesrepublik Deutschland nachvollziehen zu können, sollten es Flüchtlinge sein, die sich bereits für einige Zeit (mindestens zwei Jahre) in der Bundesrepublik aufhalten.
- Es sollten Fluchtmigranten aller Statusgruppen der von uns gezeigten Statushierarchie sein, also Kontingentflüchtlinge, Asylberechtigte gem. GG, Flüchtlinge mit kleinem Asyl, Bürgerkriegs- und (subsidiär geschützte) De-facto-Flüchtlinge, Asylbewerber im Verfahren und zur Ausreise Verpflichtete.
- Die quantitativ asylrelevantesten Herkunftsländer sollten auf jeden Fall Berücksichtigung finden.
- Es sollte ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter und Alterskategorien erzielt werden.
- Menschen im Kirchenasyl sollten miteinbezogen sein.
Bei der Bestimmung asylrelevanter Herkunftsländer wurde getrennt nach gesetzlichen Aufnahmebedingungen verfahren. Bezogen auf Kontingentflüchtlinge ließen sich schnell zwei aktuelle Herkunftsländer: Moldawien und Ukraine, identifizieren. Bezogen auf Bürgerkriegsflüchtlinge wurde Bosnien-Herzegowina als zeittypisch ausgewählt. Bezogen auf Asylmigranten wurde zunächst ein Auszug aus dem Ausländerzentralregister (AZR) für die Stadt Dortmund von 1996 veranlasst. Auf diese Weise konnten aus der Grundgesamtheit aller Herkunftsländer nicht-deutscher Zuwanderer in Dortmund 18 Hauptherkunftsländer ermittelt
[Seite der Druckausg.: 71]
werden. Aus diesen 18 Ländern wurden acht ausgewählt, die, aus Gründen anhaltender, äußerst zugespitzter Verhältnisse als in besonderer Weise asylrelevant angesehen werden konnten. Es handelte sich um Afghanistan, Iran, Jugoslawien (Kosovo), Libanon, Sri Lanka, Togo, Türkei (Kurdistan) und Zaire/Kongo. Hinzugenommen wurde Algerien, weil allein drei Fälle von Kirchenasyl in Dortmund (1995 bis 1997) algerische Fluchtmigranten betrafen. Insgesamt wurden Interviews mit 32 Partnerinnen und Partnern aus zwölf Herkunftsländern geführt, darunter 20 Asylsuchende, 6 Bürgerkriegs- und 6 Kontingentflüchtlinge.
Der Zugang zu den Interviewpartnern konnte schnell gefunden, das notwendige Vertrauen mit Hilfe vertrauenswürdiger Vermittler aufgebaut werden. In der Mehrzahl der Fälle war eine Verständigung in deutscher Sprache möglich. [Übermittelte Originalzitate wurden von uns orthographisch und grammatisch überarbeitet.] Ein Interview wurde in französischer Sprache geführt. In sieben Fällen war es notwendig, Dolmetscher heranzuziehen. Hierzu wurden von den Fluchtmigranten selbst Personen ihres Vertrauens benannt. [Der größere Teil der Interviews wurde mit einzelnen Fluchtmigrantinnen bzw. -migranten in Räumen der Universität, der Selbstorganisationen oder von Rechtsanwaltskanzleien geführt. Ein kleinerer Teil der Interviews, sofern nämlich mit Ehepartnern und ganzen Familien gesprochen wurde, konnte in den Unterkünften bzw. Wohnungen der Fluchtmigranten stattfinden. Ein Interview wurde an "neutralem Ort", in einem Innenstadt-Cafe, anberaumt.]
In allen Interviews konnten grundlegende Daten und Wendepunkte der jeweiligen Biographie ermittelt werden. Je nach Alter, Persönlichkeitsstruktur und Sprachkompetenz unserer Interviewpartnerinnen und -partner fielen die Interviews dennoch unterschiedlich aus, – zum Teil durchaus knapp, zum Teil äußerst assoziativ und mitteilsam. Auch waren – naturgemäß – die Biographien jugendlicher Interviewpartnerinnen und -partner schneller „abgehandelt„ als diejenigen der älteren. Knapper als andere gerieten auch solche Interviews, bei denen unsere Partnerinnen und Partner einen Spagat auszuhalten hatten: Einerseits wollten sie sich mitteilen, andererseits waren sie darauf bedacht, ihre Angehörigen sowie Freunde im Herkunftsland zu schützen. Umgekehrt stellten andere Fluchtmigranten ihre gesamte Verfahrensakte zur Verfügung, deren Stadien dann in die Rekonstruktion des Interviews einfließen konnten. Interviews, die konsekutiv übersetzt wurden, erreichten häufig ein zeitliches Limit, das – schon aus Gründen der Höflichkeit, aber auch, weil sich Erschöpfungserscheinungen einstellten – nicht überschritten werden konnte. Andererseits war es hier in dem einen oder anderen Fall möglich, einen zweiten Interviewtermin zu vereinbaren. Auch die räumlichen und situativen Umstände, unter denen die Interviews stattfanden, beeinflussten ihre Dauer und Intensität. Solche, die z.B. am Rande eines Gottesdienstes oder in einem dicht besetzten Innenstadt-Café durchgeführt werden mussten, fielen knapper aus als diejenigen, die im privaten Ambiente einer Familie, noch dazu begleitet von Zeichen der Gastfreundschaft (Kaffee, Tee, Gebäck oder sogar ein Mittagessen) gegeben wurden. Jüdische Kontingentflüchtlinge, denen sowohl traumatisierende Fluchterfahrungen als auch das zermürbende, über Jahre hin anhaltende Asylverfahren erspart blieben, konnten sich ganz auf ihre Arbeits- und Lebenssituation im Herkunftsland bzw. nunmehr: im Aufnahmeland konzentrieren und hierbei stärker ins Detail gehen, als dies bei Asylmigranten möglich war.
Auswertungsgrundlage waren die (teil-)verschriftlichten Interviews und, immer wieder, der Rekurs auf die originären Tonbandaufzeichnungen. Bei der Auswertung konzentrierten wir uns zunächst auf die Darstellung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse im jeweiligen Herkunftsland durch unsere Interviewpartnerinnen und -partner, und auf die damit verknüpften Problemlagen, Ängste und fluchtauslösenden Motive. Um das uns Mitgeteilte auch nur annähernd verstehen und deuten zu können, waren landeskundliche und politische Vorkenntnisse unverzichtbar; uns vorliegende, mittels Literatur- und Quellenstudien erarbeitete Länderberichte waren hilfreich als objektiver Bezugsrahmen der Interpretation.
[Seite der Druckausg.: 72]
Unter Berücksichtigung eines derart ermittelten gesellschaftlichen wie lebensgeschichtlichen Gesamtzusammenhangs richteten wir unser Augenmerk auf diejenigen Handlungsprobleme, vor die Fluchtmigranten sich im Aufnahmeland Bundesrepublik Deutschland gestellt sehen, – und dies in der Regel über Jahre hinweg. Persönliche Verarbeitungsformen einer Existenz zwischen Anerkennung und Anerkennungsverweigerung, Einbeziehung oder Ausschluss sollen erkennbar, das von der Aufnahmegesellschaft gewonnene Bild übermittelt und Vorstellungen, Wünsche, Vorschläge für die nähere und weitere persönliche Zukunft unserer Interviewpartnerinnnen und -partner verdeutlicht werden.
6.2 Erfahrungen und Erwartungen von Flüchtlingen. Eine Zusammenfassung
(1) Beginnen wir mit den jüdischen Kontingentflüchtlingen aus den GUS-Staaten: Sie unterliegen – vergleichsweise – günstigen Voraussetzungen einer sozialen Integration: Ein langjähriges, zermürbendes Asylverfahren (mit höchst ungewissem Ausgang) bleibt ihnen erspart. Mit ihrem von Anfang an verfestigten Aufenthaltsstatus haben sie vollen arbeitsgenehmigungsrechtlichen Zugang zum Arbeitsmarkt und, zunächst, zu denjenigen Integrationsangeboten, die die Bundesrepublik Deutschland für anerkannte Fluchtmigranten bereithält: An erster Stelle die Intensiv-Vollzeitsprachkurse der Arbeitsverwaltung bzw. der Otto Benecke Stiftung. Von großer Bedeutung für neu Ankommende ist die ortsansässige jüdische Kultusgemeinde mit ihren vielfältigen Informations- und Vermittlungsangeboten. Schließlich: Sie sind, und dies gilt gleichermaßen für Frauen wie Männer, mehrheitlich hoch qualifiziert. Dies erleichtert es ihnen, die häufig disparaten und kaum zu überblickenden Beratungsangebote am Ort in Anspruch zu nehmen und sich vergleichsweise schnell auf dem hiesigen Arbeits- und Qualifizierungsmarkt zu orientieren. Dies erleichtert es ihnen auch, angebotene Anschlussqualifikationen auch tatsächlich wahrzunehmen und erfolgreich durchzustehen.
Trotzdem erleiden auch ihre Biographien, und insbesondere ihre Erwerbsbiographien, einen erheblichen Bruch. Der Wunsch, bisher ausgeübte berufliche Tätigkeiten weiterführen zu können, scheitert in der Regel. Dies liegt an Ignoranz und mangelnder Sensibilität hiesiger Arbeitsmarktakteure. Es liegt auch an (allerdings überwindbaren) Unterschieden im Qualifikationsprofil und daran, dass erworbene Zertifikate hier nicht anerkannt werden. Entgegen ihren Erwartungen sehen sie sich deshalb vor die Notwendigkeit gestellt, beruflich völlig neu anzufangen. Und dabei teilen sie die Erfahrung vieler Inländerinnen und Inländer, dass nicht jeder neue Anlauf – in Gestalt z.B. einer Qualifizierungsmaßnahme – schon zum Ziel führt. Häufig genug bedarf es wiederholter Versuche. Anläufe, die zum Erfolg führen, verbleiben dann zumeist unterhalb jenes qualifikatorischen und Statusniveaus, das im Herkunftsland bereits erreicht war. Für die Mehrheit bleibt somit – auf unabsehbare Zeit – die Angewiesenheit auf Sozialhilfe. Noch nicht gebrochener Wille zur Erwerbsarbeit dokumentiert sich in gelegentlicher Annahme von Schwarzarbeit. Kritisch bis sarkastisch sind die Bewertungen hiesiger Arbeitsverhältnisse. Dies gilt insbesondere für Qualität und Zielsetzungen der angebotenen Integrationsmaßnahmen, aber auch für das Verhalten von Arbeitgebern und betrieblichen Vorgesetzten. Die Brüche in der eigenen Arbeitsbiographie sind für viele nur durch eine Projektion aushaltbar: Sie hoffen, dass es ihren Kindern, die auf den hiesigen Gymnasien bereits gute Fortschritte erzielen, beruflich einmal besser ergehen wird.
(2) Ausnahmslos alle Interviewpartnerinnen und -partner aus dem Kreis der Asylsuchenden und Bürgerkriegsflüchtlinge vermitteln zunächst ein eindringliches Bild ethnischer Zerrissenheit oder politischer Unterdrückung in ihren Herkunftsländern (oder auch einer Mischung von beidem), die ihnen letztlich keinen anderen Ausweg ließen als denjenigen der Flucht ins Exil. Asylsuchende unterscheiden dabei in der Regel zwischen zwei Phasen, die
[Seite der Druckausg.: 73]
der Flucht vorausgingen: Zunächst einer Phase teils um Unauffälligkeit bemühten, teils offen-oppositionellen Überlebens in der jeweiligen Herkunftsgesellschaft, immer getragen von der Hoffnung, dass sich die Verhältnisse in absehbarer Zeit zum Besseren wenden und politische Opposition, an der sie selbst beteiligt sind, diesen Prozess der Veränderung möglicherweise beschleunigt. In dieser Phase kam es ihnen noch nicht in den Sinn, ein bereits angefangenes Hochschulstudium oder erfolgreiche berufliche Tätigkeiten leichtfertig aufzugeben, – erst recht nicht den Kontext familiärer, nachbarschaftlicher und nationaler Bindungen, der eigenen Muttersprache und Herkunftskultur. Einige, die den Verfolgungsdruck bereits deutlich wahrnahmen, suchten zunächst eine Alternative im eigenen Land, zumeist in der Anonymität einer Großstadt oder der Hauptstadt des Landes. Hier tauchten sie einerseits unter, andererseits führten sie kein monadisches Dasein: Es ergaben sich neue Verbindungen nicht zuletzt zur jeweiligen politischen Opposition und von daher neue Verdachtsmomente für den staatlichen Sicherheitsapparat. Irgendwann, oft buchstäblich „über Nacht„, ergab sich dann eine zweite Phase, in der bis dahin latente Bedrohungen akut und sehr konkret wurden. Zunächst, der Weggang des Bruders, Onkels, Cousins oder der Cousine zur Guerilla, – mit entsprechenden Reaktionen der Sicherheitskräfte gegenüber der eigenen Familie: „Verhaftung und Folterung engster Freunde und Familienangehöriger„, „Verschwinden„ des eigenen Vaters oder Bruders nach Verschleppung durch Sicherheitskräfte und Militärs. Schließlich: Bedrohung der eigenen Person durch staatliche Sicherheitskräfte, Militärs und marodierende Paramilitärs, Inhaftierung, Einvernahme und Folterung, dies wiederholt und verknüpft mit brutal durchgeführten Hausdurchsuchungen sowie polizeilichem Terror gegen die eigene Familie. In einigen Fällen vor allem algerischer und sri lankischer Fluchtmigranten, die sich der jeweiligen Guerilla nicht anschließen wollten, kam ein entsprechender Druck nicht-staatlicher Organisationen hinzu. Sie alle sahen sich schließlich in einer aussichtslosen Situation, es sei denn, sie ergriffen die Flucht über die Grenzen des Landes. Die Entscheidung zur Flucht musste meist sehr schnell gefällt, ihre Umsetzung, bei den Jüngeren noch mit Unterstützung der Eltern, teilweise durch Schlepper bewältigt werden, die sich dies hoch entgelten ließen, gleichzeitig aber auch zu Lebensrettern der Fliehenden wurden. Die meisten Flüchtlinge strebten in ein Land, in dem sie Landsleute, nähere oder entfernte Bekannte und Familienangehörige vermuteten, die ihnen weiterhelfen würden. Äußerst prekär gestaltete sich in der Regel dennoch ihre Ankunft in der Bundesrepublik Deutschland: Es blieb dem Zufall überlassen, auf welchem Flughafen sie ankamen, von dem aus sie sich dann weiter durchschlagen mussten, über welchen Grenzabschnitt sie heimlich ins Landesinnere vordringen konnten, in welchem Bahnhof sie u. U. ihren Zug verließen oder in welchem Hafen sie anlandeten. Es fehlte jede Orientierung, etwa zur Topographie der Bundesrepublik. Es fehlten jegliche Sprachkenntnisse. Glücklich waren diejenigen, die sich auf Englisch verständigen konnten. Eine warme Mahlzeit und eine Übernachtungsmöglichkeit in einer Bahnhofsmission boten erste Anhaltspunkte oder ein in der Bahnhofshalle angesprochener Landsmann, der den Weg zur Asyl-Meldestelle oder auch zu einer Rechtsanwaltskanzlei weisen konnte.
(3) Erste Interaktionspartner in der Bundesrepublik waren einerseits und in unterschiedlicher Reihenfolge amtliche Personen: Polizisten und Beamte des Bundesgrenzschutzes, Bedienstete von Ausländerbehörden, Entscheiderinnen und Entscheider des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, hauptberufliche Betreuerinnen und Betreuer in den Unterkünften. Andererseits waren es die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Wohlfahrtsverbände, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Flüchtlingsberater, Vertreterinnen und Vertreter örtlicher Initiativgruppen und Menschenrechtsorganisationen und, etwas später, Lehrerinnen und Lehrer derjenigen Schulen, die von den Kindern besucht werden. Nicht zu vergessen: Pfarrerinnen und Pfarrer und andere, die sich um Aufnahme und Akzeptanz im jeweiligen sozialen Umfeld bemühten.
[Seite der Druckausg.: 74]
Über ihre Sozialkontakte zu letzteren äußern sich nahezu alle Fluchtmigranten äußerst positiv, einige geradezu enthusiastisch. Und zwei Personengruppen erhalten besondere Anerkennung: Zum einen die Flüchtlings- und Sozialberaterinnen und -berater der Wohlfahrtsverbände. Zum anderen die Lehrerinnen und Lehrer in den Auffangklassen von Grund- und Hauptschulen, die sich erfolgreich um die Kinder bemühten. Aber auch andere Lehrerinnen und Lehrer fanden außergewöhnliches Lob: z.B. diejenigen an Gymnasien und Einrichtungen zur Erlangung der Hochschulreife, die junge Erwachsene auch dann aufnahmen, wenn sie (noch) nicht anerkannt waren und sie dort „mitlaufen„ ließen.
Differenziert und selten polemisch äußern sich unsere Interviewpartnerinnen und -partner zu den öffentlich Bediensteten, die in polizeilicher oder administrativer Funktion für sie zuständig waren. Als schikanös wahrgenommene Behandlung wird durchaus benannt: So z.B. die Weigerung des Sozialamtes, einer – aus gutem Grund – „illegal„ nachgereisten Ehefrau eines bereits Asylberechtigten Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren, bevor nicht auch sie durch das Bundesamt anerkannt war; oder die Benutzung von Duft-Sprays gegenüber tamilischen Flüchtlingen, die bereits eine tagelange Anreise hinter sich hatten, ohne sich dabei waschen zu können; oder die Einweisung in einen Sprachkurs der Arbeitsverwaltung, der sich im Nachhinein als mangelhaft organisiert und deshalb nutzlos herausstellte; oder die Schnelligkeit, mit der eine kommunale Ausländerbehörde einer verwaltungsgerichtlich ausgesprochenen Ausreiseverfügung Nachdruck verlieh. Aber auch positive Erfahrungen werden deutlich vermerkt: Die freundliche Behandlung durch Polizisten auf dem Grenzbahnhof Berlin-Friedrichstraße oder an der bayerisch-österreichischen Grenze. [ Dies noch zu Zeiten der Geltung des alten Asylartikels 16 Abs. 2 GG.] Und selbst die „Freundlichkeit„ und „Fairness„ solcher Entscheiderinnen und Entscheider des Bundesamtes, die den eigenen Asylantrag dann abschlägig beschieden. Auch kommunalen Bediensteten, die die Ausweisung betrieben, wird noch „Freundlichkeit„ attestiert, und entschuldigend hinzugefügt, dass ja auch sie Vorschriften zu beachten hätten und ein anderer für diese Vorschriften verantwortlich sei. Dieser „andere„ hatte immer wieder auch einen Namen. Er hieß „Kanther„.
Von größter existentieller Bedeutung waren Anerkennung oder Nichtanerkennung durch Entscheiderinnen und Entscheider des Bundesamtes bzw. durch die Verwaltungsgerichte oder das Handeln der – sozusagen aus dem Hinterhalt agierenden und anonym verbleibenden Behörde des Bundesbeauftragten für Asylfragen. Aber selbst hier mündete die Bewertung getroffener – zumeist negativer – Entscheidungen und Urteile nicht in Polemik. Vorherrschend war eher die Fassungslosigkeit darüber, dass entweder die lebensbedrohliche Situation, der sie gerade entkommen waren, als nicht asylrelevant bewertet wurde oder ihnen – schlicht – „nicht geglaubt wurde„. „Man glaubte mir nicht„, – dies war einer der am häufigsten zu vernehmenden Sätze abgelehnter Asylsuchender. Das Asylverfahren erschien unseren Interviewpartnerinnen und -partnern so als Vabanquespiel: Ob sie anerkannt wurden oder – in der Mehrzahl der Fälle – nicht, unterlag einer momentanen Intuition der Entscheider (z. T. auch Richter), die ihren Aussagen entweder glaubten oder nicht glaubten. Ernsthaft und nachvollziehbar geprüft werde nicht. Der jeweilige Einzelfall finde nicht die ihm gebührende Berücksichtigung. Deutlicher Beleg hierfür seien die immer wiederkehrenden stereotypen Sätze in den Begründungen der Entscheidungen bzw. Urteile: „... hat sein Anliegen nicht substantiiert geltend gemacht.„ Oder: „... fehlt die beachtliche Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung im Herkunftsland.„ Oder: Bisher erlittene Verhaftungen, Verhöre und Folterungen „... erreichten nicht die asylbegründende Eingriffsintensität.„ Aber selbst hier sahen unsere Interviewpartnerinnen und -partner nicht einfach nur professionelles Unvermögen, bürokratische Engstirnigkeit, Leichtfertigkeit oder gar „Bosheit„ im Spiel sondern, fast entschuldigend, einen Mangel an Vorstellungskraft. Denn auch dies war ein häufig von uns
[Seite der Druckausg.: 75]
gehörter Satz: „Man kann sich offenbar nicht vorstellen, was in meiner Heimat passiert„: Die zerstörten Dörfer und brennenden Wälder; Psychoterror und Prügel in den polizeilichen Dienststellen; überfüllte Gefängnisse, in denen die Luft zum Atmen nicht ausreicht; unsägliche Folterpraktiken der mit Tarnkappen ausgestatteten, anonym verbleibenden Folterer; die Angst der jungen Männer vor Rekrutierung zum Militär; die Angst der jungen Frauen vor sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen durch Soldaten und Sicherheitskräfte; die Angst der Frauen und Mütter vor dem „Verschwinden„ ihrer Männer und Söhne. Man könne sich Derartiges nicht vorstellen und deshalb glaube man auch nicht den Berichten der Flüchtlinge – so, jenseits von Polemik und Schuldzuweisung, der Erklärungsansatz eines Teils unserer Interviewpartnerinnen und -partner zur Entscheidungspraxis derjenigen, die über sie zu befinden hatten und zur Kennzeichnung der eigenen Tragödie.
(4) Alle von uns befragten Fluchtmigranten, die noch in städtischen Übergangsheimen wohnten, empfanden die Wohnsituation dort als äußerst belastend und neurotisierend, – je länger sie dort wohnten, umso mehr. Umso zufriedener zeigten sich diejenigen, die über eine – noch so bescheidene – Mietwohnung verfügten. Erst dann, wenn der Kampf um Anerkennung mit Behörden und Gerichten bestanden ist, winkt, jedenfalls für die Mehrzahl, die Chance eigener, abschließbarer „vier Wände„. Ausnahmen bestätigen die Regel: So erfuhren wir, dass ärztliche Atteste zugunsten traumatisierter Flüchtlinge mit schwerwiegenden psychosomatischen Symptomen gelegentlich dazu führen können, dass ihnen innerhalb der Übergangsheime eine kleine abschließbare Wohnung zugewiesen wird. Angesichts eines entspannten Wohnungsmarktes erscheint das Problem, überhaupt eine Wohnung erhalten zu können, als vergleichsweise gering. Es kommt auf die Bereitschaft der beteiligten kommunalen Behörden an, sich hier abzusprechen und die notwendigen Genehmigungen zu erteilen. Allerdings stößt die Hautfarbe z.B. afrikanischer oder tamilischer Fluchtmigranten immer noch auf Vorbehalte potentieller Vermieter. Immerhin war zu erfahren, dass sich hier deutsche Vermittler, z.B. Sozialberater der Wohlfahrtsverbände oder auch beschäftigende Unternehmer, erfolgreich einschalten konnten.
(5) Sehr viel ernster als die Probleme auf dem Wohnungsmarkt stellen sich für unsere Interviewpartnerinnen und -partner die Probleme des Arbeitsmarktes dar. 19 der insgesamt 26 von uns Befragten aus dem Kreis der Asylsuchenden und Bürgerkriegsflüchtlinge waren zum Zeitpunkt des Interviews ausbildungs- bzw. arbeitslos. Einer erhielt – gerade noch – Arbeitslosenhilfe und lebte in Angst, bald Sozialhilfe beanspruchen zu müssen. Die übrigen 18 waren bereits auf Hilfe zum Lebensunterhalt gem. BSHG oder AsylbLG angewiesen. Und dies, obgleich auch unsere Interviewpartnerinnen und -partner – ganz im Sinne der bereits oben (5.1-5.3) referierten Untersuchungen – ein eher günstiges Bildungs- bzw. Berufsprofil einzubringen in der Lage waren. Acht unserer Interviewpartnerinnen und -partner kommen aus den gebildeten und wohlhabenden urbanen Milieus ihrer Herkunftsländer. Die Väter sind Ärzte, Manager, Geschäftsleute, höhere Staatsbeamte. Es galt als selbstverständlich, dass sowohl Töchter wie Söhne das Gymnasium besuchten (soweit möglich: eine private, z.B. kirchliche, „Eliteschule„) und dass sie anschließend studierten oder – im Hinblick auf eine qualifizierte berufliche Tätigkeit – ausgebildet wurden. Sie kamen somit als Akademikerinnen und Akademiker, Studentinnen und Studenten, oder als Schüler und Auszubildende in die Bundesrepublik. Eine zweite, etwas größere Teilgruppe (zwölf Personen) unserer Interviewpartnerinnen und -partner gehören den bäuerlichen und kleingewerblichen oder Handel treibenden Mittelschichten des jeweiligen Herkunftslandes an. Eine (z.B. handwerkliche) Ausbildung oder der Besuch der höheren Schule waren hier ebenfalls gang und gäbe.
Nur sechs unserer Interviewpartnerinnen und -partner sind den ärmeren bäuerlichen oder kleingewerbetreibenden Schichten des Herkunftslandes zuzurechnen. Sie verfügen in der Regel nur über eine schulische Elementarbildung und waren, soweit beruflich tätig, arme Kleinbauern und Gelegenheitsarbeiter. Letztere stehen vor besonders großen Schwierigkeiten
[Seite der Druckausg.: 76]
auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. Schon allein der Prozess des Sprachlernens bereitet ihnen mehr Probleme als den beiden zuvor genannten Teilgruppen.
Aber auch bei den Qualifizierten muss, ähnlich wie bei den jüdischen Kontingentflüchtlingen, festgehalten werden, dass die Flucht einen Bruch ihrer Bildungs- und Erwerbsbiographien markiert. Keine(r), auch die Hochgebildeten, fand Anschluss im erlernten Beruf bzw. auf dem Niveau bereits absolvierter schulischer Vorbildungen und Studien. Ihre Erwerbsbiographie hier vollzieht sich deshalb im schnellen Wechsel von immer neuen Anläufen zu mehr oder weniger improvisierten Sprachlernversuchen, Jobsuche, Tätigkeiten in irgendwelchen prekären (auch schattenwirtschaftlichen) Gelegenheitsjobs, versuchter (häufig scheiternder) Selbständigkeit, erneuter Arbeitslosigkeit und Jobsuche. Nur einer verschwindenden Minderheit gelang es, hier ein Hochschulstudium aufzunehmen. Immerhin waren unsere Interviewpartnerinnen und -partner sämtlich vor dem 15.05.1997 in die Bundesrepublik eingereist und insoweit noch nicht von jenem totalen Arbeitsverbot betroffen, das für diejenigen galt, die nach diesem Datum in die Bundesrepublik kamen. Auch galten noch nicht jene Negativlisten, die seit 01.01.1999 z.B. in den Arbeitsverwaltungen NRWs eingeführt sind. Arbeitsmöglichkeiten im Niedriglohnbereich des ersten Arbeitsmarktes konnten somit gesucht und hie und da auch gefunden werden, sofern Arbeitgeber bereit waren, sich auf kurze bis sehr kurze Befristungen der Arbeitsverhältnisse einzulassen und das Risiko ständig neuer Antrags- und Prüfverfahren auf sich zu nehmen.
Die Jobsuche vollzog sich auf vor allem zwei Wegen: Dem indirekten Weg einer Vermittlung von Seiten Angehöriger der eigenen community und dem direkten Weg des „Klinkenputzens„ bei Firmen und Kleingewerbetreibenden z.B. in den Stadtteilen, in denen unsere Interviewpartnerinnen und -partner wohnen.
Fünf der von uns befragten Asylsuchenden bzw. Bürgerkriegsflüchtlinge befanden sich als 17- bis 20-Jährige noch im Ausbildungsalter. Sie alle besuchten bzw. besuchen noch die Hauptschule und waren in der Lage, sich gut in der deutschen Sprache zu verständigen. Dies spricht für die Qualität hauptschulischer Sprachlernangebote an jugendliche Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger. Allerdings war es nur einem der jungen Männer möglich, eine Berufsausbildung mit anschließender Übernahme zu realisieren. Er erhielt die dazu erforderlichen Arbeitserlaubnisse. Die Übrigen wurden durch das geltende Arbeitsgenehmigungsrecht vom Ausbildungsmarkt fern gehalten. Sie wünschen sich nichts mehr als eine Arbeit oder besser noch: Ausbildung. Alle würdigen im Übrigen die Bemühungen ihrer Lehrerinnen und Lehrer an den Hauptschulen und die hier erfahrene Zuwendung.
Asylmigrantinnen und -migranten verfügen immerhin über das Kapital eines vergleichsweise jungen Altersdurchschnitts. Berufliche Wunschvorstellungen werden deshalb noch nicht auf die eigenen Kinder projiziert. Zumindest einige von ihnen halten an solchen Vorstellungen auch für sich selbst fest. Sie wollen z.B. „Philosoph„ oder „Biologe„ werden, „Rechtsanwältin„, „Grafikerin/Designerin„, „Sozialarbeiter„, „Krankenpfleger„ und „qualifizierter Handwerker„ bzw. „Facharbeiter„.
Integrationsleistungen der Aufnahmegesellschaft standen nur den Asylberechtigten offen. So absolvierten zwei der fünf von uns befragten Asylberechtigten den Vollzeit-Intensivsprachkurs des Arbeitsamtes, ein Dritter musste ihn krankheitsbedingt abbrechen. Ein Vierter, zum Zeitpunkt seiner Anerkennung Student, nahm erfolgreich an einem Sprachkurs der Otto Benecke Stiftung teil. Für den Fünften kam die Anerkennung so spät, dass er auf anderen Wegen längst Deutsch gelernt hatte. Nur zwei der fünf Asylberechtigten wurden – über den Sprachkurs hinaus – von weiterreichenden berufsbezogenen Integrationsangeboten erreicht. Es handelt sich um zwei Frauen: Die eine absolvierte eine berufliche Umschulung, ohne dann allerdings eine Anstellung zu finden, die andere nahm an einer mehrmonatigen berufsvorbereitenden Maßnahme teil. Als allein erziehende Mutter nicht unbeschränkt mobil, sah
[Seite der Druckausg.: 77]
sie sich dann allerdings, bei der Suche nach einer Anstellung, vor erheblichen Schwierigkeiten.
Der Mehrheit nicht anerkannter Asylmigranten erscheint die Arbeitsverwaltung weniger als Förder- und Vermittlungs-, denn als Prüf- und Selektionsinstanz, folgt sie doch den Weisungen des Bundesarbeitsministers, der auch die letzten Erwerbsnischen im Bereich niedrig entlohnter Dienstleistungen „Bevorrechtigten„ vorbehalten will. Von den Sätzen des Asylbewerberleistungsgesetzes, so die übereinstimmende Rückmeldung unserer Interviewpartnerinnen und -partner, lässt sich auch bei größter Bescheidenheit und z.B. „nur einer Mahlzeit pro Tag„ nicht leben. Erst recht ist das Erlernen der deutschen Sprache als Voraussetzung für eine Beschäftigung in Frage gestellt: Die gängigen Gebühren, schon für Sozialhilfeempfänger kaum erschwinglich, können nicht aufgebracht werden. Also muss das Sprachlernen mit Hilfe kostenloser (aber bei weitem nicht zureichender) kirchlicher Sprachlernangebote oder als bloße Selbsthilfe und unter z. T. grotesken Umständen (z.B. mit Hilfe auf dem Flohmarkt erstandener deutscher Kinderbücher) bewältigt werden. Ist dies geschehen, schließt das Arbeitsamt sie dennoch von weiterführenden Angeboten berufsbezogenen Anschlusslernens aus. Denn auch der Zugang zu diesen Angeboten steht unter dem Generalvorbehalt einer bereits erteilten Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung.
(6) Der Lebensrhythmus (noch) nicht anerkannter Asylsuchender ist bestimmt von einer Mischung aus Abwarten und Angst. Abwarten, wann endlich das Verfahren zu einem Abschluss kommt, Angst, dass dann die (auch zwangsweise) Rückführung in das Herkunftsland anstehen kann. Für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina, deren erste Generation mehrheitlich durchaus heimkehrbereit war, bedeutete dies: Rückkehr irgendwohin, in der Regel nicht, wie im Dayton-Abkommen vorgesehen, in ihren Heimatort und ihr (unter Umständen niedergebranntes oder zerstörtes) Haus. Sie leiden unter der Angst, ins Bodenlose einer Existenz in Armut und Abhängigkeit abzugleiten und den eigenen Kindern keine Zukunft eröffnen zu können. Asylsuchende leiden unter noch gesteigerter Angst: Angst gewiss auch, ins ökonomisch „Bodenlose„ zu fallen, Angst vor allem aber, den Sicherheitskräften ihres jeweiligen Landes ausgeliefert und damit von Folter und Tod bedroht zu sein. Dies gilt in besonderer Weise für Staatsangehörige Algeriens, des Iran, der Türkei, Sri Lankas und der schwarzafrikanischen Herkunftsländer. Diese Angst überschattet alle anderen Ängste, wie es ein tamilischer abgelehnter Asylbewerber zum Ausdruck bringt: „Hauptsache ich kann bleiben. Weiß ich denn sonst, ob ich morgen noch lebe?„ Umso mehr muss erstaunen, dass es den meisten von ihnen – auch unter diesen Umständen, ja selbst unter den Bedingungen des Kirchenasyls – gelingt, ihr Überleben von Tag zu Tag neu zu organisieren. Akkomodation hat längst stattgefunden. Soziale Integration bahnt sich als „heimliche„ an.
Ihr Dank gilt jenen Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft, die sie in ihrem deprimierenden Alltag begleiten: Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Verbände, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Pfarrerinnen und Pfarrer, Organisatoren von Kirchenasyl, Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen nachbarschaftlichen Umfeldes, Arbeitgeber, hie und da auch ein Gewerkschaftssekretär oder Betriebsrat und die Lehrerinnen bzw. Lehrer ihrer Kinder. Die Bundesrepublik Deutschland stellt sich für Asylsuchende somit als zwieschlächtig dar: Auf der einen Seite als Staatsmacht, eher abweisend, in letzter Konsequenz unerbittlich und insoweit einem schrecklichen Irrtum unterliegend. Auf der anderen Seite als den Menschenrechten verpflichtete Zivilgesellschaft, aus der heraus auch und gerade (noch) nicht-anerkannten Fluchtmigranten Anteilnahme, Empathie, Aufnahme- und Hilfsbereitschaft entgegengebracht wird. Am Deutschland-Bild unseres Interviewpartners aus Algerien, Herrn Z., den wir im Kirchenasyl antrafen und dessen Abschiebung unmittelbar bevorstand [Herr Z. entging der Abschiebung durch "Abtauchen" in die sog. Illegalität. Er fand inzwischen Asyl in Kanada.], konnten wir
[Seite der Druckausg.: 78]
dies eindrucksvoll nachvollziehen: „Ich bin nach Deutschland gekommen, um mein Leben zu retten. Aber für mich gibt es auch in Deutschland keine Sicherheit. Aber es gibt Deutsche, die mir geholfen haben. Deutschland hat sich mir gegenüber feindlich gezeigt, aber eine Gruppe von Deutschen hat mir geholfen und mir eine Zeit lang Sicherheit gegeben. Dafür bedanke ich mich. Diese Menschen waren für mich meine zweite Familie. Ich konnte sie besuchen, wann ich wollte. Sie zu verlassen ist eine große Trauer. Ich verlasse abermals meine Familie, was soll ich sonst machen? Nach Algerien zurück? Niemals!„
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Januar 2002