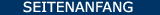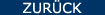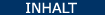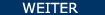![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
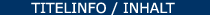
TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 7]
Wolf-Dietrich Bukow
Zur gesellschaftlichen und politischen Konstruktion ethnischer Minderheiten
Es ist an dieser Stelle kaum erforderlich, sich grundsätzlich über all das, was man mit Ethnizität verbinden mag, Klarheit zu verschaffen.
[FN_1: Vgl. dazu die Übersicht bei C. Lentz, Tribalismus und Ethnizität in Afrika. Ein Forschungsüberblick, FU Berlin, 1994, Sozialanthropologische Arbeitspapiere Nr. 57.]
Die Ethnizität soll hier nur insoweit interessieren, als sie irgendwie mit der Entstehung von Minderheiten in fortgeschrittenen Industriegesellschaften wie der Bundesrepublik zu tun zu haben scheint. Es gibt einen mehr oder weniger ausgeprägten Konsens darüber, daß sich in unserer Gesellschaft bestimmte Bevölkerungsgruppen zunehmend als ethnische Minderheiten identifizieren lassen. Wir lesen davon, wir hören darüber. Wir erleben in unserer Nachbarschaft besondere Gruppen, die anders erscheinen, eben typisch "türkisch", typisch "italienisch", typisch "afrikanisch" wirken. Jedenfalls weichen sie schon auf den ersten Blick von dem ab, was uns vertraut, althergebracht und damit normal erscheint. Und dabei kann auch kaum irritieren, daß es sich hier um allenfalls vage Bestimmungen handelt, weil einem natürlich klar ist, daß es eigentlich so wenig eine "türkische" wie eine "italienische" oder eine "afrikanische" Ethnizität gibt. Die Ethnizität erscheint als eine wichtige Kategorie. Genau genommen scheint die Bedeutung der Ethnizität sogar in Verbindung mit Minderheiten beträchtlich zuzunehmen.
1.1 Um die Behauptung, daß Ethnizität zumal im Zusammenhang mit Minderheiten eine erhebliche Bedeutung habe, ja daß die Ethnizität im Augenblick sogar noch an Relevanz gewinne, genauer diskutieren zu können, bedarf es einiger Vorüberlegungen. Vor allem muß man sich ein wenig Klarheit darüber verschaffen, welche gesellschaftlichen Möglichkeiten generell mit Ethnizität zu verbinden sind. In welcher Weise
[Seite der Druckausg.: 8]
kann die Ethnizität überhaupt Bedeutung haben? In der hier gebotenen Kürze möchte ich drei Möglichkeiten andeuten und anschließend diskutieren, welche im Augenblick von Bedeutung sein können:
- In vielen traditionellen Gesellschaften, zumal in Kastengesellschaften, besitzt die Ethnizität eine mitunter umfassende Definitionsmacht für die Etablierung einer Gesellschaft. Der Ethnologe W.E. Mühlmann sprach in diesem Zusammenhang schon vor vielen Jahren von einer Ethnogenese.
[FN_2: W.E. Mühlmann, Rassen, Ethnien, Kulturen, Moderne Ethnologie, Neuwied/Berlin 1964.]
Und er meinte damit, daß sich Gesellschaften um ethnische Kriterien herum ausbilden können. Dahinter steht die Beobachtung, daß sich z.B. während und in der Folge einer Völkerwanderung ethnische Zuordnungen für die Ein- und Ausgrenzung bestimmter Wir-Gruppen durchsetzen und zu einer längerfristige Geschlossenheit der entsprechenden Sozialformen beitragen können. Unterdessen hat sich dieser Begriff für eine gewissermaßen historisch gesättigte schrittweise Ausbildung einer ethnischen Wir-Gruppen-Identität durchgesetzt. - Es liegt auf der Hand, daß die gesellschaftlichen Leistungen, die ethnogenetische Prozesse hervorbringen können, auch einmal bewußt in Rechnung gestellt werden mögen. Dies kann in einer eher unauffälligen Weise geschehen, indem ethnogenetische Prozesse kulturpolitisch beschleunigt werden. Es mag aber auch ganz massiv geschehen, indem eine Ethnizität aus dem Stand heraus neu inszeniert wird. Zumal in dem letzten Fall werden dann ganz gezielt Abstammungen postuliert oder Ethnizitäten mehr oder weniger künstlich beschworen W.E. Mühlmann sprach in diesem Fall von Ethnogonie. Wenn man sich einzelne Beispiele anschaut, wird man erkennen, was auch immer der Anlaß für solche künstlichen Konstruktionen gewesen sein mag, sie sind durchaus effektiv. Vergleichen wir z.B. einmal die Sorben mit den Bayern. Sie wirken historisch betrachtet beide wie geschlossene und in sich ethnisch ausbalancierte Gruppen, obgleich die erste Gruppe das Ergebnis ethno-
[Seite der Druckausg.: 9]
genetischer Entwicklungen, die zweite Gruppe ein politisch erzeugtes ethnogonisches Kunstgebilde darstellte.
- Auch in der Neuzeit hat man aus den verschiedensten Gründen und in ganz unterschiedlichen Situationen immer wieder versucht, ethnische Eigenschaften in den Mittelpunkt bestimmter Gruppenbildungen zu rücken, also ethnogenetische Prozesse nachzuahmen und z.B. ethnische Gemeinsamkeiten im Sinn von entweder nur gruppenspezifischen oder regionalen und oft auch nationalen Besonderheiten zu postulieren. Ich erinnere an den Ariermythos zur Zeit des Nationalsozialismus bei uns in Mitteleuropa, die Vorstellung der WASPS (White Anglosaxon Persons) in den USA und den Volksbegriff, wie er in der neuen Rechten seit der Formulierung des Heidelberger Manifests zunehmend Verwendung findet. In den meisten Fällen geht es darum, die Praxis einer bestimmten Gruppe ethnisch zu untermauern, ethnische Merkmale zu zentralen Kriterien zu stilisieren und die Gruppenpraxis von dort her anschließend auch zu legitimieren. In diesen Rahmen werden zunehmend auch sexistische und rassistische Argumentationsmuster integriert. Sie liefern oft flankierende Deutungsmuster, um die solchermaßen "künstlich" erzeugten Wir-Gruppen in ihren Ansprüchen gegenüber anderen biologistisch zu unterstützen. Zumal wenn es sich um Großgruppen handelt, treten die rassistischen Argumente heute sogar in den Vordergrund.
[FN_3: R. Miles, Rassismus, Einführung in die Geschichte und Theorie eines Begriffs, Hamburg 1991.]
Wenn in modernen Gesellschaften ethnische Eigenschaften in den Mittelpunkt gestellt werden, dann in modifiziert ethnogonischer Form. Moderne ethnogonische Konzepte werden biologistisch oder anthropolo-gistisch unterfüttert.
1.2 Nun geht es mir an dieser Stelle nicht bloß darum, Enthnogense und Ethnogonie voneinander abzugrenzen. Es ist natürlich wichtig, sich darüber klar zu werden, daß die Rede von der "türkischen Ethnie" schon mangels innerer Geschlossenheit dessen, was hierbei summiert wird, allenfalls das Produkt eines ethnogonischen Prozesses sein kann. Aber es reicht nicht aus, ein ggf. übersteigertes ethnisches Denken und Handeln
[Seite der Druckausg.: 10]
zu kritisieren, wenn z.B. versucht wird, komplexe Gesellschaften ethnisch zu deuten.
[FN_4: F. Heckmann, Nationalstaat, multikulturelle Gesellschaft und ethnische Minderheitenpolitik, in: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Partizipationschancen ethnischer Minderheiten, Bonn 1992, S. 7 ff.]
Mir geht es darum, daß moderne Formen der Ethnogonie nicht nur deshalb problematisch sind, weil sie Ethnogenesen künstlich nachahmen, sondern weil sie die Ethnizität als Kriterium für Gruppenbildungen einsetzen, obgleich sich dies gesellschaftlich betrachtet grundsätzlich erübrigt. Entnogenese wie Ethnogonie basieren beide auf der These, das Ethnische sei gesellschaftlich konstitutiv. Genau diese These ist jedoch für viele Gesellschaften, zumal für fortgeschrittene Industriegesellschaften, zu bestreiten. Die Ethnizität war schon historisch gesehen niemals die einzige Möglichkeit für Wir-Gruppen-Bildungen gewesen. Und speziell in modernen, fortgeschrittenen Industriegesellschaften spielt die Ethnizität als Strukturmerkmal keine Rolle mehr.
[FN_5: Vgl. W.-D. Bukow, R. Llaryora, Mitbürger aus der Fremde, Opladen 1993, 2. Aufl.]
Die Behauptung ist hier, daß (wie in manchen anderen Gesellschaften auch - wenn auch aus jeweils sehr unterschiedlichen Gründen) fortgeschrittene Industriegesellschaften weder ethnische noch überhaupt spezifische kulturelle Rahmungen benötigen, um ihren Bestand zu sichern. Der Grund ist ein doppelter:
- Moderne Gesellschaften bilden formal-rationale Systeme aus und markieren diese mit systemspezifischen "Leitdifferenzen".
- An die Stelle überwölbender kultureller Bindungen treten kommunikative Prozesse (Rechtsverfahren, Öffentlichkeit, politischer Diskurs).
Man kann sicherlich an dieser Stelle einwenden, daß ja nach wie vor die verschiedensten Abschattungen von Ethnizität existieren. Wenn hier jedoch behauptet wird, daß ethnische Komponenten in entsprechenden fortgeschrittenen Gesellschaften konstitutiv belanglos geworden sind, bedeutet das noch nicht, daß sie einfach verschwunden sind. Sie haben vielmehr heute einen den Formen moderner Religionen vergleichbaren,
[Seite der Druckausg.:11]
eher privaten Status. Sie sind zu einem Bestandteil des persönlichen Lebenszusammenhanges geworden. Sie sind wieder auf den Kontext beschränkt, innerhalb dem sie seit je ihre besonderen Leistungen erbrachten.
Was aber, wenn eben doch die Ethnizität für konstitutiv ausgegeben wird? Wenn der Ethnizität heute und jetzt dennoch eine konstitutive Bedeutung für die Etablierung einer Wir-Gruppe, ja sogar für die Fundierung einer Gesellschaft zugesprochen wird, dann geschieht noch mehr als bloß ein ethnogonischer Prozeß, also eine künstliche Heraufführung von Ethnizität. Hier wird versucht, die Ethnizität zu einem basalen regulativen Prinzip zu stilisieren. Es ist also zweierlei gemeint:
- Die Etablierung einer Gesellschaft, in der die Ethnizität (ggf. erneut) konstitutiv wird.
- Die ethnische Ausgestaltung der gesellschaftlichen Machtstruktur.
Was hier geschieht, wurde das erste Mal von der amerikanischen Ethnologin K.V. Staiano mit Ethnisierung bezeichnet.
[FN_6: K. V. Staiano, Ethnicity äs Process, in: Ethnicity 7, 1980/1, S. 27 ff.]
Diese Ethnisierung ist die modernste Formen der Ethnogonie. Im Rahmen der Ethnisierung wird versucht, Gesellschaftsstrukturen zu ethnifizieren
[FN_7: C. Offe, Der Tunnel am Ende des Lichts, Frankfurt/M. 1994, S. 146 ff.]
und dabei bestimmte Adressatenkreise zu diskriminieren, zu einer spezifischen Bevölkerungsgruppe, zu einer ethnischen Minderheit zu definieren. Damit verbindet sich eine gezielte Neubewertung des eigenen Standpunktes. Die ethnisch definierte Diskriminierung der einen Seite korrespondiert mit einer ethnisch definierten Aufwertung der anderen Seite.
Es ist also nicht nur sinnvoll, sondern unabdingbar, zwischen Ethnogenese, Ethnogonie und Ethnisierung zu unterscheiden. Was wir gegenwärtig beobachten können, sind Prozesse der Ethnisierung [FN_8: W.-D. Bukow, Leben in der multikulturellen Gesellschaft, Opladen 1993.], wobei es zunächst gleichgültig ist, ob es sich um eine reine Fremdethnisierung oder dann auch in Reaktion darauf um eine Selbstethnisierung handelt.
[Seite der Druckausg.: 12]
Erst vor diesem Hintergrund kann man von einer gesellschaftlichen, ja politischen Konstruktion ethnischer Minderheiten sprechen. Mit dieser Konstruktion wird Ethnisierung durchgesetzt.
2. Soziogenese ethnischer Gruppen heute: Ethnisierung
Bei der Ethnisierung geht es darum, die gesellschaftlich verbindliche Struktur zu ethnifizieren, wobei die Ausbildung von Gruppen zu ethnischen Figurationen im Mittelpunkt steht. Ich schlage deshalb vor, die Ethnizität in diesem Fall als ein Deutungsverfahren zu betrachten, das man sich dann als im Kontext von kultureller Kommunikation [FN_9: Vgl. E. Leach, Kultur und Kommunikation. Zur Logik kultureller Zusammenhänge, Frankfurt/M. 1978.] installiert vorzustellen hat. Es wird in der kulturellen Kommunikation entfaltet, um eine entsprechende gesellschaftliche Modifikationen zu erzeugen. Es wäre dann ein Verfahren, das (1.) im Kontext bestimmter kultureller Kommunikationsabläufe zu sehen ist, und das (2.) seinerseits auch bestimmte Formen kultureller Kommunikation mit entsprechenden Auswirkungen repräsentiert. Versteht man die Ethnizität als ein Verfahren im Rahmen kultureller Kommunikation, so lassen sich mindestens drei Aspekte diskutieren, nämlich ein rekonstruktiver, ein konstruktiver und ein strategischer bzw. operativer Aspekt.
2.1 Der rekonstruktive Aspekt: In der gegenwärtigen Diskussion über ethnische Eigenschaften geht es zunächst darum, bestimmte geschichtliche Erfahrungen hervorzuholen und für den aktuellen Bedarf zur Verfügung zu stellen. Insoweit wird Ethnizität rekonstruktiv auf den Begriff gebracht. Freilich, was hier rekonstruiert wird, ist keine Ethnogenese, sondern allenfalls Ethnogonie. Was rekonstruiert wird, ist ein Konzept, das in den letzten hundert Jahren zum Kristallisationspunkt von Bemühungen geworden war, übergreifende Wir-Gruppen-Bildungen zu entwickeln und sich gleichzeitig von anderen analog konzipierten Wir-Gruppen-Bildungen abzugrenzen.
[FN_10: So G. Elwert, Nationalismus, Ethnizität und Nativismus - Über die Bildung von Wir-Gruppen, in: P. Waldmann, G. Elwert (Hrsg.), Ethnizität im Wandel, Saarbrücken 1989, S. 21 ff.]
Man wollte etwas Homogenes dar-
[Seite der Druckausg.: 13]
stellen und sich darin von anderen positiv abheben. Jedenfalls kann man die Rückbesinnung auf das "Volk", die Ethnie und dann die Nation, welche spätestens mit der Romantik einsetzte und dann in die »alldeutsche« Bewegung einmündete und im übrigen bis heute andauert, so deuten. Jürgen Habermas hat das sehr plastisch zusammengefaßt.
"In Frankreich hat sich das Nationalbewußtsein im Rahmen eines Territorialstaates ausbilden können, während es sich in Deutschland zunächst mit der romantisch inspirierten und bildungsbürgerlichen Idee einer "Kulturnation" verbunden hat. Diese stellt eine imaginäre Einheit dar, die damals in den Gemeinsamkeiten der Sprache, der Tradition und der Abstammung Halt suchen mußte..."
[FN_11: J. Habermas, Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat, in: Ch. Taylor, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, Frankfurt/M. 1993, S. 147 ff., hier S. 191.]
Von Beginn an geht es um den ethnogonischen Entwurf von Gemeinsamkeiten, und dies ganz akzentuiert im Interesse eines inneren Zusammenschlusses bei gleichzeitiger Abgrenzung nach außen. Und die aktuellen rekonstruktiven Anstrengungen stehen in der Kontinuität dieser Geschichte und dauern nicht nur an, sondern geraten gegenwärtig anläßlich der Diskussion über die Themen Einwanderung, Flucht und Asyl und das Thema Neue Bundesländer sogar erst richtig in Schwung. Man spricht heute ganz gezielt vom Deutschen und von Deutschland und möchte damit die Homogenität der Abstammung wie die historische Geschlossenheit des Territoriums Bundesrepublik Deutschland unterstreichen. Ein so gelagertes Ethnizitätskonzept scheint also mehr denn je auf bestimmte Selbstvergewisserungsprozesse innerhalb der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit zu zielen. In der Sprache der neuen Rechten heißt das kurz und bündig:
"Tatsächlich kehrte Deutschland mit dem Ende der Teilung in seine ursprüngliche geopolitische Lage zurück. "
[FN_12: K. Weißmann in der FAZ vom 22.4.1994.]
[Seite der Druckausg.: 14]
2.2 Der konstruktive Aspekt: Der rekonstruktiv angelegte Begriff dient, wenn er auf die Selbstversicherung einer Gruppe abzielt, automatisch auch der aktiven Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit. Die Ethnizitätsdiskussion begnügt sich zwar oft vordergründig damit, bestimmte Ursprünge zu imaginieren. Tatsächlich jedoch sind diese Ursprünge ja nur von Interesse, weil man davon ausgeht, sie würden die Gegenwart (1) herkunftsmäßig, (2) überindividuell (wir-gruppenorientiert) untermauern und damit eben letztlich auch legitimieren. Wer meint, die Gegenwart würde wesentlich durch solche Vorgeschichten bestimmt, die Gegenwart sei Wirkungsgeschichte ethnischer Grunddaten, der möchte heute und jetzt Geltungsansprüche erheben. Im Grunde handelt es sich bei der Rückschau um eine Vorausschau, um eine Konstruktion, die einen bestimmten Effekt, nämlich den der Erfahrung der Abhängigkeit von Vorgeschichte und Voreinstellungen ethnisch auflädt und zur Überwölbung einer aktuellen gesellschaftlichen Befindlichkeit dienstbar macht.
Es ist kein Zufall, wenn und natürlich auch wann bei uns auf die Ethnie oder gar die Nation Bezug genommen wurde und wann diese Bezugnahme dann jeweils wieder in der Requisitenkammer der Geschichte verschwunden ist. Offenbar wird so etwas wie »Ethnizität« immer dann interessant, wenn gesellschaftliche Turbulenzen zu verzeichnen sind, aus welchen Gründen auch immer Ressourcen oder Rechte ins Gerede kommen. In einer Rede des Vorsitzenden der Bundestagsfraktion der CDU, W. Schäuble, anläßlich einer Tagung über "Die Deutschen und ihre Einheit" wird jedes zwanzigste Wort mit dem Wortstamm "deutsch" gebildet. "Deutsch" wird zum Konstruktionsmittel für eine "nationale Gemeinschaft".
"...Zum anderen bin ich davon überzeugt, daß wir Deutschen in dem Maß zur inneren Einheit finden werden, in dem es uns gelingt, uns wieder auf die Grundlagen unserer nationalen Gemeinschaft zu besinnen, diese nationalen Grundlagen neu mit Leben zu füllen. Auch das ist am Ende dieses Jahrhunderts nicht leicht. Und doch muß es gelingen, weil wir auf den nationalen Zusammenhang angesichts einer immer unübersichtlicher und konfliktreicher werdenden Welt zwingend angewiesen sind. "
[FN_13: Vortrag von W. Schäuble am 15.4.1994 in Bonn/Konrad-Adenauer-Stiftung.]
[Seite der Druckausg.: 15]
Es ist durchaus erstaunlich, wie schnell ethnische Zuweisungen wieder für so bedeutsam gehalten werden, daß man sie sogar bei Themen einsetzt, die traditionell ökonomisch diskutiert wurden. Bei der Angleichung der Strukturen der neuen Bundesländer geht es ja im Kern um systemische Prozesse etwa industrieller, finanzieller und rechtlicher Provenienz. Daran wird jedenfalls der konstruktive Gebrauch der Ethnizität gerade angesichts bestimmter gesellschaftlicher Probleme und Verwerfungen plastisch.
2.3 Der operative Aspekt: Wenn die Ethnizität - die eigene wie die fremde - vor allem dann modisch wird, wenn es um die Bewältigung von Verwerfungen, um die Sicherung von Ressourcen und Rechten geht, und dafür spricht z.B. schon ein Blick in die Medien, ein Schritt auf die Straße, ein Besuch am Stammtisch oder eine Diskussion mit Schülern, so wird schnell klar, daß mit dem Ethnizitätsbegriff sehr weit gezielt wird. Mit dem Ethnizitätsbegriff wird keineswegs, wie das auf den ersten Blick erscheinen mag, bloß rekonstruiert, was "schon immer" gegolten habe, oder - noch naiver - nur einem "Nachhalleffekt" statt gegeben. Vielmehr wird eine strategische Operation vorgenommen, indem Positionen, Konzepte, Behauptungen und Definitionen in den Prozeß der gesellschaftlichen Selbstverständigung eingegeben werden, die darauf abzielen, ethnische Argumente als solche zu verankern und zugleich ganz spezifische Argumente zu installieren. Alles zielt auf eine fundamentale Prägung durch Abhängigkeit von Ethnizität zwecks Gruppen-Bildungen ab.
[FN_14: A.Treibel, Transformationen des Wir-Gefühls, in: R. Blomert u.a. (Hrsg.), Transformationen des Wir-Gefühls, Frankfurt/M. 1993, S. 313 ff.]
Der Ethnizitätsdeutungsdiskurs wird zu einem Verfahren, das präzis ausgewiesene Ziele operativ einspielen soll. Dieser Diskurs verfolgt geradezu strategische Anliegen, wobei er zumindest im deutschen Sprachraum, was bereits Anette Treibel beobachtete, ganz nahe an den "Nation"-Diskurs heranrückt.
Der Ethnizitätsdiskurs drängt, um es noch einmal allgemeiner zu formulieren, auf eine Schlüsselstellung innerhalb der kulturellen Kommunikation, um von dort aus die Gesellschaftsstruktur neu zu definieren. Er zielt darauf, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit in ei-
[Seite der Druckausg.: 16]
ner ganz bestimmten Weise (1.) kulturell zu zentrieren und (2.) spezifisch ethnisch zuzurechnen.
[FN_15: R. Leiprecht spricht von der Macht der Zuschreibung, (ders.: Ein Problem nur für Fremde?, in: Widersprüche, Zeitschrift für sozialistische Politik, Nr. 45 1992 S. 17 ff.]
3. Ethnisierungsprozesse
In der aktuellen kulturellen Kommunikation, in der Auseinandersetzung über das, was in der Gesellschaft heute ansteht, wird zunehmend von ethnischen Komponenten Gebrauch gemacht. Ethnizität wird eingesetzt, um Gruppenbildungen in der Gesellschaft neu zu fundieren. Im Kern geht es jedoch um mehr, nämlich darum, die Basismuster, die Struktur der Gesellschaft unter ethnischen Gesichtspunkten zu reorganisieren.
3.1 Analysiert man die Ethnisierungsprozesse genauer, so fallen einem schnell zwei Aspekte auf, die mit dem sozialen Prozeß der Ethnisierung zu tun haben:
- Ethnisierungsprozesse werden anfangs nur im Blick auf alltägliche Fragestellungen und Probleme und erst später auch im Blick auf komplexere Zusammenhänge ausgearbeitet. Die Ethnisierung greift danach zunächst nur im Alltagsleben.
- Ethnisierungsprozesse zielen zu Beginn bloß auf Abgrenzung, genauer die Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungskreise zum Fremden, zum "Ausländer", und erst zum Schluß beginnt man, sich auch selbst ethnisch zu interpretieren. Ethnisierung setzt mit der Diskriminierung des anderen, mit der Erzeugung von Gruppen zu ethnischen Minderheiten ein.
Obgleich also der Ethnisierungsprozeß eine umfassende gesellschaftliche Operation darstellt und auf den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang zielt, zeigt er eine unauffällige Entwicklung, eine Entwicklungslogik von nebenbei fallenden und fast belanglosen Bemerkungen
[Seite der Druckausg.: 17]
bis zu einer massiven und umfassenden Neudefinition von Gesellschaft. Ethnisierung beginnt fast unbemerkt und damit eher harmlos, wenn beim Einwanderer zunehmend Fremdheit und Andersartigkeit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird. Sie appelliert an den "gesunden" Menschenverstand. Dies zeigt sich schon ganz allgemein an der Geschichte der "Ausländerfeindlichkeit" in der Bundesrepublik. Diese Ausländerfeindlichkeit wurde über Jahre hinweg am Stammtisch entwickelt und zunehmend mit ethnischen Attributen unterfüttert, bis sie schließlich populistisch interessant wurde, in den Medien auftauchte und sich dann in der Öffentlichkeit präsentierte. Und es spiegelt sich ferner ganz konkret in der aktuellen Gewalt gegenüber dem "Ausländer" wieder.
[FN_16: H. Willems u.a., Fremdenfeindliche Gewalt, Opladen 1993, S. 190 ff.]
Sie geschieht nämlich vorerst auf der Straße und wird von Beschreibungen und Behauptungen darüber motiviert, was diese "Ausländer" so alles tun, genauer gesagt, so alles anders tun. Sie seien "kriminell", ja "anomal", ja "abartig". Damit ist zugleich belegt, wie der Ethnisierungsprozeß zwar zunächst im Alltag und gegenüber dem "Ausländer" eingesetzt wird, dann aber schnell zurückwirkt, also auch in komplexeren gesellschaftlichen Zusammenhängen erkennbar wird und schließlich auch der Selbstidentifikation der beteiligten Machtträger dient. Aus einem alltäglichen Prozeß wird auf diesem Weg eine systemische Konstruktion und aus der Etikettierung des "Ausländers" entsteht schließlich die Vorstellung vom "Deutschen".
Ganz offensichtlich handelt sich hier um eine umfassende gesellschaftliche Operation, die zwar an einem bestimmten Schnittpunkt der Gesellschaft anfängt, aber von Beginn an auf den Gesamtzusammenhang zielt. Deshalb wäre es auch falsch, die jeweils wirksamen Motive in irgendwelchen verbliebenen Alltagsnischen oder gar der Andersartigkeit des Einwanderers zu suchen. Die Motive sind ganz im Gegenteil dort zu suchen, wo solche umfassenden gesellschaftlichen Operationen überhaupt nur denkbar sind, im Zentrum der politischen Kultur, dort, wo über Fragen der Struktur und Entwicklung von Gesellschaft diskutiert wird. Die Konstruktion von ethnischen Minderheiten stellt tatsächlich nur einen ersten Schritt dar und hat ursächlich nichts mit der Einwanderung neuer Bevölkerungsgruppen, sondern mit Auseinandersetzungen
[Seite der Druckausg.: 18]
innerhalb der politischen Kultur zu tun, in einem Rahmen, in dem es einfach opportun erscheint, ethnisierende Operationen einzuführen. Die Konstruktion ethnischer Minderheiten ist nur ein - wenn auch folgenreicher - Indikator für diesen Sachverhalt.
3.2 Unter diesen Voraussetzungen ist es auch recht instruktiv, Ethnisierungsprozesse noch genauer im Alltag nachzuzeichnen. Dazu sollen an dieser Stelle allerdings nur einige Hinweise gegeben werden. Mehr würde den gesteckten Rahmen überschreiten.
Man kann beispielsweise beobachten, wie Wohnraumprobleme, Arbeitsplatzfragen, Überlegungen zur Ausgestaltung des Stadtquartieres, Zugänge zur Ausbildung, Risiken bei Versicherungen (etwa KfZ-Versicherungen) und vieles mehr zunehmend unter ethnischen Gesichtspunkten diskutiert werden. Natürlich gibt es das Phänomen Wohnraumknappheit, Arbeitsplatzmangel, Verfall bestimmter Stadtquartiere usw., aber hier wird ein Problemmanagement entworfen, bei dem ohne Rücksicht auf Ursachen wie Folgen ethnische Kriterien streng wertrational zur Risikominimalisierung eingeführt werden. Wie geschieht das? Erst einmal geht es darum, die Dinge auf der Straße oder am Stammtisch zur Sprache zu bringen und so zurechtzuschneiden, daß sie gegen den "Fremden" auszumünzen sind. Erst sehr viel später wird danach gefragt, wie sich diese Sicht der Dinge strukturell verankern läßt. Erst einmal muß jedermann klar geworden sein, daß die Wohnraumverknappung weder mit Spekulation, noch mit dem Druck geburtenstarker Jahrgänge, noch den enorm gestiegenen Raumansprüchen usw. zu tun habe. Dann kann man erfolgreich ethnische Minderheiten aus dem Wohnungsmarkt herausdrücken und Regelungen ersinnen, die das dann formal untermauern. Erst wenn diese Sicht der Dinge selbstverständlich geworden ist, eben daß die Isolierung der türkischen Bevölkerungsgruppe weder mit Diskriminierung, noch mit ungleichen Lebensbedingungen oder einem unzureichenden Zugang zum Arbeitsmarkt zu tun habe, kann man Minderheiten noch der zweiten oder gar der dritten Generation das Wahlrecht vorenthalten.
Solche Beobachtungen im Alltag führen dazu, einen Bogen von einer zunächst einmal einfachen ethnischen Aufladung der Alltagskommuni-
[Seite der Druckausg.: 19]
kation bis hin zu komplexen Zusammenhängen zu entdecken. Anfangs wird z.B. bei abweichendem Verhalten statistisch nicht nur zwischen Frauen und Männern, Kindern und Erwachsenen usw., sondern eben auch zwischen Deutschen und Ausländern unterschieden. Zum Schluß wird die gesamte Kriminalstatistik unter dem Vorzeichen Deutscher - Ausländer neu sortiert und umfassend reorganisiert. Dieser Argumentationsbogen läßt sich besonders gut vor den Bundestagswahlen beobachten - erst neuerdings wieder vor den Bundestagswahlen 1994. [FN_17: Der Spiegel Nr. 24 vom 13.6.1994, "Der Kriminologe Ch. Pfeiffer über Bonner Tricks".]
3.3 Betrachtet man den Gesamtzusammenhang, angefangen von den eher einfachen alltäglichen Vorgängen bis hin zu dem Punkt, wo Minderheiten als ethnische Minderheiten in der gesellschaftlichen Struktur verankert werden, so wird deutlich, daß die ersten Schritte im Alltag eine notwendige Voraussetzung für eine strukturelle Verankerung der Ethnisierung von Minderheiten darstellen. Es bedarf einfach zunächst der Platzierung und einer entsprechenden Bewertung der Ethnizität im Alltagsleben. Erst wenn die ethnischen Merkmale ein mehr oder weniger selbstverständlicher Bestandteil des Alltags geworden sind, also ihr (denkt man an die mitteleuropäisch-nationalstaatliche Zeit) "traditionelles" Gewicht wiedererlangt haben, ist es möglich, systemische Zusammenhänge wie etwa das Bildungssystems ethnisch zu "imprägnieren". Erst wenn, um beim letzten Beispiel zu bleiben, klar ist, daß ein Schüler mit türkischer Herkunftssprache eine abweichende Sprache spricht, eine abweichende Einstellung mitbringt, kann man in der Grundschule, die ja die Kinder eigentlich in der Familie "abholen" soll, folgenlos Türkisch als Unterrichtssprache ignorieren und später solche Kinder, die mit dem Unterricht allein sprachlich nicht mitkommen, schließlich aus dem Regelunterricht dispensieren: [FN_18: Entsprechende Untersuchungen werden zur Zeit von einer Forschergruppe in Bielefeld durchgeführt. F.O. Radtke, Migrantenkinder in Bielefelder Schulen, DFG-Pro-jekt, Bielefeld 1993.]
"Wo diese Neubewertung der Ethnizität nicht vollzogen wird, bilden sich auch nicht die angestrebten ethnischen Barrieren. Immer wieder stellt man bei der Untersuchung über Jugendzen-
[Seite der Druckausg.: 20]
tren fest, daß sich zwar die deutschen und die "ausländischen" Jugendlichen voneinander abschotten, aber die verschiedenen nichtdeutschen Bevölkerungsgruppen untereinander zumeist offen miteinander verkehren."
Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Ethnisierung von Minderheiten weitgehend abgeschlossen und in verschiedener Hinsicht längst strukturell effektiv verankert ist. Insofern kann man heute von einer erfolgreichen Ethnifizierung der Sozialstruktur der Bundesrepublik sprechen. Diese Verankerung ist bereits so wirksam, daß sie den eigentlichen Kern der Problematik, daß nämlich überhaupt noch in fortgeschrittenen Industriegesellschaften ethnisch zugerechnet wird, häufig schon verdeckt. F. O. Radtke und andere haben in diesem Kontext durchaus zu Recht die Diskussion über "Multikulturelle Gesellschaft" kritisiert. Diese Diskussion verdeckt allzuleicht den eigentlichen Grundskandal, nämlich die Ethnifizierung der Struktur der Gesellschaft und damit vor allem die ethnische Zurechnung von Mitgliedschaftsrollen innerhalb der Gesellschaft.
Die Konstruktion ethnischer Minderheiten ist also nicht nur ein mehr oder weniger unerfreulicher Akt, weil er mit Diskriminierung einhergeht. Was hier auf dem Spiel steht, ist die Mitgliedschaftsrolle innerhalb einer Gesellschaft, der man unentrinnbar ausgeliefert ist. Im Vollzug der Konstruktion ethnischer Minderheiten wird die Mitgliedschaftsrolle, wie sie die bürgerliche Gesellschaft vorsieht, speziell für diese Menschen nachhaltig verändert, ja unterlaufen. Seit der Aufklärung gab es den Trend, den Menschen an dem Ort, an dem sie nun einmal leben, zunehmend Rechte einzuräumen. Erst ging es darum, überhaupt jedem eine gewisse Rechtsfähigkeit zuzugestehen. Dann ging es darum, die Gleichheit der Gesellschaftsmitglieder rechtlich zu verankern. Diese Tendenz wird heute mit der ethnischen Konstruktion bestimmter Bevölkerungsgruppen erfolgreich hintertrieben. Insofern vollzieht sich hier eine Refeudalisierung der Gesellschaft. Es stünde den großen gesellschaftlichen Gruppen speziell auch bis hin zu den großen politischen Parteien, den sogenannten Volksparteien, die sich sonst und durchaus zu Recht immer wieder auf die Aufklärung und speziell die Westbindung der Bundesrepublik beziehen, gut an, an diesem Punkt etwas sensibler
[Seite der Druckausg.: 21]
zu werden. Dies bleibt freilich eher Wunschdenken. Statt die Demokratisierung der Gesellschaft abzuschließen, wird auf einen neuen ethnisch ausgewiesenen Nationalstaat abgehoben. Und dabei werden zunehmend rechtliche Gründe angeführt, warum dem "Ausländer" keine bürgerlichen Rechte, wie z.B. das Wahlrecht, zustünden.
[FN_19: W.-D. Bukow, Ausländerwahlrecht, Köln 1989.]
4. Folgerungen
In dieser rechts-positivistischen Verfahrensweise wird ganz bewußt darauf verzichtet, von einem politischen Gestaltungsanspruch gegenüber dem Rechtssystem Gebrauch zu machen.
[FN_20: Vgl. die im vorliegenden Heft vorgetragene Position der SPD.]
Am Schluß sollen einige gesellschaftliche Folgen dieser Entwicklung angedeutet und einige gesellschaftspolitische Konsequenzen skizziert werden.
4.1 Es ist ganz klar, daß eine Ethnifizierung der Gesellschaftsstruktur die formal-rationale Basiskonstruktion fortgeschrittener Industriegesellschaften nachhaltig gefährdet. Und Belege für diese These finden sich überall. Man braucht sich auch keineswegs auf die Bundesrepublik zu beschränken. In anderen Ländern sind ähnliche Tendenzen zu beobachten. Insbesondere in den östlichen Ländern und hier gerade auch im ehemaligen Jugoslawien wird deutlich, welche gesellschaftlichen Folgen eine Ethnifizierung der Sozialstruktur hat. Sie belegt, welche Explosivkraft hierin steckt, zumal wenn damit offene Machtkonflikte um die Vorherrschaft innerhalb des Landes "bewältigt" werden sollen. Natürlich sind die Konflikte und Verwerfungen, die sich zur Zeit in der Bundesrepublik anstauen, nicht mit denen zu vergleichen, die dort auftreten, wo, wie z.B. in Bosnien, die alten Machteliten ums Überleben kämpfen. Aber auch bei uns werden bereits Potentiale bereitgestellt, die bei Bedarf, etwa bei einer weiter steigenden Arbeitslosigkeit oder Wohnungsknappheit durchaus wirksam werden können. Wie anders ist es zu deuten, wenn im Mannheimer Stadtteil Käfertal die "Ohrfeige" einer türkisch-
[Seite der Druckausg.: 22]
stämmigen Frau zu einem Straßenkampf zwischen deutschen und türkischen Bevölkerungsgruppen führte. Im Mai 1994 wurden bereits zwei Fälle dieser Art registriert.
Die Ethnisierung ganzer Bevölkerungsgruppen ist zum einen die Folge politischer Versäumnisse in den letzten zwanzig Jahren, während der z.B. beharrlich geleugnet wurde, daß die Bundesrepublik ein Einwanderungsland geworden ist
[FN_21: Vgl. K.J. Bade (Hrsg.), Deutsche im Ausland - Fremde in Deutschland. Migration in Geschichte und Gegenwart, München 1992.]
und deshalb einer vernünftigen Einwanderungsgesetzgebung bedarf. Sie ist aber auch die Folge eines weltweiten Trends der ethnischen Dramatisierung von Konflikten.
[FN_22: Vgl. Offe, Ende, a.a.O, S. 146 ff.]
Die Ethnisierung von Bevölkerungsgruppen wird zunehmend zu einer weltweit eingesetzten innergesellschaftlichen Konfliktstrategie. Nicht immer erhält sie dabei freilich sogleich eine rassistische Unterfütterung. Oft genug kommt sie zunächst in einem recht unverfänglichen Gewand daher. Und oft genug wird sie dabei sogar noch über wissenschaftliche Argumente gestützt. Ich erinnere nur an die Geschichte der Ausländerpädagogik.
[FN_23: W.-D. Bukow, Leben in der multikulturellen Gesellschaft, Opladen 1993, und A. Treibe!, Migration in modernen Gesellschaften, Weinheim/München 1990.]
Und diese inneren Versäumnisse bzw. äußeren Einwirkungen dauern an. Es wird zunehmend selbstverständlich, Gesellschaften mit kulturellen Leitdifferenzen zu versehen. Schon zeichnet sich ein lagerübergreifender Konsens dahingehend ab, daß fortgeschrittene Industriegesellschaften vom kulturellen Zerfall bedroht sind und deshalb einer neuen ethnisch aufgeladenen Identität bedürfen. Der Soziologe U. Beck warnt hier zu Recht vor einer neuen Gegenmodernisierung.
[FN_24: U. Beck, Die Erfindung des Politischen, Frankfurt/M. 1993, S. 91 ff.]
"Die von festen kulturellen Bindungen freigesetzten Individuen konstruieren Eigenes und Fremdes danach eher willkürlich, fluide, temporär und wechselhaft, und zwar eher nach Maßgabe der Konkurrenz um Vorteile (Rechte) und Ressourcen und der Ausübung von Macht als nach dem Grad der Irritation übel-kulturelle Fremdheit."
[FN_25: Ebd., S. 124.]
[Seite der Druckausg.: 23]
4.2 Wenn die heutigen Minderheiten sich vor allem einer polemischen ethnischen Konstruktion verdanken, wenn sie das Produkt einer machtfixierten und ins Ethnische transformierten kulturellen Kommunikation sind, dann muß man auch an dieser Stelle und nicht an irgendwelchen Symptomen einsetzen, wenn es darum geht, Alternativen zu formulieren und durchzusetzen. Es geht also nicht darum, welche Bedeutung die Ethnizität "an sich" haben mag, sondern darum, den Gestaltungsspielraum der politischen Kultur z.B. gegenüber rechtspositivistischen Verengungen oder populistischer Stammtischverherrlichung zu nutzen. Es ist notwendig, die Rolle des Menschen in einer fortgeschrittenen Industriegesellschaft rational und aufgeklärt durchzubuchstabieren, dem rationalen Argument neue Chancen einzuräumen.
Wer die formal-rationalen Auswirkungen moderner gesellschaftlichen Entwicklung für sich in Anspruch nehmen möchte, wer sich der modernen Technik, der modernen Verwaltungssysteme, des Marktes, der Wissenschaft, des Rechtssystems usw. bedient, muß diese Inanspruchnahme auch anderen Gesellschaftsmitgliedern zugestehen. Formal-rationale Systeme lassen sich nämlich nur sozial-universal auf alle Gesellschaftsmitglieder umgesetzt garantieren. Und wer sich angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung mit neuen Risiken und Verwerfungen konfrontiert sieht, muß sich ihnen formal-rational stellen, und wird es sich nicht leisten können, sie imaginär auf bestimmte Bevölkerungsgruppen abzuwälzen. Die kulturelle Kommunikation muß hier freilich nicht nur dazu befähigt werden, mit der sonstigen gesellschaftlichen Entwicklung Schritt zu halten, sondern müßte eigentlich auch wegweisend wirksam werden. Vor diesem Hintergrund erscheinen Versuche, Gesellschaftsstrukturen zu reethnifizieren, nicht nur historisch überholt, sondern gleichzeitig zweifach gefährlich. Sie ignorieren die realen gesellschaftlichen Entwicklungen, und sie bewirken eine imaginäre Rückwendung. Ganz praktisch wäre zunächst einmal erforderlich, alle Tendenzen zur Ethnisierung von Konflikten und Problemlagen zu kritisieren und zu überwinden.
- Eine vollständige Gleichstellung ethnischer Minderheiten wäre dazu nur ein allererster Schritt. Zu denken wäre hier zunächst an eine
[Seite der Druckausg.: 24]
vollständige rechtliche Gleichstellung, etwa jedem auf dem Territorium der Bundesrepublik geborenen bzw. mehr als eine bestimmte Zeit wohnhaften Menschen automatisch die vollen Bürgerrechte einzuräumen. Darüber hinaus müßte der gesamte Rechtskodex und das ganze Erlaßwesen der Behörden von Ausländer diskriminierenden Bestimmungen, sie benachteiligenden Formulierungen u.a.m. bereinigt werden.
- Weitere Schritte müßten darin bestehen, die kulturelle Kommunikation selbst von Ethnifizierungen zu befreien. Die verschiedenen Spielarten der Ethnifizierung von Gesellschaftsstruktur müssen mit der gleichen Beharrlichkeit kritisiert und abgebaut werden wie im Verlauf der jüngeren Geschichte die Gesellschaft auch sonst säkularisiert wurde.
- In dem Maß, in dem die Gesellschaftsstruktur von ethnischen Zuschreibungen befreit wird, wird es möglich, regionalen, landsmannschaftlichen bzw. ethnisch ausgewiesenen Traditionsbeständen einen angemessenen kulturellen Raum zuzugestehen. Dazu ist es erforderlich, solche Traditionsbestände bzw. Wir-Gruppen-Bindungen entsprechend zu fördern. Die Verstärkung von Regionalität, Landsmannschaftlichkeit und Ethnizität als Hintergrund für die persönliche Entfaltung verhindert dann gerade eine Ethnifizierung von Gesellschaftsstrukturen, wie eine Förderung der religiösen Unterweisung an den Schulen die Säkularität der schulischen Bildung zu unterstreichen vermag.
Meine These ist, daß endlich mit einer konsequenten Politik der Gleichstellung von Minderheiten begonnen werden muß, wobei die Versäumnisse von mindestens dreißig Jahren nachzuholen sind. Dies mag durchaus auch von einer angemessenen Förderung lokaler, regionaler, landsmannschaftlicher wie ethnischer Orientierungen begleitet werden. Es muß das Ziel der Politik sein, unter dem Dach fortgeschrittener Industriegesellschaften der Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger ganz gezielt Raum zu geben. Freilich, solange sich einer solchen Tendenz partikular fixierte Machtgruppen entgegenstellen und aus tatsächlich rein chauvinistischen Motiven ganze Bevölkerungsgruppen ethnisieren, be-
[Seite der Druckausg.: 25]
darf es weiterer flankierender Maßnahmen wie z.B. eines Antidiskriminierungsgesetzes und zu deren Durchsetzung besonderer Verwaltungsstäbe (Multikulturelle Ämter), welche auf die Einhaltung demokratischer Spielregeln gegenüber Minderheiten achten und den schon fast selbstverständlichen alltäglichen Rassismus [FN_26: Vgl. Der Spiegel, Nr. 25/1994, S. 51.] vor Ort, also direkt im Alltag bekämpfen.
[Seite der Druckausg.: 26 = Leerseite]
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Mai 2003