

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
-
Heribert Adam
- 1. Sozialdemographie im historischen Vergleich
- 2. Kanadische Einwanderungspolitik
- 3. Fremdenhaß
- 4. Multikulturalismus in Kanada
- 5. Forcierte Chancengleichheit
- 6. Multikulturalismus oder Assimilation?
- Ausgewählte Bibliographie zum Thema Multikulturalismus und Einwanderungspolitik in Kanada
- [Fußnotenverweise]
Kanadische Einwanderungspolitik, Fremdenfeindlichkeit und Multikulturalismus im Vergleich
[Seite der Druckausg.: 7]
1. Sozialdemographie im historischen Vergleich
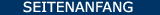
Heribert Adam
Kanadische Einwanderungspolitik, Fremdenfeindlichkeit und Multikulturalismus im Vergleich[1]
Kanada als multikulturelles Einwanderungsland mit relativ harmonischen Gruppenbeziehungen wird zunehmend als Vorbild für andere, weniger tolerante Staaten angepriesen. Die kanadische Regierung und Presse behandelt Multikulturalismus als Exportware und sonnt sich im Lichte weltweiter Friedensbemühungen, Menschenrechtsverpflichtungen und liberaler Flüchtlingsaufnahmen. Das romantisierende Selbstbild ist nicht nur wirklichkeitsfremd, sondern auch politisch gefährlich, weil es die potentielle Intoleranz verleugnet oder als Abirrung pathologischer Einzelgänger erklärt. Wie spätestens seit dem Milgram-Experiment bewiesen wurde, ist jedoch Aggression gegen Andere oder Fremde nicht auf einen bestimmten Nationalcharakter beschränkt. Unter bestimmten Bedingungen können Ressentiments gegen künstliche Feindgruppen in jeder Gesellschaft mobilisiert werden. Sündenböcke werden überall gefunden, wenn sie gebraucht werden. In jedem steckt ein potentieller Faschist. Die Einsicht in das "Normale" des autoritären Charaktersyndroms gehört zu den grundlegenden Voraussetzungen seiner versuchten Veränderung. Ausländerfeindlichkeit als "typisch deutsch" zu präsentieren ist deshalb genauso falsch wie die kanadische Illusion, gegen Rassenhaß immun zu sein. Im Gegenteil, die deutsche Vergangenheit und bewußte demokratische Umerziehung, so läßt sich vermuten, haben günstigere Vorbedingungen geschaffen, Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen, als es die verbreitete selbstgefällige Leugnung solcher Einstellungen in Kanada erlaubt.
Immerhin besitzt Kanada bis in die jüngste Vergangenheit eine an rassischer Diskriminierung reiche Einwanderungsgeschichte, die der süd-
[Seite der Druckausg.: 8]
afrikanischen Apartheid nur in Nuancen nachsteht. Abgesehen von den besonders marginalisierten indianischen Ureinwohnern (2 % der Bevölkerung) waren chinesische Arbeitsmigranten seit 1867 das Hauptziel von Vorurteilen, obwohl sie beim Eisenbahnbau, als Bergarbeiter und Hausgehilfen wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beitrugen. 1885 wurden chinesische Einwanderer mit einer Kopfsteuer belegt, um die "gelbe Überfremdung" einzudämmen. Zuwanderer aus Indien durften nur mit Frachtern, die ohne Zwischenaufenthalt direkt in einem kanadischen Hafen anlegten, einreisen, weil solche Verkehrsverbindungen nicht existierten. Sikhs, die als Holzfäller in Britisch Kolumbien seit 1885 arbeiteten, wurden besonders verachtet. Noch heute streiten sich die kanadischen Gemüter trotz offiziellem Multikulturalismus, ob Sikhs als Angehörige der mythologisierten Bundespolizei (RCMP) ihren von der Religion vorgeschriebenen Turban tragen dürfen. Kanadier japanischer, jedoch nicht deutscher Abstammung, wurden während des zweiten Weltkrieges als potentielle Kollaborateure ins Innere des Landes deportiert und enteignet. Unter allen westlichen Ländern hat Kanada proportional die wenigsten verfolgten Juden aufgenommen (Abella and Troper 1982). Noch bis 1964 mußten schwarze Kanadier, deren Vorfahren als englische Loyalisten nach der amerikanischen Revolution nach Kanada auswanderten, separate Schulen in Ontario besuchen.
Erst Mitte der sechziger Jahre, als die Wirtschaftentwicklung in Europa die Zahl der europäischen Einwanderer drastisch verringerte, wurden Kanadas Einwanderungsbestimmungen "farbenblind". Seitdem hat die zunehmende Zahl der Zuwanderer aus der Dritten Welt wegen ihrer nicht assimilierbaren Hautfarbe das gewohnte Erscheinungsbild und die Gruppenbeziehungen der kanadischen Gesellschaft noch tiefgreifender als in Deutschland auf Dauer verändert.
Das klassische Einwanderungsland Kanada und das vergleichsweise überbevölkerte Deutschland gehören zur Gruppe der sieben reichsten Industriestaaten mit der höchsten Lebensqualität und einem beachtlich hohen Einkommensniveau. Beide Länder sind daher begehrtes Ziel für Migranten aus der ganzen Welt. Ein liberales Asylrecht und der Arbeitskräftemangel während der frühen Boomjahre hat in beiden Gesell-
[Seite der Druckausg.: 9]
schaften die Rolle des Einwanderers über das soziologische Interesse hinaus zu explosiven Ressentiments thematisiert. Ein Bevölkerungswachstum ist in beiden Staaten nur durch Zustrom von außen gewährleistet, da das natürliche Geburtenwachstum mit 1,7 % in Kanada unter der Reproduktionsrate liegt. Beide hoch entwickelte Sozialstaaten benötigen junge Zuwanderer, um soziale Verpflichtungen gegenüber einem wachsenden Anteil älterer Bürger einlösen zu können. Beide Staaten profitieren vom Zustrom qualifizierter Arbeitskräfte und arbeitswilliger Neuankömmlinge, deren Ausbildungskosten anderswo getragen wurden und deren Motivation und Produktivität die der Einheimischen oft übersteigt.
Trotz dieser strukturellen Ähnlichkeit zweier westlicher Wohlfahrtsstaaten unterscheiden sich die politische Kultur und Institutionen in Kanada und Deutschland beträchtlich. Eine rationale Einwanderungspolitik, das multikulturelle Selbstverständnis zweier Gründungskulturen in Kanada, die unterschiedlichen ökonomischen und geographischen Faktoren resultieren in grundsätzlich toleranteren und humaneren Umgangsformen als in Deutschland. Progressive Gesetze und vielfältige soziale Praktiken regeln und erleichtern die Integration von Immigranten, verglichen mit der deutschen offiziellen Haltung, die die de facto Immigration de jure verleugnet. In den letzten Jahren haben beide Staaten ungefähr die gleiche Zahl von Neuankömmlingen, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, absorbiert.
Mit 250 000 Immigranten jährlich repräsentieren die Zuwanderer knapp ein Prozent (0,92 %) der kanadischen Gesamtbevölkerung. Dies ist die höchste Aufnahmerate der westlichen Länder, besondern wenn sie mit den anderen klassischen Einwanderungsländern Australien (0,46 %) und den USA (0,42 %) verglichen wird. 16 % der kanadischen Bevölkerung sind nicht im Lande geboren. Zwar ist der deutsche jährliche Zuzug einschließlich der Aussiedler, Arbeitsmigranten und Asylflüchtlinge im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung nicht viel geringer, setzt sich jedoch immer noch in der Mehrheit aus Zuwanderern aus dem europäischen Raum zusammen, von denen wiederum ein Großteil unter der rechtlichen Fiktion deutscher Volkszugehörigkeit einreist und entsprechend empfangen wird. Die Herkunftsländer der kanadischen Einwanderer er-
[Seite der Druckausg.: 10]
strecken sich jedoch jetzt fast proportional über alle Staaten der Welt, und im Gegensatz zu Deutschland sind die Mehrzahl der Neuankömmlinge nicht europäischer ("nicht-weißer") Abstammung. Fast 50 % der Zuwanderer kommen jetzt aus Asien.
Tabelle 1:
Zehn wichtigste Herkunftsländer der Einwanderer nach Kanada
1980 und 1991
1980 |
1991 |
||||
HERKUNFT |
ANZAHL |
% |
HERKUNFT |
ANZAHL |
% |
VIETNAM |
25643 |
17,9 |
HONGKONG |
22340 |
9,7 |
GROSS-BRITANNIEN |
18250 |
12,7 |
POLEN |
15731 |
6,8 |
USA |
9934 |
6,9 |
CHINA |
13915 |
6,0 |
INDIEN |
8486 |
5,9 |
INDIEN |
12848 |
5,6 |
HONGKONG |
6309 |
4,4 |
PHILIPPINEN |
12335 |
5,3 |
LAOS |
6287 |
4,4 |
LIBANON |
11 987 |
5,2 |
PHILIPPINEN |
6053 |
4,2 |
VIETNAM |
8963 |
3,9 |
CHINA |
4943 |
3,4 |
GROSS-BRITANNIEN |
7553 |
3,3 |
PORTUGAL |
4208 |
2,9 |
EL SALVADOR |
6977 |
3,0 |
KAMBODSCHA |
3270 |
2,3 |
SRI LANKA |
6826 |
3,0 |
Quelle: Employment and Immigration Canada, Immigration to Canada: A Statistical Review, Nov. 1989
Diese Kategorie von Staatsangehörigen wird unsinnigerweise als "sichtbare Minderheit" ("visible minority") klassifiziert, als ob die Mehrheitsbevölkerung europäischer Herkunft "unsichtbar" wäre. In Wirklichkeit verhält es sich jedoch gerade umgekehrt: In den politischen und ökonomischen Entscheidungsgremien, in den Eliten, Massenmedien, Repräsentationsritualen und Staatssymbolen dominieren die englisch-französischen Segmente und die "sichtbaren" Minderheiten bleiben unsichtbar.
[Seite der Druckausg.: 11]
Der Einwand, daß das geographisch viel größere Land viel mehr Platz bietet, verblaßt, wenn man bedenkt, daß 90 % der Kanadier innerhalb eines 100 km breiten Streifens zwischen dem 45. und 50. Breitengrad wohnen und daß die Mehrheit aller Immigranten sich in den drei großen Städten Toronto, Montreal und Vancouver ansiedeln.
Tabelle 2:
Ethnische Herkunft der Bevölkerung Kanadas und der Einwohner der drei größten Metropolen des Landes:
Volkszählung 1991 - 20 % Stichprobe
|
KANADA |
MONTREAL |
TORONTO |
VANCOUVER |
|
Gesamtbevölkerung |
26.994.045 |
100,0 % |
3.091.115 |
38631055 |
1.584.115 |
BRITISCH |
5.611.050 |
20,8 % |
166.815 |
747. 250 |
365.760 |
FRANZÖSISCH |
6.146.600 |
22,8 % |
1.824.305 |
52.080 |
28.160 |
SONSTIGE EUROPÄISCH |
4.146.065 |
15,4 % |
437.545 |
1.016.705 |
257.185 |
ASIEN/AFRIKA |
1.633.660 |
6,1 % |
187.435 |
628.835 |
317.295 |
PAZIF. INSELN |
7.215 |
0,1 % |
10 |
355 |
4.865 |
LATEIN-/ZENTR. AMERIKA |
85.535 |
0,3 % |
24.905 |
26.410 |
6.000 |
KARIBIK |
94.395 |
0,4 % |
24.895 |
50.660 |
1.335 |
SCHWARZE |
224.620 |
0,8% |
38.650 |
125.610 |
4.885 |
UREINWOHNER |
470.615 |
1,7 % |
12.730 |
6.440 |
12.570 |
MEHRFACH- |
7.794.250 |
28,9 % |
363.300 |
939.225 |
560.005 |
Quelle: Statistics Canada, Ethnic Origins, Ottawa: Industry, Science and Technology, Canada 1993.1991 Census of Canada. Cat. Nr. 93-315
Vor allem Toronto und Vancouver verkörpern einen Mikrokosmos der Weltbevölkerung, in denen jetzt Einwanderer aus allen Ländern Asiens die am schnellsten wachsende ethnische Gruppe darstellen. 1986 lebten 78,6 Prozent aller Immigranten in Städten mit über 100 000 Einwohnern, verglichen mit 45,9 % des in Kanada geborenen Bevölkerungsteils (Desilva 1992, S.6).
[Seite der Druckausg.: 12]
Ethnische Herkunft wird in der kanadischen Volkszählung mit zwei Fragen ermittelt: "Welche Sprache lernten Sie zuerst als Kind und beherrschen Sie auch heute noch einigermaßen?", "Welches war die ethnische Herkunft Ihrer Familie, als sie ursprünglich sich in Kanada ansiedelten?". Während die Antworten auf diese Fragen Ethnizität objektiv bestimmen, beruht die Identifizierung "sichtbarer" Minderheiten einzig auf subjektiven Kriterien, also Selbstidentifikation.
Überraschend ist die hohe Zahl von einem Drittel der Gesamtbevölkerung, die Doppel- oder Mehrfach-Herkunftsangaben machen. Diese vor allem englisch-französischen Mischidentitäten und andere multi-ethnische Partnerschaften in der Geschichte des Landes bezeugen eine relativ hohe soziale Integrationsbereitschaft, die nicht in allen Einwanderungsländern die Norm ist. In Südafrika oder Israel zum Beispiel gibt es wenig inter-kulturelle Ehen.
2. Kanadische Einwanderungspolitik
Grob gesagt selektiert Kanada seine Zuwanderer nach drei Kategorien:
- Familienzusammenführung,
- unabhängige Bewerber und
- Flüchtlinge.
Zwischen 1980-89 entfielen auf die erste Gruppe 39 % auf die Unabhängigen 48 % und 18 % auf die Flüchtlinge (Economic Council, 1991, S.4). Jede Kategorie hat verschiedene Untergruppen, deren Definition und Ausleseverfahren vielfach geändert wurde.
Offiziell wird die Einwanderungspolitik von vier Erwägungen geleitet:
- wirtschaftlicher Nutzen,
- politische Auswirkungen,
- soziale Verkraftbarkeit und Integrationschancen,
- humanitäre Erwägungen.
[Seite der Druckausg.: 13]
Die vier Motivationen stehen öfter in Widerspruch zueinander. So können humanitäre Erwägungen verstärkter Flüchtlingszulassungen durch höhere soziale Kosten den wirtschaftlichen Nutzen von Einwanderung gefährden oder die soziale Belastbarkeit strapazieren. In dem politisch umstrittenen Entscheidungsprozeß haben ökonomische Nutzenerwägungen generell den Ausschlag gegeben. Die Zulassungskriterien von bestimmten Berufen hängen von der Arbeitsmarktlage ab; Investoren, die bereit sind, $ 250000 für fünf Jahre zu investieren, erhalten die Aufenthaltsgenehmigung ohne Umschweife; jüngere und besser ausgebildete Bewerber haben größere Chancen, in einem differenzierten Punktesystem erfolgreich zu sein. Aber auch die Quote der ökonomisch weniger ertragreichen Familienzusammenführung und Flüchtlingsaufnahme wurde unter dem politischen Druck organisierter Einwandererorganisationen, von Kirchen und auf Einwanderungsfälle spezialisierten Rechtsanwälten erhöht. Derzeit werden nur 15 % aller Einwanderer nach dem Punktesystem ausgewählt, gegenüber 32% 1971 (The Globe & Mail, 16. September 1993).
In der Flüchtlingskategorie unterscheidet Kanada zwei Gruppen: Flüchtlinge in Lagern im Ausland, denen nach sorgfältiger Auswahl Einreisevisa unter internationalen Vereinbarungen gewährt werden, und Asylsuchende, die in Kanada selbst um Aufnahme nachsuchen. Ähnlich wie in Deutschland hat jeder Asylflüchtling, der sich auf kanadischem Hoheitsgebiet befindet, Anspruch auf Aufenthalt, Unterstützung und Arbeitserlaubnis, bis sein Fall individuell von verschiedenen Gremien überprüft wird. Trotz der weit geringeren Zahl von 37.720 Personen in dieser Gruppe (1992) hat sich ähnlich wie in Deutschland wieder eine große Zahl von ungeklärten Fällen angestaut, seit 1986 eine Generalamnestie erklärt worden war. Allerdings liegt die gegenwärtige Anerkennungsquote mit 57 % weit höher als in vergleichbaren Ländern, besonders Deutschland mit 4 %[2] . Fast identisch mit der jüngsten deutschen Praxis sind die schon länger in Kraft gesetzten Eingrenzungsmaßnahmen, um den Zustrom von sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen durch Visapflicht oder automatische Abschiebung in sichere
[Seite der Druckausg.: 14]
Drittländer einzudämmen. Anders als Deutschland kann Kanada diese Eingrenzungsmaßnahmen damit rechtfertigen, daß potentielle Zuwanderer eine rationale Einwanderungspolitik nicht auf eigene Faust unterminieren dürfen. Wie in Deutschland klagen auch die kanadischen Kommunen, daß sie die steigenden Kosten zentraler Quotenerhöhungen zu tragen haben, ohne auf die Entscheidungen Einfluß ausüben zu können. Vor allem Schulen fordern mehr Unterstützung für den Sprachunterricht. Einige Länder, vor allem Quebec, bestehen darauf, die Einwanderer in ihre Gebiete selbst zu bestimmen. Alle Einwohner von Kanada, einschließlich der Zuwanderer, haben jedoch die freie Wahl des Wohnsitzes, weshalb nördliche und ländliche Gebiete trotz aller Bemühungen kaum Zusiedler anziehen.
Gegenwärtig argumentieren deshalb einflußreiche konservative Stimmen, den Einwandererstrom stärker zu regulieren und vor allem den Anteil an besser qualifizierten Unabhängigen auf Kosten der Familienzusammenführung und Flüchtlingsaufnahme wieder stärker zu erhöhen. Extreme Vorschläge laufen darauf hinaus, die Einwanderungszulassung generell auf dem internationalen Markt gegen Höchstpreise zu verkaufen. Erstaunlicherweise, und im Gegensatz zu Deutschland, ist die Einwanderungspolitik allerdings kaum Gegenstand des Wahlkampfes. Selbst Konservative vermeiden, das Thema anzurühren, um nicht als Rassisten abgestempelt zu werden und die potentiellen "ethnischen Wähler" abzuschrecken.
Nach drei Jahren Aufenthalt kann der Einwanderer die kanadische Staatsangehörigkeit beantragen, die ihm nach einigen rituellen Fragen über die Landesgeschichte und die Verfassung ausgehändigt wird. Das dauernde Aufenthaltsrecht ("landed immigrant Status") des Neuankömmlings ist der Staatsangehörigkeit gleichgestellt, mit dem einzigen Unterschied, daß nur Staatsangehörige das aktive und passive Wahlrecht besitzen. Dem Einwanderer entstehen keinerlei Nachteile, wenn er/sie die Staatsbürgerschaft nicht beantragt.
Die Behörde besitzt bei der kanadischen Einbürgerung keinerlei Ermessensspielraum. Selbst Personen, die der Landessprache nicht mächtig sind, werden regelmäßig eingebürgert, sofern sie die anderen Vor-
[Seite der Druckausg.: 15]
aussetzungen (Aufenthaltsdauer, Unbescholtenheit) erfüllen. Die großzügige Einbürgerung erfolgt in der Erwartung, daß der neue Status die politische und soziale Integration bewirkt und nicht, wie in Deutschland, daß die Integration eine Voraussetzung für die Einbürgerung ist.
Multikulturalismus als Staatsideologie verneint den kulturellen Integrationsdruck, der in Deutschland aus dem Ausländer erst einen Deutschen machen will, bevor der ausländische Inländer akzeptabel ist. Die Mehrheit der Ausländer weiß ohnehin, daß selbst intensive Integrationsbemühungen letztlich scheitern, weil das Urteil über ihren Erfolg von vorurteilsbehafteten "Einheimischen" abhängig ist. Solange Abstammung vorab einen Deutschen bestimmt, hat selbst der integrationswillige Türke keine Chance, als Deutscher anerkannt zu werden, selbst wenn er zu den 1 % Berechtigten gehört, die letztlich den deutschen Paß erwerben.
Im Gegensatz dazu gilt der kanadische Paß als Reisedokument und nicht als Loyalitätsausweis. Zwischen der Einwanderung und dem Erwerb der Staatsangehörigkeit vergehen im Durchschnitt 4 bis 5 Jahre bei Einwanderern aus Asien, Afrika und Lateinamerika, während der typische Zuwanderer aus Europa, den USA und Australien erst nach 15 bis 20 Jahren den kanadischen Paß erwirbt. Die beträchtlichen Unterschiede resultieren aus dem Verbot der Doppelstaatsangehörigkeit und entsprechenden Pensionsrechten einerseits und der ambivalenteren Identifikation mit der neuen Heimat andererseits. Weil Zuwanderer aus der Dritten Welt, besonders aus den Entwicklungsländern des Commonwealth, nicht nur die Möglichkeit der Doppelstaatsangehörigkeit besitzen, sondern öfter ein politisch oder ökonomisch zerrütteltes Herkunftsland verlassen haben, schätzen sie auch den begehrten kanadischen Paß höher ein. Dies deutet auf die größere Integrationsbereitschaft dieser Gruppe hin, während vor allem ältere Einwanderer aus England sich des öfteren nie mit der "kanadischen Kolonie" identifizieren, und stattdessen nostalgisch das Mutterland glorifizieren. Übrigens ist das Datum der Einbürgerung oder der Geburtsort auf persönlichen Dokumenten (Paß, Staatsbürgerschaftsurkunde, Führerschein usw.) nicht vermerkt, so daß sich keine neue Statushierarchie nach Ankunft entwickelt. Im informellen Gebrauch hört man allerdings oft die Wertung "dritte oder vierte Genera-
[Seite der Druckausg.: 16]
tion Kanadier", um einem politischen Argument besonderes Gewicht zu verleihen.
Die aufgeführten Daten verweisen auf den wichtigsten Unterschied zwischen der deutschen und kanadischen Einwanderung. Der Zuzug nach Deutschland war vor 1973 ausschließlich, und ist auch heute noch weitgehend, auf ungelernte oder angelernte Arbeiter beschränkt. Zum Beispiel schloß die mit der Türkei vereinbarte Regelung die Anwerbung von städtischen Facharbeitern aus und rekrutierte "Gastarbeiter" stammen hauptsächlich aus der am wenigsten entwickelten anatolischen Region. Auch die "deutschen" Aussiedler aus der früheren Sowjetunion entstammen nicht gerade reichen oder hochausgebildeten Schichten. In Kanada dagegen verhält sich die Schichtenzugehörigkeit der Einwanderer seit 1967 eher umgekehrt. Das kanadische Punktesystem - sowie die seit einigen Jahren praktizierte Erlaubnis, sich die Immigration durch entsprechende Investitionen in Kanada buchstäblich zu erkaufen - begünstigt die Auslese nach Klassen- und Bildungsherkunft.
Seit der grundlegenden Änderung der Einwanderungsbestimmungen 1967 erreicht ein beträchtlicher Teil der Neuankömmlinge das gelobte Land nicht wie früher als verarmte Ausgestoßene, die sich in der Schichtungshierarchie langsam und über Generationen hocharbeiten, sondern viele transferieren etablierten Reichtum und anderswo erworbene Qualifikationen in das "sichere" Kanada. Bezüglich deutscher Einwanderer nach Kanada wurde dieser Unterschied von einer Doktorantin vortrefflich als der Gegensatz zwischen "Rucksack-Deutschen" in den Kriegsjahrzehnten und "Container-Deutschen" seit dem Wirtschaftsaufschwung charakterisiert. Der entsprechende "brain-drain" aus den Entwicklungsländern, welche die Ausbildungskosten der späteren Auswanderer zu tragen hatten, rechtfertigt durchaus die Forderung nach Ausgleichszahlungen.
[Seite der Druckausg.: 17]
3. Fremdenhaß
Wo der Fremde nicht mit der Unterschicht synonym ist, sondern als gleichberechtigter Staatsangehöriger gilt, kann es kaum eine einheitliche Diskriminierung geben. Die über das gesamte Schichtensystem verteilten Fremden werden oft mehr beneidet als verachtet. Im Prinzip sind jedoch fremdenfeindliche Reaktionen und Integrationskonflikte in beiden Gesellschaften vergleichbar. Die Ausschreitungen in Deutschland und anderswo mögen gegen Ausländer gerichtet sein, während die Rassenkrawalle in Toronto sich gegen eine rassistische Polizei wenden, die kanadische Schwarze als Ausländer behandelt. Eine weitverbreitete Distanz gegenüber "sichtbaren Minoritäten" gleicht dem deutschen Ressentiment gegen "Südländer". Auch in Kanada werden Kinder ethnischer Minderheiten überproportional in Sonderschulen abgeschoben. Programme, um Minderheiten in den Stand zu versetzen, gleichberechtigt am Leistungswettbewerb entsprechend ihren Fähigkeiten teilzunehmen, leiden an Finanzschwäche. Vor allem die marginale Lage der Ureinwohner wird immer noch als Tabu behandelt, was das Image eines Fortschrittslandes beeinträchtigt.
Viele Indianerreservate verwahrlosen wie südafrikanische Bantustans. Während eines Konflikts in Oka, bei dem rebellierende Indianer eine Brücke in Montreal blockierten und der Staat die kanadische Armee aufmarschieren ließ, warfen frustrierte Bürger Steine wie in Rostock. Im Unterschied zu Deutschland wird das Ressentiment nicht erst durch Zuwanderung ausgelöst, sondern richtet sich gegen die Ureinwohner, die schon lange zuvor ansässig waren. Die in Deutschland geborene zweite und dritte Generation von Gastarbeitern wird immer noch unsinnigerweise nach ihrem Herkunftsland kategorisiert. Die kanadische Diskriminierung beweist, daß die Einstellung gegenüber Minioritäten nicht von ihrer Herkunft bestimmt ist.
Fremdenhaß hat deshalb wenig mit der tatsächlichen Minderheit, dem Zustrom oder der Rechtslage der Angegriffenen zu tun. Es ist keine rationale Reaktion auf irrationale Provokation durch den anderen. Der kanadische Sikh mit dem Turban bedroht die Mehrheit genauso wenig wie der verfolgte Homosexuelle die Nazis. Beide bedrohen jedoch eine
[Seite der Druckausg.: 18]
moralische und symbolische Ordnung mit alternativen Wertvorstellungen, die sich der ich-schwache, autoritäre Typ nicht leisten kann. Sein Haß gegen den anderen ist der Haß gegen sich selbst und gegen die Unfähigkeit, mit der täglichen Selbstunterdrückung fertig zu werden.
Diese altbekannte psychoanalytische Deutung der Fremdenfeindlichkeit stellt deshalb als Lösung vor allem auf die autonome Entwicklung des Einzelnen ab. Nur wenn der jugendliche Randalierer genug Selbstvertrauen gewinnt, muß er seine Identität nicht durch Kraftakte gegenüber anderen erwerben. Auf dieser Ebene operiert das nicht-autoritäre kanadische Schulsystem erfolgreicher als die deutsche Erziehung. Das wenig leistungsfähige und nicht-elitäre kanadische Bildungssystem erlaubt zumindest auch dem Verlierer, sich als Gewinner zu fühlen. Wo alle Gewinner sind, gibt es weniger Anlaß, Schuldige für den eigenen Mißerfolg zu erfinden.
4. Multikulturalismus in Kanada
Grundsätzlich können fünf Staatsreaktionen gegenüber ethnischen Minoritäten unterschieden werden. Es wäre ein Sonderthema, aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Folgen welche Politik betrieben wird:
- Eliminierung,
- Deportation oder Sezession,
- Unterdrückung und Segregation,
- Assimilierung und
- Multikulturelle Integration.
Pierre Trudeau schlug im Oktober 1971 Multikulturalismus als Staatsideologie vor, weil alle Versuche gescheitert seien, Kanadas diverse Bevölkerung zu anglizisieren. Gegenüber dem Gutachten einer Parlamentskommission über die offizielle Zweisprachigkeit und Bikulturität des Landes aufgrund seiner englischen und französischen Gründungskulturen wurde eingewandt, daß die 37 % der nicht-englischen und nicht-französischen Bevölkerung unberücksichtigt blieben. Die Antwort
[Seite der Druckausg.: 19]
auf den Protest dieser "Dritten Kraft" (hauptsächlich Ost- und Mitteleuropäer in den Präriegebieten) war Multikulturalismus, eine Verlängerung der Bikulturität. Sie wurde als Politik mit vier scheinbar konfligierenden Zielen definiert: (1) Staatssubventionen für Gruppen, die ihre Herkunftskultur bewahren wollen, (2) Unterstützung bei der Überwindung kultureller Barrieren, die einer demokratischen Beteiligung aller im Wege stehen, (3) Mitwirkung bei interkultureller Verständigung, Toleranz und nationaler Einigung, (4) Unterstützung von Einwanderern beim Sprachunterricht[3]
Hinter den Leerformeln liegt die Anerkennung gleicher Identität. Die kulturelle Hierarchie, die die englische oder französische Herkunftsgruppe höher einstuft als spätere Zuwanderer, wurde theoretisch abgeschafft. Hinsichtlich Schulbüchern oder staatlichen Feiertagen können zum Beispiel alle ethnischen Gruppen gleiche Rechte verlangen. Sie sollen alle repräsentativ vertreten sein, und keine Herkunftsgruppe kann einer anderen ihre Normen, Literatur oder Lebensvorstellungen aufzwingen[4] . Der kanadische Staat hat sich ethnisch neutral und plural definiert, im Gegensatz zu der Schmelztiegelideologie der USA oder dem Assimilationsdruck in Deutschland. Alteinwohner können gegenüber Neuankömmlingen keine Sonderansprüche anmelden. Aus dieser Nivellierung historischer Rechte resultieren die Ablehnung von Multikulturalismus seitens der Quebecer Nationalisten und vor allem der "First-Nation-People", wie die 2 % Indianer sich neuerdings selbst bezeichnen.[5]
[Seite der Druckausg.: 20]
Mulitkulturelle Politik in Kanada hat sich in den zwanzig Jahren ihrer Anwendung durch alle drei Parteien mehrfach gewandelt. In der ersten Phase stand die Zelebrierung unterschiedlicher Lebensstile und exotischer Festlichkeiten klar im Vordergrund. Diese oberflächliche Anerkennung kultureller Diversität hat anti-rassistischen Programmen Platz gemacht. Statt Lebensstil werden jetzt Lebenschancen betont. Trotzdem ist die Kritik von rechts und links keineswegs verstummt. Sie konzentriert sich auf drei Aspekte:
1. Multikulturalismus läßt sich nicht mit nationaler Einheit in Einklang bringen, weil die Politik geteilte Loyalitäten fördert. R. Bibby (1990) beklagt in seinem vielbeachteten Buch "Mosaic Madness" einen kulturellen Relativismus auf Kosten von universellen Standards. Die rechtsgerichtete Reformpartei beharrt darauf, daß es nicht Staatsaufgabe sei, exotische Kulturen mit Steuergeldern am Leben zu erhalten. Andere Kritiker aus diesem Lager weisen nicht mit Unrecht darauf hin, daß selbsternannte ethnische Verbandsfunktionäre das Regierungsinteresse an harmonischen Gruppenbeziehungen geschickt ausbeuten. Subventionierter Multikulturalismus hat sich in der Tat eine Gruppe kooptierter Sprecher geschaffen.
2. Multikulturalismus bedingt Multilingualität, welche die Regierung jedoch nicht zugestehen will. Offizielle Zweisprachigkeit war die Waffe, mit der Ottawa den Quebec-Separatismus zu besiegen hoffte. Quebec jedoch besteht verständlicherweise auf Einsprachigkeit. Wie andere Kulturen ohne Sprache und Sprachförderung bewahrt werden können, bedarf noch der Erklärung, obwohl Ottawa neuerdings auch freiwilligen Sprachunterricht in nicht-offiziellen Muttersprachen subventioniert.
3. Auf der kanadischen Linken dagegen wird Multikulturalismus mit einem "ethnischen Zoo" und einer Museumskultur verwechselt. Diese Kritiker befürchten, daß die Herkunftsförderung eine freiwillige Ghettoisierung bewirkt. Anstatt Minderheiten Fähigkeiten zu vermitteln, die ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, ziele die Staatsintervention auf Kooptation und Appeasement ab. Nichtsdestoweniger wird Multikulturalismus von allen drei kanadischen Parteien getragen, nicht zuletzt deshalb, weil sie alle die Wählerstimmen der Einwanderer und "Dritten
[Seite der Druckausg.: 21]
Kraft" benötigen. Als Monokulturalist abgestempelt zu sein, käme bei der Heterogenität der kanadischen Wählerschaft einem politischen Selbstmord gleich.
Tabelle 3:
Budget für Multikulturalismus unter drei Bundesprogrammen
1984/85 bis 1991/92
Rassen-
% |
Herkunftssprachen
% |
Ethnische Förderung
% |
Gesamtbetrag
|
|
1984-85 |
-- |
50 |
50 |
18,4 |
1985-86 |
-- |
46 |
54 |
16,1 |
1986-87 |
-- |
48 |
52 |
17,8 |
1987-88 |
-- |
40 |
60 |
19,6 |
1988-89 |
14 |
37 |
49 |
22,1 |
1989-90 |
24 |
37 |
38 |
27,1 |
1990-91 |
27 |
22 |
51 |
27,0 |
1991-92 |
-- |
-- |
-- |
25,5 |
Quelle: Economic Council, Faces in the Crowd, 1991, pp. 33. Eigene Erhebung
Organisatorisch und finanziell kommt der kanadische Multikulturalismus recht billig. Zwar hat die Mulroney-Regierung 1991 endlich ein Wahlversprechen von 1984 eingelöst und ein eigenes Department für Multikulturalismus eingerichtet, aber dafür nie mehr als jährlich 25 Millionen kanadische Dollar bereitgestellt, einschließlich der Mittel für Antirassismus-Programme. Dies ist weniger als ein Kampfhubschrauber kostet, von denen gerade 40 neue bestellt wurden. Eine groß angekündigte Stiftung für Rassenbeziehungen fiel vorerst Einsparungserfordernissen zum Opfer. Im Zuge der Defizitbeschränkung wurde ebenfalls Multikulturalismus zusammen mit dem staatlichen Fernsehen, Nationalparks und Einbürgerung unter einer neuen Abteilung "Kulturerbe" zusammengefaßt und auf ein bloßes Programm herabgestuft. Einwanderung wurde von der Regierung Kim Campbell dem Ministerium für
[Seite der Druckausg.: 21]
Öffentliche Sicherheit zugeordnet, was zu Protesten führte. Die Kritiker argumentierten, daß dadurch der falsche Eindruck verstärkt würde, Einwanderer seien ein lästiges Sicherheitsproblem statt eine willkommene Bereicherung des kanadischen Mosaiks. Diese organisatorischen Änderungen wurden von der konservativen Regierung vor allem getroffen, um Wählerverluste an die rechtsgerichtete Reformpartei zu vermeiden. Ihr Programm will staatlich geförderten Multikulturalismus ganz abschaffen und Einwanderung vor allem an ihrem wirtschaftlichen Nutzen orientieren.
Allerdings zeigen repräsentative Umfragen (Angus Reid, 1991), daß die übergroße Mehrheit der Kanadier jetzt multikulturelle Vorstellungen unterstützt. 95 % behaupten, daß der "Stolz, Kanadier zu sein, mit Stolz auf die Herkunft vereinbar ist", 90 % befürworten Chancengleichheit ohne Unterschied von Rassen und Gruppenzugehörigkeit, 79 % glauben, daß Multikulturalismus notwendig sei, um Kanada zu vereinigen. 73 % der Befragten geben an, daß sie Freunde mit anderer Herkunft haben, 64 % arbeiten zusammen mit Angehörigen anderer Gruppen und 66 % glauben, daß Rassendiskriminierung ein Problem in Kanada darstellt. 15 % lehnen Mischehen ab, während 68 % glauben, daß Rassenvorurteile sich nicht ohne Regierungsinterventionen von selbst auflösen. Obwohl 25 % der Befragten Ignoranz über die multikulturelle Politik bekunden, zeigen die Antworten, wie stark offizielle Werbekampagnen Einstellungen beeinflussen und ein Klima von diffuser Toleranz fördern. Dies scheint auch von der schweren Wirtschaftsrezession wenig gefährdet zu sein, solange, wie der Economic Council (1991, S. 29) warnt, sich das gewohnte Zahlenverhältnis zwischen Einheimischen und Einwanderern nicht drastisch verändert. Offensichtlich fördern jedoch hohe Arbeitslosenraten Überfremdungsängste und die Bereitschaft, Sündenböcke auszumachen.
Angesichts der historisch spezifischen Situation eines Einwanderungslandes mit zwei (oder einschließlich der heterogenen Indianer mehreren) Gründungskulturen, ist es zweifelhaft, ob das Konzept des Multikulturalismus unkritisch auf die deutschen Verhältnisse übertragbar ist. Am objektiv dauerhaften multikulturellen Charakter Deutschlands kann nach der de facto Einwanderung sicher kein Zweifel bestehen. Kanada und
[Seite der Druckausg.: 23]
Deutschland unterscheiden sich jedoch in der kulturellen Homogenität der einheimischen Mehrheit und dem daraus resultierenden Assimilationsdruck. Dieser fundamentale Unterschied sollte jedoch eine klar formulierte deutsche Einwanderungspolitik nicht ausschließen. Statt die de facto Einwanderung zu verleugnen und gegen alle Evidenz zu insistieren, daß Deutschland kein Einwanderungsland sei, könnte man wie in Kanada mit einer rationalen Zuwanderungspolitik versuchen, den Migrantenandrang zu regulieren, zu klassifizieren und optimal zu nutzen. Einwanderungskriterien und Kapazitäten müßten, wie in Kanada, einer breiten demokratischen Diskussion entspringen. Eine solche "Ausländerpolitik" mit der Möglichkeit legaler Einwanderung könnte dann Asylflüchtlingen als Alternative angeboten werden und würde wahrscheinlich diesen ohnehin schwer kontrollierbaren Zugangskanal verengen. Sie würde auch den Rechtsradikalen Boden entziehen. Diejenigen auf dem linken Spektrum, die einer völlig offenen Grenze ohne Zugangsbarrieren das Wort reden, wären in die Pflicht genommen, ihre Vorstellungen mehrheitsfähig zu machen.
Das kanadische Beispiel empfiehlt eine Reihe von Gesetzesänderungen und Verwaltungsmaßnahmen, wie erweitertes Einbürgerungsrecht und Doppelstaatsbürgerschaft, selbst wenn man akzeptiert, daß sich Ausländerpolitik in einem relativ übervölkerten Gebiet in Mitteleuropa von einem klassischen Einwanderungsland wie Kanada unterscheiden muß. Vor allem aber könnte bei einer Einbürgerung der Fremden die BRD aus der forcierten Gleichheitsbehandlung unterprivilegierter Gruppen in Kanada einige Lehren ziehen.
5. Forcierte Chancengleichheit
Wegen der systemimmanenten Diskriminierung und Stigmatisierung sollen staatlich forcierte Gleichbehandlungsprogramme dafür sorgen, daß rassische Minderheiten ihren Randgruppenstatus verlieren. Historische Benachteiligung soll durch geplante Bevorzugung solange kompensiert werden, bis der Anteil unterpriviligierter Gruppen in entscheidenden Bereichen ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. In diesem Sinne werden jetzt neben "sichtbaren Minderheiten", Behinderte, Indianer
[Seite der Druckausg.: 24]
("First Nation People") und Frauen besonders gefördert. An den amerikanischen "Affirmative Action"-Programmen orientiert, aber ohne Quoten zu setzen, versuchen bundesweite Gleichbehandlungsrichtlinien ("equity programs") private und öffentliche Unternehmen zu veranlassen, Angehörige der vier Gruppen bei gleicher Qualifikation von Mitbewerbern bevorzugt einzustellen, solange sie unterrepräsentiert sind. Privatunternehmen können nicht gesetzlich gezwungen werden, die Richtlinien zu befolgen, werden aber damit bedroht, von Staatsaufträgen ausgeschlossen zu werden, falls sie nicht kooperieren ("contract compliance"). Die Gleichbehandlungspolitik zielt vor allem darauf ab, traditionelle Einstellungskriterien auf ihre Diskriminierungsfunktion zu überprüfen, um es den Angehörigen benachteiligter Gruppen überhaupt erst zu ermöglichen, in die engere Wahl zu kommen. Zum Beispiel wurden Bestimmungen abgeschafft, die bestimmte Mindestgrößen als Einstellungsvoraussetzung von Polizisten und Feuerwehrleuten festlegten und dadurch fast alle traditionell kleineren asiatischen Bewerber ausschloß. Nachdem die kanadische Polizei jahrelang als "reinrassisch" kritisiert wurde und durch entsprechendes Verhalten mehrfach ethnische Auseinandersetzungen provozierte, wirbt sie jüngst in chinesischen Zeitungen für Polizeianwärter. Solch sinnvolle Gleichbehandlungspolitik bedroht keine Qualitätsvoraussetzungen und das Leistungsprinzip, wie Kritiker beschwören. Im Gegenteil bewirken die Richtlinien, daß der Kreis der potentiellen Bewerber größer ist und dadurch die Chance, den besten Bewerber zu finden, ebenfalls zunimmt.
Allerdings bewirkt die Vergabe von knappen Ressourcen nach dem Abstammungsprinzip, daß sich unter Umständen ethnische und rassische Gruppenidentität perpeputiert, weil damit Vorteile im Leistungswettbewerb verbunden sind. Statt Farbenblindheit und soziale Integration zu fördern, wird die Gesellschaft in ethnisch konkurrierende Segmente fragmentiert. Damit hätte die Politik der forcierten Gleichbehandlung gerade das liberale Prinzip der Chancengleichheit ohne Ansehen von Herkunft oder Rasse untergraben.
Die Kategorie "sichtbare Minorität" für bevorzugte Einstellung beinhaltet mehrere Widersprüche. Im Namen historischer Diskriminierung werden zum Beispiel einem indischen oder chinesischen Einwanderer
[Seite der Druckausg.: 25]
bessere Beschäftigungsmöglichkeiten eingeräumt als einem schon lange ansässigen weißen Einheimischen. "Employment Equity" (Beschäftigungsgleichheit) geht von der zutreffenden Annahme aus, daß Mitglieder bestimmter Rassen und Ethnien diskriminiert wurden und deshalb ein Anrecht auf Ausgleich besitzen.
Wie aber kann man historische Unterdrückung messen? Das Recht auf Kompensation kann sich immer nur auf die individuell Betroffenen beziehen. Von der Entschädigung profitieren aber häufig qua ethnischer Gruppenmitgliedschaft Personen, die darauf gar keinen Anspruch haben, weil sie entweder zur Zeit der Diskriminierung noch gar nicht im Lande waren, oder als anderweitig Priviligierte gar nicht unter der vergangenen Diskriminierung gelitten haben. "Affirmative Action" setzt fälschlicherweise eine gleiche Diskriminierung aller Gruppenangehörigen voraus, was aber kaum der Realität entspricht. Diese Politik ignoriert einerseits die interne Klassenstruktur einer ethnischen Gruppe und begünstigt im allgemeinen die ohnehin schon begünstigte Oberschicht, die sie mit Vorzugsangeboten in das etablierte System kooptiert. Andererseits werden unter der Kategorie "sichtbare Minorität" ethnische Gruppen mit unterschiedlicher Geschichte und unterschiedlichen Erfolgsindikationen subsumiert.
Wie das amerikanische Beispiel noch deutlicher beweist, bestehen beachtliche ökonomische Integrations- und Bildungsunterschiede zwischen der aus der Sklaverei stammenden schwarzen Minderheit, schwarzen Einwanderern aus Jamaika oder einst gleichermaßen diskriminierten asiatischen Minderheiten. Ähnliche Daten lassen sich für die verschiedenen Komponenten der Kategorie "sichtbare Minderheiten" in Kanada feststellen. Ohne auf die komplexen Ursachen dieser Unterschiede hier einzugehen, können einige Beispiele die paradoxe Situation illustrieren.
In vielen Großstädten Kanadas beherrscht die Mehrheit der Schüler die Unterrichtssprache Englisch nur als Zweitsprache. Trotzdem schneiden diese Schüler asiatischer Abstammung im Notendurchschnitt besser ab als weiße und schwarze Einheimische; an den kanadischen Universitäten sind Asien-Kanadier überrepräsentiert und selbst die sichtbaren Min-
[Seite der Druckausg.: 26]
derheiten ("visible minorities") verdienen nicht weniger und befinden sich häufiger in einem Beschäftigungsverhältnis als im Lande Geborene. In der letzten Volkszählung (1986) wurden 6,3 % der Bevölkerung als "sichtbare Minderheit" eingestuft, deren Anteil an den Beschäftigten 1993 7,5 % beträgt. Andere Statistiken weisen aus, daß die außerhalb Kanadas Geborenen mit kanadischer Ausbildung ein höheres Einkommen erzielen als die im Lande Geborenen mit der gleichen Ausbildung. "Affirmative Action"-Programme müßten deshalb differenzieren zwischen den erfolgreichen selbstbewußten "sichtbaren Minderheiten", die keinerlei Staatsförderung benötigen, und denen, vor allem schwarze Kanadier und Indianer, die als stigmatisierte Unterklasse ohne Starthilfe noch weiter an den Rand gedrängt werden.
Tabelle 4:
Erfolg asiatischer Einwanderer in wirtschaftlicher und bildungsmäßiger Hinsicht nach Herkunft - 1986 –
Maßstab |
Kanada |
Westasien |
Südasien |
Südost- |
Ostasien |
Alle Ein- |
Arbeitslos, % |
10,2 |
13,7 |
13,0 |
10,3 |
8,1 |
8,2 |
Universitäts- |
8,9 |
20,3 |
25,2 |
19,7 |
19,2 |
12,2 |
Führungskräfte + höhere Berufsstände, % |
26,4 |
27,4 |
26,7 |
24,1 |
28,9 |
27,4 |
Arbeiter, % |
32,0 |
26,0 |
39,9 |
35,9 |
21,1 |
34,5 |
Mittl. Einkommen aus nicht- |
18,2 |
16,9 |
18,6 |
15,9 |
17,7 |
20,2 |
Mittleres Gesamteinkommen |
15,7 |
13,6 |
16,0 |
12,6 |
14,6 |
16,9 |
Mittl. Einkommen aus Transferleistungen, % |
4,4 |
3,8 |
5,5 |
3,3 |
2,7 |
3,4 |
Als Arbeitgeber tätig, % |
4,0 |
11,0 |
3,3 |
2,3 |
9,1 |
6,0 |
Selbstständig, % |
5,1 |
9,3 |
3,3 |
1,9 |
5,4 |
5,4 |
Hausbesitzer, % |
68,0 |
51,9 |
70,5 |
49,1 |
77,6 |
70,5 |
Hauswert über $ 99.000, % |
28,3 |
56,9 |
51,1 |
45,1 |
63,0 |
49,9 |
Quelle: Thomas Derrick, "The Social Integration of Immigrants", in The Immigration Dilemma (ed.) 1992. Vancouver, B.C.": The Fräser Institute.
[Seite der Druckausg.: 27]
Massive Diskriminierung erleben ebenfalls die im Ausland ausgebildeten Einwanderer, deren Qualifikationen selbst bei hervorragenden Leistungsnachweisen von einheimischen Monopolverbänden nicht anerkannt werden. So verweigern zum Beispiel Ärztevereinigungen strikt jegliche Niederlassungsrechte für außerhalb ausgebildete Kollegen, weil sie sonst den begrenzten Krankenetat mit einem größeren Kreis von Ärzten auf eigene Kosten teilen müßten.
In ähnlicher Weise diskriminieren kanadische Universitäten ausländische Bewerber, indem sie deren akademische Grade aus Ignoranz oder bürokratischer Sturheit nicht anerkennen. Es sind solche Beispiele, die die proklamierte Chancengleichheit aller Bewerber im sogenannten Land der unbegrenzten Möglichkeiten als sehr begrenzt erweisen.
6. Multikulturalismus oder Assimilation?
Wo außer den Indianern alle Einwohner selbst Einwanderer sind oder von Eltern abstammen, die zugewandert sind, wird der deutsche Ruf nach "asylantenfreien" Orten zum Bumerang. Das moderne Kanada ist aus einem Fremdheitserlebnis gewachsen, während in Deutschland der Fremde stets ausgegrenzt blieb. Hier bestimmt Abstammung die Grenzen zwischen Insider und Outsider; das Kanada der zugewanderten Outsider überläßt die Definition des Insiders weitgehend der individuellen Haltung. In Alltagsbegriffen kann man Deutscher nicht werden, wenn man nicht als Deutscher geboren ist. Kanadier kann man werden, auch wenn man als Deutscher oder Chinese geboren ist.
Während in Deutschland Politiker Verständnis für das fremdenfeindliche Verhalten der Bevölkerung bekunden, werden rassistische Äußerungen von Rechtsextremisten in Kanada von allen Parteien öffentlich verurteilt. Rassenhetze wird gerichtlich verfolgt. Geschichtslehrer, die die Judenverfolgung der Nazis leugnen, verlieren ihre Stellung, nicht nur weil offensichtlich die fachliche Kompetenz fehlt, sondern vor allem weil sie eine Bevölkerungsgruppe bewußt beleidigen. Psychische Gewalt wird der Anwendung körperlicher Gewalt gleichgesetzt. Was in Deutschland als "die Kapitulation des Staates vor den Rechtsextremi-
[Seite der Druckausg.: 28]
sten"[6] beklagt wird, stellt sich einigen Bürgerrechtlern in Kanada eher als potentielle Gefahr des Staatseingriffs in das Grundrecht der Meinungsfreiheit dar. Haßpropaganda steht nach Paragraph 318-320 des kanadischen Strafgesetzbuches als kriminelle Tat unter Strafe. Allerdings ist es umstritten, ob der Staat automatisch oder nur im Falle einer privaten Beschwerde Anklage führen muß. Zudem wurde die Verfassungsmäßigkeit der Haßparagraphen nach einer Berufung nur mit knapper Mehrheit des obersten Gerichtes aufrechterhalten.[7]
Grundsätzlich kann festgestellt werden, daß das rechtsextreme Wählerpotential in beiden Ländern wohl gleich ist (± 15 %), sich die öffentliche Meinung in Kanada aber stärker von den Rassisten distanziert. Solche öffentliche Verurteilung von Ku-Klux-Klan-Versammlungen oder rechtsextremen Äußerungen ist nicht auf die politische Linke oder die Liberalen beschränkt, sondern schließt auch die Mehrheit in den konservativen Parteien ein. Alle kanadischen Parteien konkurrieren um die fluktuierende Mitte des politischen Spektrums. Die nächste Bundestagswahl in Deutschland mag "rechts von der Mitte" entschieden werden. Im stets kompromißbereiten kanadischen Selbstverständnis jedoch gelten Extremisten gleich welcher Farbe als abwegig. Mehr als anderswo gleichen sich die Parteien und schrecken vor ideologischen Auseinandersetzungen zurück. Deshalb kann es sich selbst die rechtsgerichtete neue Reformpartei nicht leisten, durch Sprecher des extremen Flügels desavouiert zu werden. Ein solcher Staatskonsens verhindert, daß sich die fremdenfeindlichen Prädispositionen öffentlich äußern oder in aktives Verhalten umschlagen. Autoritäre Charaktere sind immer auch Konformisten. Zwar haben Gesetze wenig Einfluß auf individuelle fremdenfeindliche Haltungen; sie können jedoch verhindern, daß der latente Rassismus sich in diskriminierendem Verhalten äußert.
Die Ausländerpolitik und die Integrationsvorstellungen unterscheiden sich somit in beiden Ländern fundamental. Offizieller Multikulturalis-
[Seite der Druckausg.: 29]
mus in Kanada kontrastiert mit Assimilationsdruck und wachsender Ausländerfeindlichkeit in Europa, je mehr traditioneller Nationalismus ökonomischen Einheitszwängen weicht. Ein unterschiedliches historisches Selbstverständnis von Deutschland als Kulturnation steht dem angelsächsischen Konzept der Staatsnation gegenüber. Die Kulturnation beruht nach der bekannten Unterscheidung von Meinecke[8] auf dem Abstammungsprinzip, das Personen der gleichen kulturellen Herkunft objektiv zu einer Nation prädestiniert. Im Selbstverständnis der Staatsnation wird die Solidarität der Mitglieder dagegen subjektiv begründet. Jeder, der sich zu dem Staatsverband bekennt, hat Anspruch auf gleichberechtigte Staatsbürgerschaft, unabhängig von seiner Herkunft. Das Selbstverständnis der Staatsnation ist deshalb inklusiv, das der Kulturnation exklusiv Kulturelle Minoritäten, die nicht der Staatsmehrheit oder dominierenden Gruppen angehören, sind per Definition von der Kulturnation ausgeschlossen. Der "Verfassungspatriotismus", den Sternberger und Habermas[9] beschwören, läßt sich deshalb nur in der Staatsnation realisieren. Die restriktive Kulturnation eignet sich dagegen für die Mobilisierung von Nationalismus, der immer andere ausschließt, weil sie nicht zur Nation oder zum Volksverband gehören, auch wenn sie die gleiche Staatsbürgerschaft besitzen. Der legalen Gleichstellung aller Bürger oder Bewohner setzt der Nationalismus die fiktive ethnische Identität der objektiven Gruppengemeinsamkeit entgegen.[10]
Es ist offensichtlich, daß ein multi-ethnisches Einwanderungsland wie Kanada, und zunehmend auch Deutschland, nur mit dem Selbstverständnis einer Staatsnation nominelle Gleichheitsrechte aller Einwohner
[Seite der Druckausg.: 30]
verwirklichen kann. Das kontrastiert mit dem Nationalismus von Subgruppen wie den Quebecois oder Indianern. Quebecischer oder indianischer Nationalismus gleicht der Kulturnation europäischer Prägung. Er diskriminiert gegen Outsider. Montreal und Quebec City sind historische Brutstätten von Antisemitismus und paranoidem Widerstand gegen die vermeintliche Gefahr der englischen Überfremdung, wie Montreals berühmtester Romancier Mordecai Richeler überzeugend illustriert hat[11] . Das Verbot von Englisch in öffentlicher Werbung und die Gesetze gegen die freie Schulwahl der Eltern in Quebec haben die 20 % englischsprachiger Quebecer und Immigranten praktisch zu Bürgern zweiter Klasse gestempelt. Die Logik eines solchen Nationalismus ist in der Tat die eigene Staatssouveränität und nicht nur kulturelle Regionalautonomie. Quebecs Separatisten sind die entschiedensten Gegner von Multikulturalismus, der sie mit anderen ethnischen Gruppen gleichsetzt. Militante Indianer verstehen sich nicht als kanadische Staatsangehörige.
Soll dagegen ein Staat mit kulturell heterogener Bevölkerung fortbestehen und die Segmente relativ harmonisch koexistieren, kann die verbindende Ideologie nicht auf dem Vorrecht einer homogenen Staatsidentität insistieren. Das multi-ethnische Staatsgebilde muß sich auch plural und multikulturell definieren. Wie Kanada beweist, kann Multikulturalismus durchaus mit einer übergreifenden Staatsloyalität vereinbart werden, ja, sie sogar mehr harmonisieren als der europäische Assimilationsdruck.
[Seite der Druckausg.: 31]
Ausgewählte Bibliographie zum Thema Multikulturalismus und Einwanderungspolitik in Kanada
Abella, J. and H. Troper: None is Too Many: Canada and the Jews of Europe 1933-1945, Toronto, Lester and Orphen Dennys, 1983.
Abella, Rosali: Equality and Human Rights in Canada: Coping with the New Isms." University Affairs, June/July:21-22,1991.
Adam, Heribert: "Contemporary State Policies to Subordinate Ethnics" in: Multiculturalism and Intergroup Relations, James Frideres (ed.), 19-34, Westport, Conn., Greenwood Press, 1989.
Anderson, Alan and James Frideres: Ethnicity in Canada: Theoretical Perspectives, Toronto, Butterworths, 1981.
Bagley, Christopher and Gajendra K. Verma: Multicultural Education: Education, Ethnicity, and Cognitive Styles, London, Gower, 1983.
Banks, James A. and Cherry A. McGee Banks (eds.): Multicultural Education: Issues and Perspectives, Toronto, Allyn and Bacon, 1989.
Berry, J.W.: "Multicultural Policy in Canada: A Social Psychological Analysis", Canadian Journal of Behavioral Science 16(4):353-370,1984.
ders.: Sociopsychological Costs and Benefits of Multiculturalism, Ottawa, Economic Council of Canada, Working Paper No. 24,1992.
Berry, John, Rudolph Kalin, and Donald M. Taylor: Multiculturalism and Ethnic Attitudes in Canada, Ottawa, Ministry of Supply and Services, 1977.
Bibby, R. W.: Mosaic Madness: the Potential and Poverty of Canadian Life, Toronto, Stoddart, 1990.
Breton, Raymond, W. I. Isajiw, Warren Kalbach, and Jeffrey Reitz: Ethnic Identity and Equality: Varieties of Experience in a Canadian City, Toronto, University of Toronto Press, 1990.
Bullivant, Brian: „Multiculturalism: Pluralist Orthodoxy or Ethnic Hegemony", Canadian Ethnic Studies 13(2): 1-22, 1981.
Burnet, Jean: "Myths and Multiculturalism", in: Multiculturalism in Canada: Social and Educational Perspectives. Ronald L. Samuda, John W. Berry, and Michael Laferriere (eds.), 18-29. Toronto: Allyn and Bacon, 1984.
ders.: "Multiculturalism", in: The Canadian Encyclopedia, J.H. March (ed.), 1401, Edmonton: Hurtig, 1988.
[Seite der Druckausg.: 32]
Burnet Jean and Howard Palmer: "State of the art: Canadian Ethnic Studies", Canadian Ethnic Studies 22(1):1-7, 1990.
Canadian Human Rights Foundation: Multiculturalism and the Charter, Toronto, Carswell, 1987.
Cummins, Jini and Marcel Danesi: Heritage Languages: The Development and Denial of Canada's Linguistic Resources, Toronto, Garamond Press/Our Schools-Our Selves Education Foundation, 1990.
Currents: "Minority Broadcasting: Report of the Task Force on Broadcasting Policy" 4(2):15-16,1987.
Dahlie, J. and T. Fernando: "Reflections on Ethnicity and the Exercise of Power: An Introductory Note", in: Ethnicity, Power and Politics in Canada. J. Dahlie and T. Fernando (eds.), 1-5, Toronto, Methuen, 1981.
Derrick, Thomas (ed.): The Immigration Dilemma, Vancouver, B.C. The Fraser Institute, 1992.
Desivla, Arnold: Earnings of Immigrants. A Comparative Analysis. Ottawa: Minister of Supply and Services, 1992.
Driedger, Leo (ed.): The Ethnic Factor: Identity in Diversity, Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 1989.
DuCharme, Michele: "The Coverage of Canadian Immigration Policy in: The Globe and Mail (1980-1985)", Currents Spring:6-ll, 1986.
Dwivedi, O.P., Ronald D'Costa, C. Lloyd Stanford, and Elliot Tepper: Canada 2000: Race Relations and Public Policy: Guelph, Ont.: University of Guelph, Department of Political Studies, 1989.
Economic Council of Canada: New Faces in the Crowd. Economic and Social Impacts of Immigration, Ottawa, 1991.
Elliott, Jean Leonard (ed.): Two Nations: Many Cultures: Ethnic Groups in Canada, Scarborough, Ont., Prentice-Hall, Canada, 1983.
Elliott, Jean Leonard and Augie Fleras: Unequal Relations: An Introduction to Race and Ethnic Dynamics in Canada, Scarborough, Ont., Prentice-Hall, Canada, 1991.
Employment and Immigration Canada: Annual Report to Parliament on Future Immigration Levels. Ottawa.
Fairweather, R.G.L.: "The Constitution and Multiculturalism: A Closer Look at Section 27", Multiculturalism/Multiculturalism xi(1): 15-19,1987.
[Seite der Druckausg.: 33]
Fleras, Augie and Frederick J. Desroches: "Multiculturalism: Policy and Ideology in the Canadian Context", in: Police, Race, and Ethnicity: A Guide for Law Enforcement Officers, Brian K. Cryderman and Chris N. O'Toole (eds.), 17-24. Toronto, Butterworths, 1986.
ders.: "Bridging the Gap: Towards a Multicultural Policing in Canada", Canadian Police College Journal 13(3):153-164,1989.
Fleras, Augie and Jean Leonard Elliott: Multiculturalism in Canada, Scarborough, Nelson, Canada 1992.
Fry, A.J. and C. Forcevielle (eds.): Canadian Mosaic: Essays on Multiculturalism, Amsterdam, Free University, 1988.
Hawkins, F.: "Canadian Multiculturalism: The Policy Explained", in: Canadian Mosaic: Essays on Multiculturalism. A.J. Fry and Ch. Forceville (eds.), 9-24, Amsterdam, Free University Press, 1988.
Henry, Frances and Carol Tator: "Racism in Canada: Social Myths and Strategies for Change", in: Ethnicity and Ethnic Relations in Canada, 2nd ed., Rita M. Bienvenue and Jay E. Goldstein (eds.), 321-335. Toronto, Butterworths, 1985.
Herberg, Edward N.: Ethnic Groups in Canada: Adaptions and Transitions, Scarborough, Ont., Nelson, Canada, 1989.
Isajiw, Wsevolod W.: "Ethnic Identity Retention", in: Ethnic Identity and Equality, Raymond Breton et al. (eds), 34-91, Toronto, University of Toronto Press, 1990.
Jain, Harish C.: "Affirmative Action/Employment Equity Programs and Visible Minorities in Canada", Currents 5(1)4:3-7,1988.
Jain, Harish C. and Rick D. Hackett: "Measuring Effectiveness of Employment Equity Programs in Canada: Public Policy and a Survey", Canadian Public Policy 15(2):189-204,1989.
Kalbach, Warren: "A Demographic Overview of Racial and Ethnic Groups in Canada", in: Race and Ethnic Relations in Canada, Peter S. Li (ed.), 18-47, Toronto, Oxford University Press, 1990.
Kallen, Evelyn: "Multiculturalism: Ideology, Policy and Reality", Journal of Canadian Studies 17:51-63,1982.
Canadian Human Rights Foundation (ed.): "Multiculturalism, Minorities, and Motherhood: A Social Scientific Critique of Section 27", in: Multiculturalism and the Charter: A Legal Perspective, 123-138, Toronto, Carswell, 1987.
Lambert, Ronald D. and James Curtis: "The Racial Attitudes of Canadians", in: Rea-dings in Sociology. Lome Tepperman and James Curtis (eds.), 343-348, Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 1989.
[Seite der Druckausg.: 34]
Li, Peter S. and B. Singh Bolaria (eds.): Racial Minorities in Multicultural Canada, Toronto, Garmond Press, 1983.
McRoberts, Kenneth: Quebec: Social Change and Political Crisis, 3rd ed., Toronto, McClelland and Stewart, 1989.
Moodley, Kogila: "Canadian Multiculturalism as Ideology". Ethnic and Racial Studies 6(3):320-332,1983.
Moodley, Kogila: Beyond Multicultural Education: International Perspectives, Calgary, Detselig, 1992.
Multiculturalism and Citizenship, Canada: The Canadian Multiculturalism Act: A Guide for Canadians. Ottawa: Government Printer, 1990.
Optima Consultants "Analysis of Thompson Lightstone Survey of Public Attitudes Toward Multiculturalism" Prepared for Multiculturalism Canada, Department of the Secretary of State, Ottawa, 1988.
Palmer, H. "Mosaic Versus Melting Pot? Immigration and Ethnicity in Canada and United States", International Journal Summer:488-522,1976.
Peter, Karl: "The Myth of Multiculturalism and Other Political Fables", in: Ethnicity, Power and Politics in Canada, J. Dahlie and T. Fernando (eds.), 56-67, Toronto, Methuen, 1981.
Porter, John: The Vertical Mosaic, Toronto, University of Toronto Press, 1965.
Porter, John: The Measure of Canadian Society: Education, Equality, and Opportunity, Toronto, Gage Publishing, 1979.
Reid, Angus: Multiculturalism and Canadians: Attitude Study 1991, Ottawa, Multiculturalism and Citizenship Canada, 1991.
Reports:
Equality Now! Report of the Special Committee on Visible Minorities in Canadian Society, Bob Daudlin, M.P., Chairman, Ottawa, the Queen's Printer for Canada, under authority of the Speaker of the House of Commons, 1984.
Multiculturalism: Building the Canadian Mosaic. Report of the Standing Committee on Multiculturalism, Ottawa, Supply and Services Canada, 1987.
Multiculturalism in Canada: A Graphic Overview, Ottawa, Multiculturalism and Citizenship Canada, 1989.
Richmond, Anthony H.: "Race Relations and Immigration: A Comparative Perspective", International Journal of Comparative Sociology 31(3-4):156-176,1990.
[Seite der Druckausg.: 34]
Richmond, Anthony H.: "Immigration and Multiculturalism in Canada and Australia: The Contradictions and Crises of the 1980s", International Journal of Canadian Studies 3 (Spring):87-109,1991.
Roberts, Lance W. and Rodney A. Clifton: "Multiculturalism in Canada: A Sociological Perspective", in: Race and Ethnic Relations in Canada. Peter S. Li (ed.), 120-147, Don Mills, Ont.: Oxford University Press, 1990.
Rothman, E., M. Schiff, M. Adamyk, and Z. Sumegi: Multiculturalism in Canada: A Public Education Strategy. Policy and Research Directorate, Ottawa, Multiculturalism and Citizenship Canada, 1987.
Samuda, Ronald J., John W. Berry and Michel Laferriere (eds.): Multiculturalism in Canada: Social and Educational Perspectives, Toronto, Allyn and Bacon, 1984.
Tepper, Elliott L.: Changing Canada: the Institutional Response to Polyethnicity: The Review of Demography and Its Implications for Economic and Social Policy, Ottawa, Carleton University, 1988.
Verma, Gajendra K.: "Multiculturalism and Education: Prelude to Practice." In Race Relations and Cultural Differences. Gajendra K. Verma and Christopher Bagley (eds.). London: Croom Helm, 1984.
Walker, James W.St.G.: "'Race' Policy in Canada: A Retrospective", in: Canada 2000: Race Relations and Public Policy. O.P. Dwivedi et al. (eds.), 1-19. Guelph, Ont., University of Guelph, Department of Political Sciences, 1989.
White, Pamela M. and T. John Samuel: "Immigration and Ethnic Diversity in Urban Canada." International Journal of Canadian Studies 3(Spring):69-85,1991.
White, Philip and Augie Fleras: "Multiculturalism in Canada: Charter Group Attitudes and Responses toward Cultural and Racial Outgroups", Plural Societies 19(2/3):28-42, 1990.
Wolfe, David: "The Canadian State in Comparative Perspective." The Canadian Review of Sociology and Anthropology 26(1):95-126,1989.
Zolf, Dorothy: "Comparisons of Multicultural Broadcasting in Canada and Four Other Countries", Canadian Ethnic Studies 21:13-26,1989.
[Seite der Druckausg.: 36 = Leerseite
[Fußnotenverweise]
Hinweis: Die Fußnoten stehen in der Druck-Ausg.
jeweils auf der entsprechenden Textseite (unten)]
Fn.1: Dank gebührt Grant Wildi für Hilfe bei der Datensammlung, Kogila Moodley und T. John Samuel für vielfältige Anregungen.
Fn.2: Kanadische Beamte erklären dies damit, daß die meisten Asylsuchenden direkt aus Ländern anreisen, in denen politische Verfolgung offensichtlich ist (Somalia, Jugoslawien, Sri Lanka, El Salvador).
Fn.3: Für eine gute Übersicht der kanadischen Diskussion auf dem neuesten Stand, siehe Augie Fleras, Jean Leonard Elliott 1992. Die internationale Diskussion vor allem über Multikulturalismus im Erziehungsbereich enthält Kogila A. Moodley 1992.
Fn.4: Für die neueste empirische Übersicht über die kanadische kulturelle Hierarchie und Einstellungen gegenüber ethnischen Minoritäten siehe J.W. Berry 1992. Siehe auch die Schriften von Jean Bumet, L. Driedger, Anthony Richmond, R. Breton und vor allem dem besten kanadischen Soziologen, John Porter, zum Thema Ethnizität im kanadischen Mosaik.
Fn.5: Trudeaus pluraler Multikulturalismus für Quebec unterscheidet sich von den Nationalisten darin, daß er es Franko-Kanadiern ermöglichen soll, überall französisch zu sprechen, während die Nationalisten allen Bewohnern von Quebec die französische Identität aufzwingen und sich für Franko-Kanadier außerhalb Quebecs wenig interessieren.
Fn.6: Robert Leicht, "Anschlag auf die Republik", Die Zeit, 4. September 1992.
Fn.7: Nachdem eine Frauenkommission subtile Geschlechts- und Rassendiskriminierung in Kanadas Juristenkreisen feststellte, wird jetzt darüber gestritten, ob alle Richter gezwungen werden sollen, Sensibilitätskurse über die Rolle der Geschlechter und ethnische Beziehungen zu belegen, oder ob diese soziologische Weiterbildung den Richtern selbst überlassen werden kann, The Globe & Mail, 26. August 1993, A4.
Fn.8: Meinecke, Friedrich, München/Berlin 1901.
Fn.9: Habermas, Jürgen, Frankfurt/Main 1990.
Fn.10: Siehe Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, 2. Auflage, London 1991. Die umfangreiche und theoretische diverse englisch-sprachige Literatur über Ethnizität und Nationalismus hat seit den Klassikern Karl Deutsch und Hans Kohn keine Parallele in Deutschland, wo sich die Diskussion hauptsächlich auf Rechtsextremismus und Antisemitismus angesichts der faschistischen Vergangenheit konzentriert.
Für herausragende Analysen aus marxistischer Perspektive siehe E.J. Hobsbawn, Nations and Nationalism Since 1780, Cambridge 1990; aus sozio-biologischer Sicht, Pierre L. van den Berghe, The Ethnic Phaenomenon, New York 1981; James G. Kellas, The Politics of Nationalism and Ethnicity, London 1991. Die Schriften von Emest Gellner, Charles Tilly, J. Breuilly, J. Armstrong und Michael Banton gehören ebenfalls zum unumgänglichen Repertoire des Themas.
Fn.11: Mordecai Richeler, "A Reporter at Large", The New Yorker, 23. September 1991, S. 40-92.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juni 2003


