

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
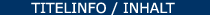
TEILDOKUMENT:
Reform der Arbeitsmarktpolitik und Perspektiven für lokales Handeln
[Seite der Druckausg.: 103 ]
Ursula Engelen-Kefer
Reform der Arbeitsmarktpolitik und Perspektiven für lokales Handeln – Statement
Thesen zur Einführung
Zunächst will ich deutlich machen, daß die Arbeitsmarktpolitik nicht die Aufgaben der globalen Beschäftigungspolitik übernehmen kann. Arbeitsmarktpolitik kann Beschäftigungsförderung auf dem regulären Arbeitsmarkt unterstützen, kann sie aber nicht ersetzen. Arbeitsmarktpolitik hat auch die Funktion des sozialen Ausgleichs, insbesondere gilt dies für ältere Arbeitslose, Langzeitarbeitslose, für Schwerbehinderte und Frauen.
1. Arbeitsmarktpolitik muß die sozialverträgliche Gestaltung des betrieblichen Wandels unterstützen
Im SGB III besteht die Möglichkeit, mit Strukturkurzarbeitergeld und mit der Förderung von Sozialplanmaßnahmen betrieblichen Wandel zu begleiten und die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Arbeitslosigkeit zu schützen. Nach ersten Erfahrungen mit diesen Instrumenten kommt es jetzt darauf an, die Anreize für diese Aktivitäten zu erhöhen und durch Verbesserung der Flexibilität und Präzisierung der Maßnahmen den Erfolg zu verbessern. Dies verstehen wir als präventive Arbeitsmarktpolitik. Gerade die lokalen Akteure der Arbeitsmarktpolitik sind aufgerufen, weitere Modelle und Formen zu entwickeln.
2. Maßnahmen für Zielgruppen präzisieren
Der DGB betrachtet mit großer Sorge die starke Zunahme der Langzeitarbeitslosigkeit. Nach der Reform des SGB III sehen wir die Gefahr, daß Langzeitarbeitslose, gering Qualifizierte und Schwerbehinderte weniger von aktiver Arbeitsmarktpolitik profitieren. Die Arbeitsämter stehen unter dem Druck der Eingliederungsbilanz, sind durch gesetzlichen Auftrag verpflichtet, vorrangig in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln und Eingliederungsmaßnahmen möglichst kostengünstig durchzuführen. Deswegen besteht die Gefahr, daß bestimmte Zielgruppen weniger berücksichtigt werden.
[Seite der Druckausg.: 104 ]
Bei einer Reform des SGB III muß klargestellt werden, daß alle Arbeitslosen gleichermaßen von aktiver Arbeitsmarktpolitik profitieren und grundsätzlich jeder einen Anspruch auf Arbeit hat.
Besonderen Bedarf sehen wir bei der Förderung älterer Arbeitsloser. Durch die Ausrichtung der Strukturanpassungsmaßnahmen auf ältere und jüngere Arbeitslose ist ein erster Schritt getan worden. Wenn ein zu früher Rentenbezug vermieden werden soll, muß die Arbeitsmarktpolitik Anreize schaffen, Ältere weiter zu beschäftigen bzw. Maßnahmen zur Wiedereingliederung Älterer unterstützen.
Darüber hinaus sollten Elemente des Jugendprogramms in die Regelförderung des SGB III übernommen werden. Ich denke hier insbesondere an Maßnahmen an der zweiten Schwelle. Für Jugendliche sollten in jedem Fall nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit aktive Maßnahmen einsetzen.
3. Arbeitsmarktpolitik muß Arbeitszeitpolitik unterstützen
Daß die Verkürzung von Arbeitszeit Arbeitsplätze erhalten bzw. neue Arbeitsplätze schaffen kann, ist unstrittig. Besonders der Abbau von Überstunden, die Nutzung freiwilliger Arbeitszeitverkürzung sowie die Nutzung von Weiterbildungszeiten der Beschäftigten können für die Integration Arbeitsloser eine Hilfe sein.
Die Reform des SGB III sollte deswegen Arbeitszeitverkürzung unterstützen, wenn gleichzeitig Arbeitslose eingestellt werden. Die Modelle zum Abbau von Überstunden, die im Rahmen der freien Förderung erprobt wurden, haben uns ermutigt, diesen Weg weiter zu gehen.
4. Maßnahmen für gering Qualifizierte
Der DGB sieht die Notwendigkeit, zusätzliche Maßnahmen zur Integration gering Qualifizierter einzuleiten. Nach wie vor lehnen wir allerdings die gezielte Förderung von Niedriglohnarbeit ab. Eine pauschale Förderung von Niedriglöhnen würde gering qualifizierten Langzeitarbeitslosen nicht helfen, sondern eher Personen aus der stillen Reserve aktivieren. Für gering qualifizierte Arbeitslose müssen gezielte Instrumente entwickelt werden, dies können auch Lohnkostenzuschüsse sein.
[Seite der Druckausg.: 105 ]
5. Dezentralisierung von Entscheidungen
Die lokalen Akteure haben mit der freien Förderung ein Instrument in die Hand bekommen, individuell auf die Region zugeschnittene Maßnahmen zu entwickeln.
Ich plädiere dafür, diesen Freiraum auszubauen und gegebenenfalls finanziell zu stärken. Die Dezentralisierung der Arbeitsmarktpolitik ist ein wirksames Instrument, die Kräfte vor Ort zusammenzuführen und die Kreativität bei der Entwicklung neuer Maßnahmen zu fördern. Durch die Dezentralisierung der Entscheidungen über die Mittelverwendung konnte die Effizienz der Arbeitsmarktpolitik zusätzlich gesteigert werden.
6. Vermittlung verbessern, Arbeitsämter modernisieren
Weiteren Reformbedarf sehen wir auch in den Arbeitsämtern selbst. Gerade für die Vermittlung von Zielgruppen müssen weitere Kapazitäten bereitgestellt werden. Durch die Reform zum Arbeitsamt 2000 und durch die Ausstattung mit verbesserter Informationstechnologie werden erste Schritte eingeleitet. In einigen Arbeitsämtern werden inzwischen spezielle Vermittlungsteams eingesetzt. Dieses Modell sollte bundesweit ausgeweitet werden.
7. Arbeitsmarktpolitik darf nicht in tarifliche Standards eingreifen
Die Arbeitsmarktpolitik und die Vermittlung der Arbeitsämter muß die Tarifgestaltung beachten und darf nicht dazu beitragen, Standards zu unterlaufen bzw. Arbeitslose zwingen, zu untertariflichen Bedingungen zu arbeiten. Bei Arbeitskampfmaßnahmen muß die Neutralität der Bundesanstalt wiederhergestellt werden.
8. Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik
Der Reformbedarf besteht bei der Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik. Seit Jahren fordert der DGB eine Verstetigung der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Dies ist von der neuen Bundesregierung positiv aufgenommen worden. Die Verstetigung ist eine wichtige Voraussetzung für die Steigerung der Effizienz der Arbeitsmarktpolitik.
Auch die Frage, welche Teile der Arbeitsmarktpolitik steuerfinanziert werden sollen, ist bisher ungelöst. Der DGB fordert einen regelgebundenen Zuschuß
[Seite der Druckausg.: 106 ]
aus Steuermitteln. Der Zuschuß soll deswegen regelgebunden sein, um willkürliche Eingriffe des Finanzministers zu verhindern und den Haushalt der BA so steuern zu können, daß bei steigender Arbeitslosigkeit mehr Mittel zur Verfügung stehen, bei sinkender Arbeitslosigkeit der Zuschuß reduziert werden kann.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 2000