

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
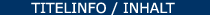
TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 7 ]
Ruth Brandherm
Zusammenfassung
Die europäische Beschäftigungspolitik hat mit der Verabschiedung eines Europäischen Beschäftigungspaktes weiter an Kontur und an Bedeutung gewonnen. Sie hat nun auch die lokale Ebene als Handlungsfeld entdeckt. Auf die Entstehung und die Facetten der regionale Beschäftigungspolitik in Berlin geht Gabriele Schöttler ein. Sie hebt hervor, daß Berlin als Stadtstaat seit dem Fall der Mauer eine regionalisierte, auf die lokalen Bedarfe bezogene Arbeitsmarktpolitik betrieben hat. In allen Berliner Bezirken sind Netzwerke, Ausbildungsverbünde und Beschäftigungspakte verankert oder werden gegründet. Sie haben das Ziel, die lokalen Entwicklungspotentiale zu entwickeln und zu verbessern. Einen Motivations- und Innovationsschub für diese Entwicklung löste der EU-geförderte Beschäftigungspakt Neukölln aus. Die Landesverwaltung bietet den bezirklichen Pakten Unterstützung für Beratung und Projektmanagement sowie technische Hilfe an, damit die Bezirke ihre eigenen Entwicklungspotentiale besser fördern und nutzen können. Die Förderung durch den Europäischen Sozialfonds ist für diese beschäftigungspolitische Strategie von zentraler Bedeutung. Das Angebot der Europäischen Kommission, Berlin gemeinsam mit dem Land Brandenburg zu einer „Modellregion der Europäischen Beschäftigungsstrategie" zu entwickeln, könnte mit einem Modellvorhaben zur Verfahrensvereinfachung verknüpft werden.
Die neueren Entwicklungen in der europäischen Beschäftigungspolitik und die Aktivitäten der Kommission stellt Georg Fischer vor. Neben der Verabschiedung des Europäischen Beschäftigungspaktes auf dem Kölner Gipfel ist der Entwurf der Leitlinien 2000 hervorzuheben. Die Leitlinien sind Teil des Beschäftigungspakets 2000. Er beinhaltet darüber hinaus einen Beschäftigungsbericht, der die Entwicklung in den Mitgliedstaaten darstellt. Empfehlungen des Rates sollen die Mitgliedstaaten zu weiteren und intensiveren Aktivitäten anregen. Besondere Anstrengungen sind nötig, um die Beschäftigungsquote in der EU zu erhöhen. Der Dienstleistungssektor spielt dabei eine besondere Rolle. Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der Langzeitarbeitslosigkeit belegt die Wirksamkeit politischer Interventionen: Bei
[Seite der Druckausg.: 8 ]
ähnlichen Ausgangsbedingungen sind deutliche Unterschiede zwischen den Ländern festzustellen. In den Leitlinien 2000 legt die Kommission einen Schwerpunkt auf die lokale Beschäftigungspolitik. Dies signalisiert, daß sie die Bedeutung der lokalen Ebene und der Akteure vor Ort für die Entwicklung und Umsetzung beschäftigungsfördernder Maßnahmen erkannt hat.
Gerd Andres hebt hervor, daß die europäische Beschäftigungspolitik während der deutschen Ratspräsidentschaft wichtige neue Impulse erhalten hat. Die Verabschiedung des Europäischen Beschäftigungspaktes, eines „Bündnisses für Arbeit auf der europäischen Ebene", stellt – gemäß der Paktphilosophie – das koordinierte, gemeinsame Handeln der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure in den Mittelpunkt und bezieht damit auch die Sozialpartner in den Prozeß ein. Der Pakt umfaßt neben gemeinsamen Leitlinien für die Beschäftigungspolitik, Strukturreformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und des Funktionierens der Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalmärkte auch die Verbesserung des Zusammenwirkens der Finanzpolitik, Geldpolitik und der Lohnentwicklung. Damit soll ein verstärktes Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum bei Preisstabilität erreicht werden. Der Pakt baut auf den Ergebnissen der unterschiedlichen nationalen, regionalen und branchenspezifischen Entwicklungen auf und liefert für das notwendige Handeln vor Ort z.B. bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit wichtige Orientierungen.
Die Rolle der Städte wird nach Ansicht von Hartmut Siemon in der europäischen Diskussion bisher zu wenig beachtet, obwohl sich hier allmählich ein Umdenkungsprozeß abzeichnet. In seinem Beitrag stellt er wichtige Initiativen im Bereich der europäischen Stadtpolitik vor. Neben dem Aktionsplan für nachhaltige Stadtentwicklung und der Leitlinie 12 der europäischen Beschäftigungspolitik geht er auf die finanziellen Förderinstrumente ein und zeigt Handlungsbedarfe in diesen Bereichen auf. Dabei werden besonders die umfassende und frühzeitige Mitwirkung der Städte und die konsequentere Ausrichtung der Politikinstrumente auf die lokale Ebene betont. Am Beispiel der Stadt Leipzig skizziert Hartmut Siemon den integrierten Ansatz der Stadtentwicklung basierend auf dem Leitbild „Leipzig – Stadt der Unternehmenden".
Ein neuer Politikansatz in der europäischen Beschäftigungspolitik, der die Bedeutung der lokalen Ebene in den Vordergrund rückt, wird in den folgenden Beiträgen u.a. anhand von Beispielen vorgestellt.
[Seite der Druckausg.: 9 ]
Silvia Besse und Michael Guth geben einen Überblick über die Entstehung und die Konzeption der territorialen europäischen Beschäftigungspakte. Ein breites Bündnis der Akteure vor Ort entwickelt eine Gesamtstrategie („Aktionsplan"), die darauf zielt, die Beschäftigung in der Region zu fördern. Wesentlich ist, daß die Initiativen für Maßnahmen und Projekte innovativ und politikfeldübergreifend ausgelegt sind. Die Pakte folgen einer von der EU-Kommission festgelegten Methodik. Sie erhalten aus EU-Strukturfondsmitteln eine Anschubfinanzierung. Insgesamt werden in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 89 unterschiedlich ausgerichtete Pakte gefördert. Seit 1997 sind in Deutschland neun Pakte aktiv. Der Ansatz der Beschäftigungspakte wird von den nationalen Regierungen unterschiedlich aufgenommen und unterstützt. Bisher finden sie in Deutschland im Rahmen des Bündnisses für Arbeit noch wenig Beachtung. Erste Analysen der Wirkungen dieses Instrumentes belegen positive Arbeitsmarkteffekte und zeigen, daß viele Potentiale auf der regionalen Ebene erschlossen werden konnten. Für 2000–2006 wurde dieser Ansatz in die Strukturfondsverordnungen aufgenommen.
Das regionale Beschäftigungsbündnis Bremen und Bremerhaven wird von Peter Prill, Saul Revel und Wolfgang Schäl-Helmers vorgestellt. Es ist bei dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales angesiedelt und eng mit dem Bündnis für Arbeit und Ausbildung, das auf der politischen Ebene durch den Senat initiiert wurde, verzahnt. 1997 wurde ein Bündnis-Sekretariat eingerichtet, das die Aufgabe hat, Projekte zu entwickeln und den Kooperationsprozeß der Beteiligten auf der Basis eines konkreten Aktionsplanes zu koordinieren. Ein Beirat entscheidet über inhaltliche Weichenstellungen und begleitet die Arbeit der Projekte. In den Aktionsfeldern neue Arbeitszeitmodelle, neue Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich, neue Ansätze der Zielgruppenförderung und Arbeitsmarkttransparenz werden derzeit 13 Projekte durchgeführt. Die positiven Erfahrungen dieses Bündnisansatzes haben in einigen Bereichen bereits zu Multiplikatoreffekten geführt und sollen verstärkt für die zukünftige Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik im Land Bremen genutzt werden.
Der Beschäftigungspakt Vorarlberg / Österreich zielt besonders auf die Bekämpfung der seit 1990 steigenden Langzeitarbeitslosigkeit. Wolfgang Michalek erläutert, daß neben der Auswertung der bisherigen Aktivitäten zur Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und der Förderung
[Seite der Druckausg.: 10 ]
von Beschäftigung im zweiten Arbeitsmarkt die Erschließung zusätzlicher Arbeitsplätze bei gemeinnützigen Trägern und Institutionen durch finanzielle Anreize einen hohen Stellenwert hat. Eine bessere Vernetzung der Beschäftigungsinitiativen in der Region soll den Austausch und die Zusammenarbeit fördern und ein umfassendes Wiedereingliederungskonzept die Chancen für die Integration erhöhen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen u.a., daß bei den Vorarlberger Beschäftigungsprojekten ein großes Interesse an Kooperation insbesondere hinsichtlich der Entwicklung und Umsetzung zukünftiger Maßnahmen besteht und Fragen des Qualitätsmanagements an Bedeutung gewinnen. Außerdem konnte ein Konzept zur Unterstützung der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt erfolgreich durchgeführt werden. Der Pakt hat zum Ausbau und zur Intensivierung der Partnerschaft in der Region beigetragen.
In der kontroversen Debatte zur Reform der Arbeitsmarktpolitik und den Perspektiven für lokale Beschäftigungspolitik wurden folgende Akzente gesetzt:
Josef Siegers stellt die Position der Arbeitgeberseite vor. Vorrangiges Ziel kann nicht allein die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, sondern muß die Schaffung neuer Arbeitsplätze sein; Hauptaufgabe der Politik ist es, Unternehmen und Investoren dazu zu ermutigen. Arbeitsmarktpolitik muß dem Ziel der Beschäftigungsförderung dienen. Dementsprechend sind die eingesetzten Instrumente einer kritischen Prüfung zu unterziehen und müssen gegebenenfalls, wie z.B. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, eingeschränkt werden. Im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit werden aus der Sicht von Siegers gegenwärtig die Debatten eher auf Nebenschauplätzen und wenig fruchtbar geführt. Bei Themen, die die Arbeitgeberseite als zentral betrachtet, wie die Neuverteilung der Arbeitszeit, die Lohnpolitik und die Neuordnung der öffentlichen Abgaben und Ausgaben, bestehen deutliche Differenzen zwischen den Bündnispartnern.
Ursula Engelen-Kefer unterstreicht, daß Arbeitsmarktpolitik die Aufgaben der globalen Beschäftigungspolitik nicht ersetzen kann. Für die Zukunft formuliert sie u.a. folgende Anforderungen und Schwerpunkte: Arbeitsmarktpolitik muß die sozialverträgliche Gestaltung des betrieblichen Wandels unterstützen und die Arbeitszeitpolitik flankieren. Für Zielgruppen wie z.B. für Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte müssen gezieltere Instrumente entwickelt werden. Die pauschale Förderung von Niedriglöhnen oder das
[Seite der Druckausg.: 11 ]
Unterlaufen tariflicher Standards lehnt Engelen-Kefer ab. Die lokale Ebene sollte durch die Dezentralisierung von Entscheidungen größere Handlungs- und Entscheidungsspielräume erhalten. Die Reform der Arbeitsmarktpolitik müßte aus Sicht der DBG-Vertreterin auch eine Neuregelung der Finanzierung einschließen.
Adi Ostertag kündigt an, daß die im Koalitionsvertrag vereinbarte umfassende Reform der Arbeitsförderung nach der bereits erfolgten Verabschiedung wichtiger Änderungen im SGB III Vorschaltgesetz noch in dieser Legislaturperiode vorgesehen ist. Das Ziel, Arbeitslose so schnell wie möglich wieder in das Beschäftigungssystem zu integrieren, steht dabei im Mittelpunkt: Arbeit und Qualifizierung sollen gefördert werden statt Arbeitslosigkeit. Trotz des Sparzwangs sind die Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik nicht reduziert und das Sofortprogramm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit auf den Weg gebracht worden. Die Bundesebene legt zwar die gesetzlichen Grundlagen, die Umsetzung erfolgt jedoch auf lokaler und regionaler Ebene. Deshalb unterstützt die SPD-Fraktion die Einrichtung regionaler Bündnisse und Initiativen. Sie sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wirksamkeit und der Zielgenauigkeit der Arbeitsmarktpolitik.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 2000