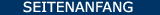![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
-
Gerd Wenzel
- 1. Das Bundessozialhilfegesetz sichern
- 2. Den Nachrang in der Sozialhilfe stärken
- 3. Sozialhilfe und Arbeit
- 4. Das Bedarfsdeckungsprinzip erhalten und das Existenzminimum sichern
- 5. Verschärfung der gegenseitigen Einsatzpflicht bei Menschen, die zusammen wohnen
- 6. Vertragliche Vereinbarungen zwischen Sozialhilfeträgern und Erbringern sozialer Dienstleistungen
- 7. Was fehlt
Sozialhilfereform aus der Sicht der Bundesländer
[Seite der Druckausg.: 85]
Gerd Wenzel
Sozialhilfereform aus der Sicht der Bundesländer
1. Das Bundessozialhilfegesetz sichern
Das Bundessozialhilfegesetz ist besser als sein Ruf. Die meisten Sozialhilfeempfänger beziehen nur kurzfristig Hilfen und werden aus eigener Kraft unabhängig von Sozialhilfe. Neue Untersuchungen haben ergeben, daß Sozialhilfe vielen Menschen in vorübergehenden Krisensituationen hilft. Das Hauptziel des Gesetzes, Hilfe zur Selbsthilfe, wird häufig erreicht. Die Ursachen von Armut und Ausgrenzung und die Finanzierungsprobleme liegen nicht an einer ungenügenden Sozialhilfe, sondern vor allem in unzureichenden vorrangigen Sicherungssystemen und in der dramatischen Situation auf dem Arbeitsmarkt.
Warum wird dennoch so intensiv über eine Reform der Sozialhilfe diskutiert?
- In den verschiedenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, vor allem zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums des Steuerpflichtigen und seiner Kinder wird immer wieder Bezug genommen auf die Sozialhilfe, genauer, auf die Hilfe zum Lebensunterhalt. Durch diese Rechtsprechung erfolgt eine systematische Verknüpfung von Sozialhilfe mit den Steuerfreibeträgen. Änderungen in der Sozialhilfe haben künftig nicht mehr nur noch finanzielle Auswirkungen in der Sozialhilfe selbst, sondern vor allem bei den Steuereinnahmen.
- Die Diskussion um den „Standort Deutschland" zielt vorrangig auf Löhne und Lohnnebenkosten. Angesichts sich verändernder Weltmarktsituationen sollen die wesentlichen Produktionskosten, die Lohnkosten, gesenkt werden. Wenn dies nominal nicht erreichbar ist, dann zumindest real durch Lohnsteigerungen unterhalb der Inflationsrate und durch Senkungen der Lohnnebenkosten. In diesen Zusammenhang paßt die Diskussion um die Kompensation der Arbeitgeberbeiträge zur Gesetzlichen Pflegeversicherung und der Vorschlag, den Arbeitgeber-
[Seite der Druckausg.: 86]
beitrag zur Gesetzlichen Krankenversicherung einzufrieren und absehbare Kostensteigerungen nur von den Arbeitnehmern tragen zu lassen.
Dieser Druck auf Löhne und Lohnnebenkosten verursacht entsprechenden Druck auf Lohnersatzleistungen, vor allem, wenn sie wegen Arbeitslosigkeit gezahlt werden. Die Geschichte des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) ist in den letzten Jahren eine Geschichte der Absenkung des Arbeitslosengeldes und der Arbeitslosenhilfe. Und natürlich muß die Sozialhilfe als letztes Netz unter den sozialen Netzen dieser „Abwärtsbewegung" folgen. Der Abstand zwischen Lohn, Lohnersatzleistungen und Sozialhilfe soll gewahrt bleiben. Dabei spielt es keine Rolle, daß von der Bundesregierung herausgegebene Untersuchungen eindeutig belegen, daß das sogenannte Lohnabstandsgebot bei der Festsetzung der Regelsätze eingehalten wird, es spielt keine Rolle, daß es bereits heute im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) materielle Anreizfunktionen zur Arbeitsaufnahme gibt und auch Sanktionsmöglichkeiten, wenn zumutbare Arbeit nicht angenommen wird. Die Sozialhilfe kommt unter „Beschuß" ganz unabhängig davon, ob sie gut „funktioniert" oder nicht, denn es geht trotz der öffentlichen Diskussion im Kern nicht um Probleme in der Sozialhilfe!
- Auch die Diskussion um die Kostenexplosion in der Sozialhilfe wird für diese andersgelagerten Zwecke instrumentalisiert. Es ist nicht zu bestreiten, daß die Sozialhilfeausgaben in den letzten 10 bis 15 Jahren dramatisch gestiegen sind und die kommunalen Haushalte unvertretbar belasten. In der öffentlichen Diskussion wird aber vorwiegend der Eindruck vermittelt, als sei vor allem das wesentlich zu hohe Niveau der ambulanten Hilfe zum Lebensunterhalt die Ursache für diese Kostenentwicklung. Wir wissen aber, daß diese Darstellung nicht zutrifft. In den 10 Jahren von 1983 bis 1993 sind die Ausgaben der ambulanten Hilfe zum Lebensunterhalt von 5.335 Mio. DM auf 13.595 Mio. DM gestiegen. Ursache dafür war im wesentlichen der erhebliche Anstieg der Empfängerzahlen. Jeder weiß, daß die Zahl der Sozialhilfeempfänger vor allem durch Arbeitslosigkeit und einen völlig unzureichenden Familienlastenausgleich verursacht ist, also ihre Ursache nicht etwa in der Sozialhilfe selbst haben. Betrachtet man die Kostenentwicklung pro Hilfeempfänger, beträgt der Anstieg der Ausgaben pro Hilfeempfänger in diesen 10 Jahren gerade 33,4%. Betrachtet man demgegen-
[Seite der Druckausg.: 87]
über die eigentliche Ursache für den enormen Kostenanstieg, nämlich die stationäre Hilfe in besonderen Lebenslagen, zeigt sich, daß die Ausgaben zwischen 1983 und 1993 von 10.136 Mio. auf 27.558 Mio. angestiegen sind. Bei diesen Leistungen hat sich die Zahl der Empfänger nur geringfügig erhöht. Die eigentliche Ursache für den Kostenanstieg in der Sozialhilfe zeigt sich, wenn man die Kostenentwicklung pro Hilfeempfänger betrachtet, der Anstieg in den letzten 10 Jahren betrug hier rund 110%. Diese Tatsachen werden in der Öffentlichkeit nicht diskutiert, weil die sich daraus logisch ergebenden Schlußfolgerungen nicht „passen".
2. Den Nachrang in der Sozialhilfe stärken
2.1 Hilfen in besonderen Lebenslagen
Betrachten wir zunächst, entgegen der sonst üblichen Systematik, die Hilfen in besonderen Lebenslagen. Die großen Kostenblöcke sind die Hilfe zur Pflege, die Eingliederungshilfe und die Krankenhilfe. Diese drei Hilfearten haben 1993 97% der gesamten Ausgaben für Hilfen in besonderen Lebenslagen verursacht. Bei der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege ist bzw. war die Sozialhilfe das einzige soziale Absicherungssystem für die Betroffenen. Hier sind die Kommunen für die Finanzierung der notwendigen Hilfen für Pflegebedürftige und Behinderte zuständig, während andere Risiken wie Krankheit, Unfall oder die Alterssicherung selbstverständlich über zentralstaatlich organisierte und finanzierte Systeme abgesichert werden. Diese Aufgabenverteilung ist systematisch nicht zu begründen. Gerade um Ausgrenzungsprozesse zu vermeiden, ist es sozialpolitisch sinnvoll, auch für Pflegebedürftige und Behinderte vorrangige soziale Leistungssysteme zu etablieren, wie dies bei fast allen anderen sozialen Lebensrisiken der Fall ist. Insofern wird mit der Einführung der Gesetzlichen Pflegeversicherung ein Schritt in die richtige Richtung getan.
Diesem muß ein weiterer Schritt folgen, und zwar ein vorrangiges Leistungsgesetz für Behinderte, das einkommens- und vermögensunabhängige Leistungen für Behinderte vorsieht, so daß auch diese Betroffenengruppe auf Sozialhilfeleistungen nicht mehr angewiesen ist. Die Bundes-
[Seite der Druckausg.: 88]
regierung hatte bereits in der letzten Legislaturperiode ein eigenes Sozialgesetzbuch, Recht der Rehabilitation Behinderter (SGB IX), vorgelegt. Darin waren aber entsprechende vorrangige Leistungen nicht vorgesehen, vor allem wohl wegen der dann entstehenden Finanzierungsprobleme. Diese müßten aber lösbar sein, denn auch heute erhalten die Behinderten die notwendigen Leistungen bereits finanziert, so daß es weniger um zusätzliche finanzielle Lasten geht, als vielmehr um eine Umverteilung zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen.
Drittens schließlich geht es um die Einbeziehung aller Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt in die Gesetzliche Krankenversicherung. Auch diese Forderung steht unter der Zielsetzung, Ausgrenzung zu verhindern und Normalität für alle Sozialhilfeempfänger zu sichern. Einen entsprechenden gesetzlichen Auftrag gibt es bereits mit Art. 28 des Gesundheitsstrukturgesetzes von 1992. Danach ist der Gesetzgeber aufgefordert, bis Ende 1996 eine generelle Pflichtversicherung aller Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt in der Gesetzlichen Krankenversicherung vorzusehen.
Alle drei Maßnahmen entlasten die Sozialhilfe ganz erheblich von Kosten. Bei der Gesetzlichen Pflegeversicherung wird mit jährlichen Einsparungen in einer Größenordnung von 8 Mrd. DM gerechnet. Auch wenn diese Summe umstritten ist, zeigt dies doch, daß die eigentliche Ausgabendynamik nur durch Veränderungen im vorrangigen Leistungsbereich, vor allem in bezug auf die Hilfen in besonderen Lebenslagen, zu bremsen ist.
2.2 Hilfe zum Lebensunterhalt
Betrachten wir die Hilfe zum Lebensunterhalt etwas genauer in bezug auf die Ausgabenentwicklung. Die „Hilfe zum Lebensunterhalt" (HLU) setzt sich im wesentlichen zusammen aus
|
ca. Anteil an der Gesamtleistung |
|
|
dem Regelsatz |
40% |
|
den Kosten der Unterkunft |
40% |
|
den einmaligen Leistungen, Mehrbedarf usw. |
20% |
[Seite der Druckausg.: 89]
Mit anderen Worten: Die Entwicklung der Mieten, der Mietnebenkosten und der Heizenergiekosten hat auf die Ausgaben der ambulanten Hilfe zum Lebensunterhalt etwa die gleichen Auswirkungen wie Veränderungen im Regelsatz. In der öffentlichen Diskussion wird darüber aber praktisch nicht gesprochen. Die Entwicklung der Mietkosten, vor allem auch die erheblichen Kostensteigerungen bei öffentlichen Gebühren, etwa Müllgebühren, haben in den letzten Jahren wesentlich größeren Einfluß auf die Ausgabenentwicklung ausgeübt, als die Anhebung der Regelsätze. Die Miet- und Mietnebenkosten stiegen in den Jahren von 1983 bis 1993 um 62,4%, während der Regelsatz lediglich um 49,4% stieg. Vor allem für die Zukunft sehe ich hier die wesentliche Ursache für den Ausgabeanstieg, da Millionen von Sozialwohnungen aus der Sozialbindung herausfallen werden und für diese Wohnungen, in denen überdurchschnittlich viele Sozialhilfeempfänger wohnen, mit noch höheren Mietpreissteigerungen zu rechnen ist. Deshalb bleibt die oft wiederholte Forderung richtig, preiswerten Wohnraum für Personen zur Verfügung zu stellen, die mit niedrigem Einkommen auskommen müssen, also auch für Sozialhilfeempfänger. Wenn dies nicht erfolgt, muß zumindest die individuelle Förderung über das Wohngeld deutlich angehoben werden, für Sozialhilfeempfänger möglichst auf 100% der angemessenen Wohnkosten. Allein diese Maßnahme würde die kommunalen Haushalte um einen Betrag in einer Größenordnung von rund 1.600 Mio. DM entlasten.
Eltern, vor allem Alleinerziehende, werden häufig nur deshalb sozialhilfebedürftig, weil sie Kinder haben. Mehr als ein Drittel aller Sozialhilfeempfänger sind Kinder. Dies ist die Folge eines seit Jahren vollkommen ungenügenden Familienlastenausgleichs. Dabei führt schon der Begriff Familienlastenausgleich in die Irre. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes hat deutlich gemacht, daß das geltende duale System von Steuerfreibetrag und Kindergeld so unzureichend ist, daß nicht einmal eine verfassungsrechtlich zwingende Steuergerechtigkeit zwischen Steuerpflichtigen mit Kindern im Verhältnis zu denen ohne Kinder besteht. Von einem Ausgleich der materiellen Lasten, die Familien mit Kindern entstehen, kann erst recht nicht die Rede sein. Auch die jetzt auf dem Tisch liegenden Vorschläge der Bundesregierung mit einem Kindergeld von 200,- DM für das erste und zweite Kind und von 300,- DM für das dritte Kind sind nicht ausreichend, um die geforderte Steuergerechtigkeit herzustellen. In jedem Fall ist weder der heutige Betrag von Kindergeld und
[Seite der Druckausg.: 90]
Kindergeldzuschlag von 135,- DM für das erste Kind, noch ein künftiger von 200,- DM ausreichend, um damit den notwendigen Lebensunterhalt eines Kindes zu decken.
Deshalb wäre es notwendig, das Kindergeld in einem ersten Schritt auf mindestens 250,- DM für alle Kinder anzuheben. Es gibt keine systematischen Gründe, das Kindergeld ab dem dritten oder vierten Kind höher anzusetzen als beim ersten oder zweiten Kind. Die Kosten, die durch ein Kind verursacht werden, unterscheiden sich nicht danach, ob es sich um das erste, zweite oder dritte Kind handelt. Unterschiedliche Kosten hängen vor allem vom Alter des Kindes ab. Dem wird in der Sozialhilfe durch die nach Alter gestaffelten Regelsätze Rechnung getragen. Insofern wäre es perspektivisch gesehen richtig, auch die Kindergeldleistungen nach dem Alter zu staffeln.
Aus Sicht der Sozialhilfe müßte das einkommensunabhängige Kindergeld von 250,- DM allerdings unterfüttert werden durch ein einkommensabhängiges Kindergeld. Wenn einerseits ein steuerlicher Kinderfreibetrag das Einkommen, das zur Finanzierung des Bedarfs von Kindern erforderlich ist, freistellt, wäre es andererseits nur konsequent, Eltern, deren Einkommen nicht ausreicht, sich selbst und ihre Kinder auf diesem Mindestniveau zu versorgen, ein entsprechend an dem Mindestbedarf ausgerichtetes Kindergeld zu gewähren. Die Höhe dieses Betrages müßte sich aus sozialhilferechtlichen Berechnungen ergeben. Nach Berechnungen einer von der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister eingesetzten Arbeitsgruppe von Familienpolitik- und Sozialhilfeexperten lag dieser Betrag Ende 1994 bei 628,- DM monatlich. Denkbar wäre es, diesen Einheitsbetrag ebenfalls nach dem Alter der Kinder zu staffeln, so daß ein einkommensabhängiges Kindergeld zwischen etwa 600,- und 800,- DM Sozialhilfebedürftigkeit von Kindern im Regelfall verhindern würde.
Letzter und fast wichtigster Punkt bei der Verbesserung vorrangiger Sozialleistungsansprüche für Sozialhilfeempfänger sind Reformen im Arbeitsförderungsrecht. Zum einen müssen die Lohnersatzleistungen, vor allem die Arbeitslosenhilfe so strukturiert werden, daß sie „armutsfest" sind und keine ergänzenden Sozialhilfeleistungen mehr in Anspruch genommen werden müssen. Derartige Regelungen verhindern doppelte Antragstellungen und doppelte Bürokratien. Sie wären ein Beitrag zur Vereinfachung des Sozialleistungssystems und zur Verbesserung der Über-
[Seite der Druckausg.: 91]
schaubarkeit für den Bürger. Die Mindestleistung der Arbeitslosenhilfe braucht dabei nicht höher zu sein als die Sozialhilfeleistung. Insofern ist dieser Vorschlag bezogen auf den Gesamtstaat kostenneutral.
Auf keinen Fall darf die Arbeitslosenhilfe zeitlich befristet werden. Für arbeitslose Sozialhilfeempfänger haben die Sozialhilfeträger 1993 zwischen 5 und 6 Mrd. DM aufgewendet, die je nach Art und Umfang der Verbesserungen in der vorrangigen Arbeitslosenhilfe teilweise verringert werden könnten. Wird die Arbeitslosenhilfe demgegenüber auf zwei Jahre befristet, sind nach Berechnung der kommunalen Spitzenverbände Mehraufwendungen in einer Größenordnung von 4 Mrd. DM zu erwarten.
Zum zweiten sollten arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger in die aktive Arbeitsmarktpolitik des AFG einbezogen werden, also auch Ansprüche auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Fortbildung und Umschulung erhalten. Dabei sollten die Sozialhilfeträger Beiträge in Höhe der Arbeitgeberleistungen zur Arbeitslosenversicherung zahlen. Durch die Einbeziehung der Sozialhilfeempfänger in die aktive Arbeitsmarktpolitik würden bei den Sozialhilfeträgern Minderausgaben in Höhe von rund 700 Mio. DM anfallen, die mit den rund 200 Mio. Arbeitgeberbeiträgen saldiert zu Netto-Minderausgaben für die Sozialhilfeträger von rund 500 Mio. DM führen würden. Zumindest wäre es notwendig, einen nahtlosen Übergang von Arbeitsverträgen nach § 19 BSHG in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu ermöglichen.
Zusätzlich könnten Einkommensberechnungen, die Einkommensanrechnung sowie die Vorschriften zur Anrechnung des Vermögens zwischen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe harmonisiert werden.
3. Sozialhilfe und Arbeit
Sozialhilfebedürftigkeit wird einerseits durch „armutsfeste" vorrangige Sicherungssysteme und andererseits durch effektive Hilfen im Rahmen der Sozialhilfe verhindert und überwunden. Dazu dient insbesondere die Hilfe zur Arbeit.
Der Referentenentwurf der Bundesregierung sieht in diesem Zusammenhang folgende Maßnahmen vor:
[Seite der Druckausg.: 92]
- „Die Arbeitsaufnahme von schwer vermittelbaren Sozialhilfeempfängern soll künftig durch befristete Lohnkosten- und Einarbeitungszuschüsse an Arbeitgeber, durch Leiharbeit, berufliche Qualifizierung und die Teilnahme an Arbeitsförderungsmaßnahmen unterstützt werden. Die Maßnahmen kann der Sozialhilfeträger selbst organisieren oder damit das Arbeitsamt beauftragen.
- Der Arbeitsanreiz für schwer vermittelbare Sozialhilfeempfänger soll durch höhere Freibeträge bzw. Zuschüsse verbessert werden. Die Zuschüsse sollen auf sechs Monate befristet und degressiv gestaltet werden. Darüber hinaus sollen anrechnungsfreie Zuschüsse zu einer Saisonbeschäftigung geleistet werden können.
- Bei Verweigerung zumutbarer Arbeit soll künftig verbindlich eine Kürzung des Regelsatzes um mindestens 25% vorgesehen werden."
Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung dazu vorgeschlagenen Regelungen sind in weiten Teilen entweder überflüssig, weil bereits mit dem heute vorhandenen rechtlichen Instrumentarium gleiche Maßnahmen finanziert werden können, oder aus inhaltlichen Gründen abzulehnen. Dazu einige Beispiele:
Die in § 20a Abs. 1 (BSHG) vorgesehenen Zuschüsse an Arbeitgeber für die Einarbeitungszeit oder die Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt sind bereits heute im Rahmen des § 19 Abs. 1 rechtlich möglich und werden auch von einigen Sozialhilfeträgern bereits praktiziert. Die im Gesetzentwurf formulierten Bedingungen, insbesondere die Begrenzung der Zuschüsse auf die zuvor gezahlten Sozialhilfeleistungen, sind aber so, daß diese Maßnahmen keinen großen Erfolg haben werden; das zeigen die praktischen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das gleiche gilt für die auf sechs Monate begrenzten Zuschüsse für Hilfeempfänger, die eine Vollzeittätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen (§ 20a Abs. 4). Zum einen ist der monatliche Zuschuß bis zur Höhe des Eckregelsatzes relativ niedrig, zum zweiten besteht bei über 90% der arbeitsfähigen Sozialhilfeempfänger nicht das Problem, daß sie auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Vollzeiterwerbstätigkeit aufnehmen wollen, sondern daß es der Arbeitsmarkt nicht möglich macht. Insofern wird diese Regelung kaum mehr Sozialhilfeempfänger in den ersten Arbeitsmarkt integrieren, für diejenigen aber, die die Chance hatten, einen Arbeitsplatz zu erhalten, wird der Zuschuß einen reinen Mitnahmeeffekt haben.
[Seite der Druckausg.: 93]
Richtig ist es, auch für Sozialhilfeempfänger systematisch Qualifizierungsangebote zu machen (§ 20a Abs. 3). Auch das ist bereits nach geltendem Recht möglich. Das eigentliche Problem liegt darin, daß vorrangig das Arbeitsamt für Fortbildung und Umschulung zuständig ist und bleiben soll. Insofern ist die Forderung richtig, muß aber so umgesetzt werden, daß Sozialhilfeempfängern ein eigener Rechtsanspruch auf Fortbildung und Umschulung nach dem AFG eingeräumt wird. Es ist abzulehnen, daß jetzt auch noch die aktive Arbeitsmarktpolitik kommunalisiert wird. Ganz deutlich wird diese Zielrichtung, wenn die Maßnahmen im Auftrag des Sozialhilfeträgers vom Arbeitsamt durchgeführt werden, die Kosten aber vom Sozialhilfeträger zu zahlen sind, einschließlich der Verwaltungskosten des Arbeitsamtes (§ 20b).
Abzulehnen ist auf jeden Fall die Verpflichtung des Sozialhilfeträgers, bei Arbeitsverweigerung die Sozialhilfe um 25% des maßgebenden Regelsatzes kürzen zu müssen (§ 25). Diese Vorschrift wird zum einen dem Individualierungsgrundsatz in der Sozialhilfe nicht gerecht und ist für die Praxis der Sozialhilfeträger auch nicht erforderlich. Die Sozialämter gehen durchaus konsequent, aber flexibel mit Hilfeempfängern um, die die Arbeit verweigern. Durch „Zwang" ist eine erfolgreiche Integration der Betroffenen in den Arbeitsprozeß in der Regel nicht zu erreichen. Im übrigen sind die Problemlagen der Betroffenen, die Arbeit verweigern, so unterschiedlich, daß nur mit differenzierten Mitteln, zu denen auch die Kürzung der Sozialhilfeleistung als ein Mittel gehören kann und muß, individuell ein Hilfe- und Stützungs-„Paket" geschnürt werden kann.
Ebenso sind die Regelungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme in der Saisonarbeit (§ 20a Abs. 5) abzulehnen. Hier ist für befristete Beschäftigungen von drei Monaten ein Lohnzuschuß von 25,- DM täglich bei einer Vollarbeitskraft möglich. Diese Lohnsubvention in einem besonderen Arbeitsmarktsegment wird nicht zu verstärkter Beschäftigung führen, sondern zu einem Wettbewerbsvorteil der Sozialhilfeempfänger zu Lasten anderer Saisonarbeiter, die dann entsprechend arbeitslos werden. Soweit es sich um deutsche Arbeitnehmer handelt, wird der eine Arbeitslose durch einen anderen ersetzt. Bei ausländischen Arbeitnehmern handelt es sich häufig um Wanderarbeitnehmer aus den osteuropäischen Ländern. Hier wäre eine Steuerung sinnvoller, indem die entsprechenden Kontingente verringert werden. Im übrigen wird eine Subvention von 25,- DM ar-
[Seite der Druckausg.: 94]
beitstäglich sehr schnell dazu führen, daß die Löhne für Nicht-Sozialhilfeempfänger um genau diesen Betrag verringert werden. Damit entsteht ein erheblicher Druck gerade im untersten Lohnbereich.
Diese neuen rechtlichen Regelungen sind also nicht notwendig. Notwendig ist eine Integration der Sozialhilfeempfänger in die aktive Arbeitsmarktpolitik der Bundesanstalt für Arbeit, notwendig ist die stärkere Verzahnung von Arbeits- und Sozialämtern, aber nicht nur auf Kosten der Kommunen, sondern auch zu Lasten der Bundesanstalt. § 12b AFG bietet entsprechende Möglichkeiten, wenn dafür seitens des Bundes die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Notwendig bleibt eine stärkere Anwendung des bestehenden Hilfeinstrumentariums der Hilfe zur Arbeit durch die Kommunen, die zum Teil damit in der Vergangenheit zu zögernd umgegangen sind.
4. Das Bedarfsdeckungsprinzip erhalten und das Existenzminimum sichern
In der Hilfe zum Lebensunterhalt ist der Regelsatz ein zentraler Parameter, der das Maß dafür darstellt, was dem Menschen in unserer Gesellschaft zum Leben zugebilligt wird. Dabei ist das Bedarfsdeckungsprinzip einer der Grundpfeiler des Bundessozialhilfegesetzes.
Der Referentenentwurf der Bundesregierung sieht dazu folgende Regelungen vor:
- „Ab 1999 soll der Bund Mindestregelsätze festsetzen, die jährlich nach der statistischen Veränderung von Nettoeinkommen, Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten fortgeschrieben werden. Die Länder können aufgrund regionaler Besonderheiten unter Beachtung des Lohnabstandsgebots Erhöhungen vornehmen.
- Die am 30. Juni 1996 geltenden Regelsätze der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt sollen für eine Übergangszeit von drei Jahren in demselben Umfang angehoben werden, wie die Nettoarbeitsentgelte in den alten Ländern steigen.
- Es soll klargestellt werden, daß die Hilfe zum Lebensunterhalt künftig um einen bestimmten Prozentsatz unter den Nettoarbeitsentgelten bzw.
[Seite der Druckausg.: 95]
verfügbaren Einkommen unterer Lohn- und Gehaltsgruppen liegen muß. Einmalige Leistungen der Sozialhilfe sind in die Vergleichsberechnung ebenso einzubeziehen wie einmalige Zahlungen an die Arbeitnehmer."
Die vorgeschlagenen Regelungen stellen eine wesentliche Änderung des geltenden Rechts dar. Die Vorschläge müssen differenziert betrachtet werden.
Zunächst einmal ist festzustellen, daß es keinen sachlichen Grund gibt, die Kompetenz zur Festsetzung der Regelsätze von den Ländern auf den Bund zu übertragen. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit lassen nicht erwarten, daß der Bund die von ihm vorgesehenen Mindestregelsätze fachlich kompetenter ermitteln und festsetzen wird als die Länder. Der Versuch, die Festsetzungskompetenz auf den Bund zu übertragen, muß vielmehr im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Sozialhilferegelsätze auf andere Rechtsbereiche gesehen werden, vor allem auf die Steuerfreibeträge. Die Länder werden diesen Vorschlägen nicht zustimmen.
Zur Bemessung der Regelsätze wird künftig in einer Rechtsverordnung ein statistisches Verfahren festgelegt und für die jährliche Anpassung der Regelsätze ein Fortschreibungsmodus (Regelsatzformel). Dabei sind Stand und Entwicklung von Nettoeinkommen, Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten zu berücksichtigen (§ 22 Abs. 2). Grundsätzlich geht dieser Vorschlag in eine von den Ländern zu unterstützende Richtung. Der Teufel steckt hier bekanntlich im Detail. Zum einen muß eine derartige Rechtsverordnung - vor allem wenn die Festsetzungskompetenz bei den Ländern verbleibt - an die Zustimmung des Bundesrates gebunden werden. Zum zweiten bleibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar, wie denn diese Mischung aus Nettoeinkommen, Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten konkret aussieht. Bei diesen drei Faktoren lassen sich sowohl die zugrundeliegenden Daten wie auch die jeweilige Gewichtung sehr unterschiedlich erheben und strukturieren, mit entsprechend sehr unterschiedlichen Auswirkungen auf die Entwicklung der Regelsätze. In der Begründung wird auf die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe Bezug genommen. Diese soll zwar weiterhin die Grundlage bilden, wie aber die Entwicklung der Nettoeinkommen berücksichtigt werden soll, bleibt unklar.
[Seite der Druckausg.: 96]
Die Neuregelung soll erst ab dem 1. Juli 1999 in Kraft treten. Begründet wird dies vor allem damit, daß erst zu diesem Zeitpunkt die ausgewerteten Daten der EVS 1993 für ganz Deutschland vorliegen und deshalb auch erst zu diesem Zeitpunkt einheitliche Mindestregelsätze festgesetzt werden können. Nun ist gerade bei diesen Daten abzusehen, daß bei einem bundeseinheitlichen Mindestregelsatz das niedrigere Preisniveau, das geringere Einkommen und deshalb auch das unterschiedliche Verbrauchsverhalten in den neuen Ländern den bundeseinheitlichen Mindestregelsatz nach unten definieren werden. Die Sozialressorts in den alten Ländern werden es unter den überall zunehmenden Finanzierungszwängen sehr schwer haben, sich in den Länderkabinetten mit nach oben abweichenden höheren regionalen Regelsätzen durchzusetzen.
In der Zwischenzeit bleiben die Regelsätze gedeckelt. Sie sollen in den Jahren 1996 bis 1998 um den Prozentsatz verändert werden, um den sich die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung der alten Bundesländer verändern. Dies bedeutet weiterhin eine Fortschreibung entsprechend der Nettolohnentwicklung, besonders restriktiv auch deshalb, weil das Jahr 1995 mit seinen auf das Gesamtjahr bezogenen niedrigen Lohnabschlüssen gleich zweimal als Maßstab herangezogen wird - im Jahr 1995 nach geltendem Recht mit plus 1,1% und im Jahr 1996 nach neuem Recht, entsprechend der absehbar unter der Preisentwicklung liegenden Rentenentwicklung in den alten Ländern.
Darüber hinaus besteht die Befürchtung, daß der Fortschreibungsmodus orientiert an der Nettolohnentwicklung auch über das Jahr 1999 hinaus fortgesetzt wird, wenn über die Verordnung mit der „Regelsatzformel" keine Einigung, sei es innerhalb der Bundesregierung oder auch zwischen Bund und Ländern, erzielt werden kann. Diese Vermutung wird verstärkt durch die neue Orientierung an der Rentenentwicklung, die in sich schlüssiger und nachvollziehbarer ist als das geltende Recht mit seiner Einschätzung der voraussichtlichen Nettolohnentwicklung.
Drittens geht es um eine Neudefinition des sogenannten Lohnabstandsgebots. Der Vergleichsmaßstab ist jetzt präziser definiert mit der Haushaltsgemeinschaft von zwei Erwachsenen (Ehepaar) mit drei Kindern. Hier müssen die Regelsätze zusammen mit den Durchschnittsbeträgen für Kosten von Unterkunft und Heizung sowie für einmalige Leistungen um mindestens 15% unter den erzielten monatlichen durchschnittlichen Netto-
[Seite der Druckausg.: 97]
arbeitsentgelten unterer Lohn- und Gehaltsgruppen zuzüglich Kindergeld und Wohngeld in einer entsprechenden Haushaltsgemeinschaft mit einem alleinverdienenden Vollzeitbeschäftigten bleiben.
Diese Neuregelung bedeutet eine beträchtliche Verschärfung gegenüber dem geltenden Recht. Erstens waren bislang einmalige Leistungen nicht zu berücksichtigen, vor allem aber gab es keinen gesetzlich festgeschriebenen Mindestabstand von 15%, bezogen auf den gesamten Bedarf dieser fünfköpfigen Familie. Legt man die ab 1. Juli 1995 geltenden Durchschnittsregelsätze der alten Länder zugrunde, einmalige Leistungen pauschal von 17% und eine Miete von 900,- DM plus 200,- DM Heizkosten, ergibt sich ein Abstandsbetrag von rund 600,- DM gegenüber einem heute in der Regel berücksichtigten Abstandsbetrag von rund 260,- DM. Diese Verschärfung wird in der Begründung unter anderem damit gerechtfertigt, daß durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs und die steuerliche Freistellung des Existenzminimums das Vergleichseinkommen ansteigt. Dabei muß man wissen, daß der Vorschlag der Bundesregierung zum Familienlastenausgleich bei Geringverdienern mit drei Kindern zu einer Einkommensverbesserung von gerade 85,- DM führt (von zur Zeit 615,- DM Kindergeld und Kindergeldzuschlag auf künftig 700,- DM Kindergeld). Die Steuerentlastung gilt für Geringverdiener auf Grund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der daraufhin ergangenen Verwaltungsregelungen bereits heute.
Im übrigen ist die Referenzgruppe, eine fünfköpfige Familie mit einem alleinigen Vollzeitverdiener, in der sozialen Wirklichkeit nicht in einem empirisch relevanten Umfang aufzufinden. In der Begründung wird kein Wort darüber verloren, warum eigentlich das Erwerbseinkommen eines Vollerwerbstätigen - eigentlich des Ehemannes oder der Ehefrau? - ausreichen soll, eine fünfköpfige Familie zu ernähren. Die soziale Realität sieht längst anders aus. Erstens gibt es von insgesamt rund 36 Mio. Haushalten nur etwa 800.000 Haushalte mit einem Ehepaar mit drei Kindern, von diesen Haushalten wiederum gibt es kaum solche mit nur einem Alleinverdiener, vor allem nicht im Bereich unterer Lohn- und Gehaltseinkommen - nicht zuletzt, weil jeder weiß, daß man damit kein dem üblichen Standard entsprechendes Leben führen kann. Welche Legitimation hat also ein solches an der sozialen Realität vorbeigehendes Lohnabstandsgebot? Dazu kommt, daß zunehmend das Haushaltseinkommen
[Seite der Druckausg.: 98]
nicht mehr ausschließlich durch Erwerbseinkommen geprägt wird. In den nächsten Jahren werden Werte in einer Größenordnung von mehreren Billionen DM vererbt, die Zahl der Haus- und Wohnungseigentümer steigt. Zinseinkommen und Nutzungsvorteile abbezahlter Eigentumswohnungen spielen eine erhebliche Rolle bei den Haushaltseinkommen. Alle diese Faktoren spielen bei dem „Lohnabstandsgebot" keine Rolle. Es wäre also ehrlicher, einen Abstandsfaktor zum durchschnittlichen Haushaltseinkommen festzusetzen, als den zweifelhaften Vorschlag der Bundesregierung zu unterstützen.
5. Verschärfung der gegenseitigen Einsatzpflicht bei Menschen, die zusammen wohnen
In der Bedarfs- und Nachranglogik der Sozialhilfe stellt sich die Frage, wie das Zusammenleben von Menschen bei der Berechnung des individuellen Bedarfs berücksichtigt wird. Nach dem geltenden Recht wird bei nicht getrennt lebenden Ehegatten und, wenn Kinder vorhanden sind, mit diesen zusammen eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft gebildet, Bedarf und Einkommen wird insgesamt berücksichtigt. Eheähnliche Gemeinschaften sind Ehegatten gleichgestellt. Soweit Verwandte und Verschwägerte in einer Haushaltsgemeinschaft zusammenleben, besteht die widerlegbare gesetzliche Vermutung, daß ein in dieser Haushaltsgemeinschaft lebender Sozialhilfeempfänger von seinen Verwandten Leistungen zum Lebensunterhalt erhält, die entsprechend den Sozialhilfeanspruch verringern.
Die geltenden Regelungen haben erhebliche Auslegungs- und Nachweisprobleme mit sich gebracht. Wer gehört zu einer eheähnlichen Gemeinschaft, auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften? Wie wird das Vorliegen einer eheähnlichen Gemeinschaft nachgewiesen? Ab wann handelt es sich um eine eheähnliche Gemeinschaft, nach drei Monaten Zusammenlebens, nach sechs Monaten? Wie wird die Vermutung, daß in einer Haushaltsgemeinschaft Leistungen zum Lebensunterhalt gewährt werden, glaubhaft widerlegt?
Die bestehenden Probleme rühren vor allem aus einer ungenügenden Abstimmung zwischen Unterhaltsrecht und Sozialhilferecht her. Sinnvoll
[Seite der Druckausg.: 99]
wäre es, unterhaltsrechtliche Leistungsverpflichtungen auch im Sozialhilferecht zum Maßstab für gegenseitige Leistungen zum Lebensunterhalt zu machen. Das gleiche gilt übrigens für das Steuerrecht. Wenn eine nichteheliche Lebensgemeinschaft unterhaltsrechtlich unbeachtlich ist, sollte dies ebenso wie es heute im Steuerrecht gilt, auch in der Sozialhilfe gelten. Wenn die gesellschaftliche Entwicklung weitergeht und etwa unterhaltsrechtliche Leistungsansprüche auch für nichteheliche Lebensgemeinschaften oder gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften normiert werden, sollte dies im Steuerrecht durch Anwendung der Splitting-Tabelle ebenso gelten wie im Sozialhilferecht.
Der gleiche Grundsatz sollte für das Zusammenleben in anderen Haushaltsgemeinschaften gelten. Es ist doch nicht nachvollziehbar, daß weder unterhaltsrechtlich noch steuerrechtlich das Zusammenleben etwa von Geschwistern irgendeine Rolle spielt, wohl aber bei der Gewährung von Sozialhilfeleistungen. Getrennt davon zu sehen ist der individuelle Bedarf der Personen, die in einer Haushaltsgemeinschaft mit anderen leben. Es ist durchaus angemessen, daß der Regelsatz um den Anteil der Generalkosten verringert wird, der von dem anderen Mitbewohner getragen wird, etwa um 10%; die Mietkosten sollten pro Kopf auf die Bewohner umgelegt werden, auch daraus ergibt sich ein in der Regel niedrigerer Bedarf. Es sollte aber aus dem Zusammenleben von ganz verschiedenen Menschen in einer Wohnung nicht automatisch geschlossen werden, daß diese auch eine Einstandspflicht für ihren Mitbewohner haben.
Und genau diese schon heute unbefriedigende rechtliche Situation wird durch den Entwurf der Bundesregierung noch einmal deutlich verschärft. Künftig wird die gesetzliche Vermutung, daß Personen, die in einer Haushaltsgemeinschaft leben, von ihren Mitbewohnern Leistungen zum Lebensunterhalt erhalten, auf alle Bewohner von Haushaltsgemeinschaften ausgedehnt und nicht mehr, wie im geltenden Recht, auf Verwandte und Verschwägerte begrenzt. Eine derartige Regelung gibt es in keinem anderen Rechtsbereich. Auf Grund der völligen Ungleichbehandlung und Benachteiligung dieser Lebensform im Sozialhilferecht, die ja ein sozial erwünschtes Zusammenleben von Menschen gerade verhindert, sowie aus den bereits genannten Kritikpunkten an den geltenden Regelungen sollte diese Neufassung der §§ 16 und 122 BSHG abgelehnt werden
[Seite der Druckausg.: 100]
6. Vertragliche Vereinbarungen zwischen Sozialhilfeträgern und Erbringern sozialer Dienstleistungen
Mit den im Jahr 1993 neu gefaßten §§ 93, 94 BSHG sind die sogenannten Pflegesatzvereinbarungen zwischen Sozialhilfeträgern einerseits und Leistungserbringern, in der Regel der freien Wohlfahrtspflege, andererseits auf eine neue Grundlage gestellt worden. Die 1993 im Zuge des 2. Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms (SKWPG) eingeführten Neuregelungen der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen waren nicht genügend durchdacht, so daß bei ihrer Anwendung in der Praxis erhebliche Probleme aufgetreten sind.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht hier vor, daß die Pflegesätze in Einrichtungen in den Kalenderjahren 1996, 1997 und 1998 nicht stärker steigen sollen als die allgemeinen Löhne. Ab 1999 erfolgt die Vergütung durch Pauschalen für Leistungskomplexe.
Für die Träger bedeutet dies eine Deckelung der Pflegesätze in den kommenden Jahren. Für viele Einrichtungsträger wird dies nicht die erste Deckelung sein, weil die überörtlichen Träger der Sozialhilfe bereits in den letzten Jahren verstärkt entsprechende pauschale Entgeltfortschreibungen vereinbart haben. Insofern bedeutet dies eine Festschreibung des qualitativen und quantitativen Versorgungsstandards auf den Zustand zu Beginn der neunziger Jahre. Aus Sicht der Kostenträger wird eine solche Deckelung sicherlich begrüßt werden, weil insbesondere die Kosten in stationären Einrichtungen in den letzten Jahren weit überproportional gestiegen sind.
Auf die Einzelheiten der Regelungsvorschläge will ich in diesem Zusammenhang nicht eingehen. Sie sind insgesamt durchaus diskussionswürdig und werden von den Ländern in der generellen Zielrichtung sicherlich unterstützt.
Zu bedenken geben möchte ich in diesem Zusammenhang zwei Erfahrungen, die wir vor dem Hintergrund der neu eingeführten Gesetzlichen Pflegeversicherung gemacht haben. Zum einen findet bei der Vereinbarung von Leistungskomplexen und darauf bezogener Entgelte eine zunehmende Ökonomisierung der sozialen Dienstleistungen statt. Dies führt zu Rationalisierung und Intensivierung der Arbeit der Beschäftigten sowie zu mehr
[Seite der Druckausg.: 101]
Transparenz über die erbrachten Leistungen - das ist gewollt. Andererseits führt dies aber für die betroffenen Hilfeempfänger dazu, daß ein ganzheitlicher Lebenszusammenhang durch die einzelnen Leistungskomplexe vollkommen zerrissen wird. Dabei spielt eine große Rolle, daß es hier häufig, anders als im Krankenhaus, um eine lebenslange Dauerversorgung geht, vor allem bei Behinderten.
Gewinnmöglichkeiten und Rationalisierungsdruck verschärfen die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Deshalb spielt die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle eine zunehmende Bedeutung. Dabei reicht das alte Instrumentarium des Heimgesetzes nicht aus. Statt die Qualitätssicherung und -kontrolle zu verstärken, sieht der Gesetzentwurf demgegenüber eine Schwächung der Heimaufsicht vor. Notwendig ist vielmehr eine moderne Fortentwicklung der Heimaufsicht zu einer Qualitätssicherungsinstanz, die auch empirische Datenerhebungen, etwa in Form von systematischen Bewohnerbefragungen usw., anstellen sollte.
7. Was fehlt
Der Gesetzentwurf sieht weitere Neuregelungen vor, die ich hier nur andeuten möchte, ohne auf sie im einzelnen näher einzugehen. Die sind vor allem:
- Die Arbeitsentgelte der Behinderten in Werkstätten sollen verbessert werden. Dazu gehören umfangreiche Neuregelungen im BSHG, Schwerbehindertengesetz und der Werkstättenverordnung.
- Die zuständigen Sozialleistungsträger sollen künftig verpflichtet werden, aufgrund überschlägiger Prüfung der Leistungsvoraussetzungen Vorschüsse zu leisten, wenn ausreichende Hinweise des Antragstellers auf seine Bedürftigkeit vorgelegt werden,
- Zukünftig sollen rückständige Mieten von der Sozialhilfe übernommen werden, wenn sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Räumungsklagen sollen von den Amtsgerichten den Sozialhilfeträgern gemeldet werden, damit diese rechtzeitig vorbeugend tätig werden können.
[Seite der Druckausg.: 102]
- In den neuen Ländern werden die Mehrbedarfsregelungen für Erwerbsunfähige und über 65jährige sowie Blindenhilfe und Pflegegeld dem Recht in den alten Ländern angeglichen.
Andererseits ist festzustellen, daß viele Regelungsnotwendigkeiten in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht aufgegriffen werden. Auch davon sollen einige exemplarisch aufgezählt werden:
- Einkommensgrenzen, Einkommensbegriffe und Altersstufungen bei Minderjährigen sollten in den verschiedenen Sozialleistungsgesetzen schrittweise mit den Regelungen im BSHG harmonisiert werden, etwa beim Unterhaltsvorschußgesetz, bei der Regelunterhaltsverordnung, bei der Arbeitslosenhilfe.
- Die Auszahlung der Sozialhilfe sollte künftig regelmäßig auf ein bei Sparkassen und Banken zu führendes Guthabenkonto erfolgen. Sollten Banken und Sparkassen sich nicht freiwillig zur Einrichtung derartiger Guthabenkonten bereit erklären, ist dies gesetzlich zu regeln.
- Nachdem Pflegebedürftige über die Gesetzliche Pflegeversicherung abgesichert sind. Blinde in allen Ländern einkommens- und vermögensunabhängige Leistungen erhalten, besteht keine sozialpolitische Notwendigkeit mehr, unterschiedliche Einkommensgrenzen nach §§ 79-81 BSHG vorzusehen.
- Die Vorschriften über die Anrechnung von Vermögen sollten vereinfacht werden. Die Vermögensfreibeträge sollten vollständig vereinheitlicht werden und mit den Freibeträgen in der Arbeitslosenhilfe abgestimmt sein. Eine angemessene Höhe dient auch der Zielsetzung, die Sozialhilfe zu überwinden.
- Das Bundessozialhilfegesetz sollte ein eigenständiges Buch im Sozialgesetzbuch werden.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Oktober 2000