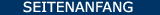![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 64 = Leerseite]
[Seite der Druckausg.: 65]
Stephan Leibfried
Reform der Sozialhilfe aus Sicht der Wissenschaft *
[ Fn.*: Nachdruck aus: Zeitschrift für Sozialreform, 41. Jg., 1995, H. 6 (Themenheft zur Reform der Sozialhilfe).]
Wenn man das menschliche Glück befördern könnte,
indem man die Augen verschließt und eine
willkürliche Armutsgrenze zieht,
so würde eine starre Beschränkung
der Ausgaben für die Armenpflege es befördern:
Aber so billig ist Glück nicht zu haben,
noch Klugheit unter Beweis zu stellen.
Jeremy Bentham, 18. Jahrhundert
Die Sozialhilfe bereitet vielen westlichen Gesellschaften Probleme. Die neue, republikanische Mehrheit im amerikanischen Repräsentantenhaus fordert Kürzungen von 69 Mrd. Dollar in fünf Jahren, womit einem der großen sozialpolitischen Reform vorhaben
[Fn.1: Als wissenschaftliche Programmschrift vgl. Mary Jo Bane/David Ellwood, Welfare Realities: From Rhetoric to Reform, Cambridge, Harvard University Press 1994.]
der Regierung Clinton ein Ende gesetzt worden ist.
[Fn.2: Zur amerikanischen Sozialhilfe vgl. Michael Wiseman, in: Zeitschrift für Sozialreform, 41. Jg., 1995, H. 6 (Themenheft zur Reform der Sozialhilfe).]
Die Sozialhilfe, so der Abgeordnete Mica aus Florida, sei „wie das Füttern von Krokodilen": nie könnten die Zahlungsempfänger genug kriegen.
[Fn.3: Repräsentantenhaus billigt Kürzungen der Sozialleistungen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27. März 1995.]
Die aktuelle Reformdebatte in Deutschland, ausgelöst 1994 durch die Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl und nun umgesetzt durch den Gesetzesentwurf von Minister Horst Seehofer, nimmt sich vergleichsweise bescheiden aus, dürfte aber auf die größte Fürsorge„reform" seit Einführung der modernen Sozialhilfe im Jahre 1962 [Fn.4: Vgl. Michael Heisig, Armenpolitik im Nachkriegsdeutschland (1945-1964). Die Entwicklung der Fürsorgeunterstützungssätze im Kontext allgemeiner Sozial- und Fürsorgereform, Frankfurt a.M.: Deutscher Verein 1995.] und der letzten
[Seite der Druckausg.: 66]
größeren Reform 1974 hinauslaufen. Wenig beachtet war die Sozialhilfe bereits 1993 Gegenstand systematischer Einschnitte in das soziale Netz im Zeichen der „Sozialunion in Deutschland" [Fn.5: Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Sozialbericht 1993, Bonn: BMAS (Reihe: Berichte und Dokumentationen).] und der „Verteidigung" des „Standorts Deutschland". Bis 1996 sind die Sozialhilfesätze „gedeckelt" - ohne jeden Bezug auf ein bedarfsbezogenes Existenzminimum. Des weiteren wird schon seit 1992 das Interesse des Finanzministers immer deutlicher erkennbar, die Sozialhilfesätze niedrig zu halten, um die ihm vom Bundesverfassungsgericht aufgezwungene steuerrechtliche Freistellung des Existenzminimums billiger zu machen.
Worum geht es bei der Sozialhilfereform? Die öffentliche Auseinandersetzung ist durchwirkt von Mythen und Voreinstellungen.
[Fn.6: Vgl. Stephan Leibfried/Lutz Leisering, Sozialhilfe als Politikum: Mythen, Befunde, Reformen, in: Werner Fricke, Hg., Jahrbuch Arbeit und Technik 1995, Berlin: JHW Dietz Verlag, S. 79-95.]
Daß die Sozialhilfe reformbedürftig sei, gilt als ausgemacht. Aber wo liegen die eigentlichen Probleme und wo nicht?
1. Warum überhaupt Sozialhilfereform?
Die Masse der Sozialhilfeausgaben, nämlich 31 Mrd. DM von 49 Mrd. DM (1993), entfällt auf die „Hilfe in besonderen Lebenslagen", vor allem auf Pflegebedürftige (16 Mrd.) und Behinderte (11 Mrd.), die meist in Anstalten leben. Hier sind „Mißbrauch", „Arbeitsscheu" und mangelnder Lohnabstand kein Thema. Die ganze Diskussion bezieht sich vielmehr nur auf die „Hilfe zum Lebensunterhalt", auf monatliche Unterhalts- und Mietzahlungen an Personen außerhalb von Anstalten, deren Einkommen unter dem Existenzminimum liegt. Hierauf entfallen 16 Mrd. DM. Zum Vergleich: Allein die Familienzuschläge in der Beamtenversorgung oder die Leistungen an Kriegsopfer erreichen eine ähnliche Größenordnung (13 bzw. 15 Mrd. DM), ohne daß irgend jemand darüber ein Wort verliert. Von Zahngold ganz zu schweigen.
[Seite der Druckausg.: 67/68]
|
Eckpunkte der Seehoferschen Novellierung des Sozialhilferechts:
|
[Seite der Druckausg.: 68 (Fortsetzung)]
Innerhalb der Hilfe zum Lebensunterhalt ist die Mehrzahl der Empfänger nicht arbeitsfähig oder soll nach allgemein anerkannten Maßstäben nicht arbeiten: 35% sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, 6% haben das Rentenalter erreicht oder überschritten und etwas weniger als 18% sind alleinerziehend (1992). Auch ihnen gegenüber greift die gängige Kritik nicht.
Bleiben die Arbeitsfähigen. Nur bei etwa einem Drittel der Empfänger ist Arbeitslosigkeit Hauptursache des Bezugs. Unsere Bremer Langzeitstudie zeigt wider alle Erwartung: Gerade diese Empfänger verlassen die Sozial-
[Seite der Druckausg.: 69]
hilfe besonders schnell,
[Fn.7: Vgl. Stephan Leibfried/Lutz Leiserung, Das neue Bild der Armut, in: DIE ZEIT vom 18. November 1994, Nr. 47, S. 33.]
noch schneller als der Durchschnitt der Empfänger.
[Fn.8: Vgl. Petra Buhr, Dynamik von Armut. Dauer und biographische Bedeutung von Sozialhilfe, Opladen: Westdeutscher Verlag 1995; dies.. Wie wirksam ist Sozialhilfe? Dauer und biographische Bedeutung von Sozialhilfe, in: Barbara Ridemüller/ Thomas Olk, Hg., 1995, Grenzen des Sozialversicherungsstaates, Opladen: Westdeutscher Verlag 1995, S. 219-247 (Leviathan Sonderheft Nr. 14).]
Nur Arbeitslose mit Mehrfachbelastung etwa durch Krankheit oder familiäre Probleme bleiben häufig länger in der Sozialhilfe. Sie aber brauchen vor allem mehr Hilfe, um wieder arbeiten zu können.
Wo liegen also die Probleme? In der politischen Diskussion werden neben dem Ausgabenanstieg vor allem negative Auswirkungen der Sozialhilfe auf den Arbeitsmarkt genannt, womit der Vorwurf eines „Mißbrauchs" von Leistungen verbunden wird. Auch hier zeigen Langzeitstudien für Deutschland wie für die USA: Sozialhilfebezug macht in aller Regel nicht „abhängig". Würden aber Leistungskürzungen und verschärfte Anspruchskontrollen nicht doch dazu führen, daß die Betroffenen schneller von Sozialhilfe unabhängig werden? Die USA zeigen: Selbst ein nach unseren Maßstäben barbarisches Sozialhilfesystem kann zu längeren, nicht kürzeren Bezugsdauern führen [Fn.9: Vgl. Greg J. Duncan/WoIfgang Voges/Richard Häuser/Björn Gustafsson, sowie Stephen Jenkins/Hans Messinger/Brian NoIan/Jean-Claude Ray/Günther Schmaus, Armuts- und Sozialhilfedynamiken in Europa und Nordamerika, in: Zeitschrift für Sozialreform 1994. Jg. 40, Nr. 5, S. 281-313.] - fast ausschließlich Alleinerziehenden, auch bei uns eher Langzeitbezieher, wird dort durch Sozialhilfe (AFDC) von Bundes wegen geholfen, bei zudem weit intensiverem Familienzerfall. Auch Leistungsmißbrauch dürfte eher begrenzt sein, erreicht jedenfalls bei weitem nicht den Umfang von Steuerhinterziehung. Im Gegenteil: Die Sozialhilfe ist als „Hängematte" so unattraktiv, daß 30% bis 50% an sich Hilfeberechtigter die Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Klaus Kortmann von Infratest hat gezeigt: Selbst unter sehr restriktiven Annahmen müßte etwa 30% mehr als bisher allein für alte Sozialhilfeempfänger ausgegeben werden, wenn alle Alten ihre Ansprüche geltend machten. [Fn.10: Klaus Kortmann, Kleinrenten, Niedrigeinkommen und Sozialhilfebedarf im Alter, in: Deutsche Rentenversicherung 1992, S. 337-362.]
[Seite der Druckausg.: 70]
Also Entwarnung? Nur bedingt. Vor allem zwei Entwicklungen verweisen auf Probleme, die nicht nur ein Randsystem des Sozialstaats betreffen, sondern grundlegende gesellschaftliche Ordnungen und Werte berühren:
der Anstieg der Ausgaben der Sozialhilfe und die Zunahme der Hilfeempfänger.
Die rasante Ausgabendynamik, weniger die absolute Höhe der Ausgaben, wirft Probleme für den Sozialstaat auf. Kostenexplosionen begleiten den Sozialstaat seit seinen Anfängen, aber die Sozialhilfe zählt seit den siebziger Jahren zu den besonders stark wachsenden Bereichen. Der Anteil am Sozialbudget ist von 2% 1970 auf 4,5% 1993 gestiegen. Da die Sozialhilfe aber vom Bund gesetzlich geregelt und von Kommunen und Ländern finanziert wird, gerät die föderale Rollenverteilung im Sozialstaat so aus dem Gleichgewicht. Zuletzt haben Oskar Lafontaine und dann Rudolf Scharping daher gefordert, die Sozialhilfekosten teilweise dem Bund zu übertragen; früher hat dies schon der seinerzeitige Ministerpräsident von Niedersachsen Albrecht getan.
Wenn sich die Sozialhilfeempfänger seit 1970 vervierfacht haben (von 1,2% der Bevölkerung auf 4,8% im Jahre 1993), so zeigt das an, daß sich an den Lebensverhältnissen in Deutschland etwas verändert hat. Die Fähigkeit, eigenständig das Dasein zu sichern, ist vermindert, und zwar nicht nur bei Randgruppen, sondern auch bei sozial unauffälligen Mitbürgern, die ehedem als gesichert galten, aber vorübergehend oder mehrfach Sozialhilfe beziehen oder in Armut abrutschen. Diese „soziale Entgrenzung" von Armut konnte in Untersuchungen des Wissenschaftszentrums Berlin (Bruce Heady/Roland Habich/Peter Krause) [Fn.11: The Duration and Extent of Poverty - Is Germany a Two-Thirds-Society? Berlin: Wissenschaftszentrum 1990 (WZB-Working Paper P 90-103).] und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (Peter Krause) [Fn.12: S. Fußnote 11.] nachgewiesen werden, wonach immerhin ein Drittel aller Einwohner Deutschlands im Laufe von neun Jahren jedenfalls in einem Jahr unter der Armutsgrenze (50% des Durchschnittseinkommens, 1992 etwa 1.250 DM für eine alleinstehende Person [Fn.13: Für eine vierköpfige Familie liegt diese Grenze bei etwa 2.500 DM netto (und zwar für 1990); vgl. Peter Krause, Armut im Wohlstand: Betroffenheit und Folgen, Berlin: Deutsches Wirtschaftsinstitut 1994, S. 5 (Diskussionspapier Nr. 88).] )lagen.
[Seite der Druckausg.: 71]
Nicht die Sozialhilfe selbst ist also das Problem. In ihr spiegeln sich vielmehr gesellschaftliche Probleme, der Wandel der Lebensverhältnisse in Deutschland. Armut ist ein Seismograph. Sie ist, wie bereits der Soziologe Georg Simmel im Jahre 1908 feststellte, ein „Sammelbecken", in dem sich Verwerfungen und soziale Gebrechen der ganzen Gesellschaft niederschlagen. Wesentlich ist die anhaltende Massenarbeitslosigkeit. Aber SPD und Gewerkschaften unterschätzen das Problem, wenn sie Armut und Sozialhilfebezug allein auf Unterbeschäftigung zurückführen. In der tagespolitischen Diskussion wird der tiefgreifende gesellschaftliche Wandel verdeckt, der sich in mindestens vier Bereichen vollzieht und neue Antworten auf Fragen des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft erheischt: Arbeitslosigkeit verweist auf die Erschütterung der Arbeitsgesellschaft seit den siebziger Jahren und den heutigen weltwirtschaftlichen Strukturwandel; die Alleinerziehenden in der Sozialhilfe spiegeln den Wandel der Familie seit den sechziger Jahren; die wachsende Armut von Kindern, aber auch Pflegebedürftigkeit im Alter machen es dringlich, den Vertrag zwischen den Generationen neu zu fassen; und der seit den achtziger Jahren auf ein Drittel gestiegene Anteil von Zuwanderern und seit langem in Deutschland lebenden Ausländern in der Sozialhilfe zwingt dazu, das ursprünglich nationalstaatliche Projekt Sozialstaat auf eine multikulturelle Gesellschaft und internationale Bevölkerungsbewegungen einzurichten.
Es ist also nicht damit getan, vermeintliche oder tatsächliche Mißstände in der Sozialhilfe zu beheben. Gefragt ist eine Neubestimmung von Sozialstaatlichkeit in einem kritischen Kernbereich, eben bei der Sicherung eines zivilisatorischen Minimums. Für die aktuelle Reformdebatte zur Sozialhilfe ergeben sich drei Leitlinien für einen wirklichen „Umbau" des Sozialstaats: keine Sozialhilfereform ohne Sozialreform; nicht fordern, ohne zu fördern; keine Mindestsicherung ohne Maßstab.
2. Keine Sozialhilfereform ohne Sozialreform
Nur die Sozialhilfe umzugestalten kuriert an Symptomen. Als unterstes Netz im System sozialer Sicherung spiegelt die Sozialhilfe immer auch ein Versagen vorgeordneter Sicherungssysteme. Dies zeigt schon die Sozialhilfestatistik, die aufführt, warum die Betroffenen hilfebedürftig geworden sind und welche anderen Sozialleistungen bezogen werden, die nicht aus-
[Seite der Druckausg.: 72]
reichen, um das Existenzminimum zu sichern. Vor allem die Leistungen für Arbeitslose sind seit den frühen achtziger Jahren in mehreren „Haushaltsstrukturgesetzen" wiederholt zurückgefahren worden - zuletzt 1993 von 68% (für Familien; 63% für Sonstige) auf 67% (bzw. 60%) des Lohnes beim Arbeitslosengeld und von 58% (56%) auf 57% (bzw. 53%) bei der Arbeitslosenhilfe. So wird künstlich Sozialhilfebedürftigkeit geschaffen. Einige Gruppen sind gar nicht mehr anspruchsberechtigt - so jetzt auch, wenn der Regierungsvorschlag Gesetz wird, die Arbeitslosenhilfe auf zwei Jahre zu begrenzen.
Noch schwerer wiegen aber konstruktionsbedingte Mängel der Sozialversicherung und anderer vorgeordneter Systeme: In Deutschland gibt es, anders als in den meisten skandinavischen Ländern, keine Mindestleistungen in der Sozialversicherung, also keine Mindestrente und auch keine Leistungen für Arbeitslose, die in jedem Fall das Existenzminimum sichern. Würde dies geändert, also eine Sozialreform statt einer bloßen Sozialhilfereform eingeleitet, so wäre die Sozialhilfe schlagartig entvölkert: Ein gutes Drittel der Hilfeempfänger brauchte nicht mehr zum Sozialamt zu gehen, wenn alle Arbeitslosen ein Recht auf bedarfsdeckende Leistungen aus Nürnberg hätten; schwer vermittelbare Personen bedürften allerdings weiterhin besonderer Förderungsmaßnahmen und sozialpädagogischer Hilfen. Wenn das Kindergeld, etwa für Arme, so erhöht würde, daß es den Mindestbedarf von Kindern abdeckte, wäre ein weiteres knappes Viertel nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen, zumindest könnten alleinstehende Müttern durch Lohnarbeit den Hilfebezug verlassen. Weitere 6% würden durch eine Mindestrente aus der Sozialhilfe herausfallen. Die Sozialhilfe verlöre bis zu zwei Drittel ihrer Klientel, von 2,4 Mio. blieben weniger als 1 Mio. Empfänger in der Hilfe zum Lebensunterhalt (Zahlen von 1993). Weitere Maßnahmen wie höheres Wohngeld und verbesserte Unterhaltsvorschüsse für Geschiedene und deren Kinder sind hier nicht einmal mitgerechnet. Zugleich entfiele weitgehend die „verschämte Armut", also die Dunkelziffer der Sozialhilfe.
Ein solches Reformkonzept hat zuletzt der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Richard Hauser vorgeschlagen. Es wäre zu ergänzen um gezielte Maßnahmen für besondere soziale Problemgruppen wie Obdachlose, Überschuldete und Ausländer. Hauser spricht von einer „integrierten
[Seite der Druckausg.: 73]
Armuts- und Sozialpolitik" [Fn.14: Vgl. Richard Hauser, Armut im Sozialstaat als Problem einer Theorie der integrierten Sozial- und Verteilungspolitik, in: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik, Bd. 1: Ausgewählte Probleme und Lösungsansätze (Hg. von Richard Häuser/Uwe Hochmuth/Johannes Schwarze), Berlin: Akademie Verlag 1994, S. 291-335. Ähnlich gelagerte Überlegungen finden sich bei Frank Nullmeier/Friedbert W. Rüb, Die Transformation der Sozialpolitik. Vom Sozialstaat zum Sicherungsstaat, Frankfurt a.M.: Campus 1993 (Theorie und Gesellschaft, Bd. 28).] , da die meisten Armen in die „normale" soziale Sicherung einbezogen würden statt in ein randständiges System, die Sozialhilfe, abgeschoben zu werden. Nur wirklich atypische Einzelfälle und Personen, die besonderer Hilfen bedürfen, blieben in der Sozialhilfe. Damit würde der „sozialen Entgrenzung" Rechnung getragen, also der Tatsache, daß über traditionelle Randgruppen hinaus auch Angehörige mittlerer Schichten heute zeitweise von Armut betroffen sein können.
Ist eine integrierte Armuts- und Sozialpolitik eine Utopie? Wie der derzeit - in der Regie von Finanzminister Theo Waigel - stattfindende Einbau des Existenzminimums in die Einkommenssteuer zeigt, ist sie teilweise schon Praxis. Fiskalisch kann sich ein solches Modell durchaus rechnen. Erforderlich wäre allerdings ein Finanzausgleich, da die Kommunen massiv Geld sparen, die Mehrausgaben aber bei Sozialversicherungsträgern und Bund anfallen würden. Ist das Modell ordnungspolitisch konsensfähig? Schließlich wurden Mindestleistungselemente („Sockelung") von Politikern, aber auch etwa vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, bis heute regelmäßig zurückgewiesen - unter Beschwörung des „gegliederten Systems sozialer Sicherung". Beispielsweise müßten Renten, so die Vorstellung, leistungs-, also lohnbezogen sein; Mindestleistungen, die jeder ohne Vorleistungen beanspruchen kann, gehörten in die Fürsorge bzw. die Sozialhilfe. Da eine Sockelung aber nur eine Minderheit der Sozialversicherten beträfe und zudem durch den Staat oder durch Dritte finanziert werden könnte, müßte das gegliederte System im Kern nicht aufgegeben werden.
Aktuelle Bonner Ansätze, wie den, das Kindergeld wesentlich zu erhöhen, verweisen bereits auf eine solche integrierte Politik. Auch die (bis 1996 befristeten) „Sozialzuschläge" für Ostdeutsche in der Rentenversicherung, bis 1995 auch in der Arbeitslosenversicherung (für Neuanträge bis 1992), zeigen: Abweichungen von den Dogmen des mittelschichtzentrierten deut-
[Seite der Druckausg.: 74]
schen Sozialstaats sind möglich, wenn ein politischer Wille und ein Handlungsdruck vorhanden ist. Da die integrierte Armuts- und Sozialpolitik alles in allem an vorhandene Ordnungsvorstellungen und Maßnahmen anknüpft, scheint sie höhere Durchsetzungschancen zu haben als die Idee einer allgemeinen Grundsicherung, die von kritischen Wissenschaftlern und Sozialpädagogen favorisiert wird - aber auch von der FDP, wenn auch als Sozialstaatsersatz. Anhand des breiten Maßnahmenspektrums einer integrierten Armutspolitik kann Armut zudem wirksamer und zielgenauer bekämpft werden als mit einem einheitlichen System sozialer Grundsicherung.
Die Politik könnte schließlich Arme noch stärker in höhere Stockwerke des Sozialstaats integrieren, wenn der Arbeits- und Leistungsbegriff, der bislang der Sozialversicherung zugrunde liegt, erweitert würde. Nicht nur Erwerbsarbeit, sondern auch Haus-, Pflege- und Erziehungstätigkeit könnten durch Leistungsansprüche stärker prämiert werden, die über Mindestleistungen hinausführen. Auch hier gibt es schon bescheidene Ansätze in der heutigen Sozialpolitik, etwa die Nicht-Anrechnung des Erziehungsgeldes in der Sozialhilfe oder die Babyjahre in der Rentenversicherung. Ein erweiterter Leistungsbegriff könnte wahrscheinlich in dem ohnedies stattfindenden Wandel der Wertvorstellungen, die vor allem die Rolle der Frau in der Gesellschaft betreffen, gut verankert werden.
3. Nicht fordern ohne zu fördern
[Fn.15: Vgl. dazu erneut Bane/Ellwood (1994, S. 143) - s.o. Fußnote 1.]
Würde die Sozialhilfe durch eine umfassende Sozialreform weitgehend entlastet, wären weiterhin Hilfen in besonderen Problemlagen angebracht, die durch standardisierte Leistungen in vorgeordneten Systemen nicht angemessen bearbeitet werden: Neben einer Sozialreform bleibt die Sozialhilfe als „Dienstleistungsunternehmen" selbst reformbedürftig. In der von Seehofer geprägten Reformdebatte geht es darum, die Hilfeempfänger zu aktivieren, von Sozialamtszahlungen unabhängig zu werden. Der Druck, eine Arbeit aufzunehmen, soll verstärkt werden.
[Seite der Druckausg.: 75]
Eine Mobilisierung der Betroffenen - bezogen auf die arbeitsfähige Minderheit unter den Hilfebeziehern - entspricht der Programmatik des Bundessozialhilfegesetzes. Aber wie soll eine solche Aktivierung erreicht werden?
Wohl kaum durch Zwangsmaßnahmen und Drohung mit der Kürzungspeitsche. Im Gegenteil: Wer fordern will, muß auch fördern. Fördern, damit die übergroße Mehrheit der Arbeitswilligen überhaupt in die Lage versetzt wird, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Mehr Leute aus der Sozialhilfe herauszubringen, kostet etwas. Die Vorstellung, die Anzahl der Hilfebezieher zu verringern und zugleich durch Leistungskürzung zu sparen, mag für Politiker verführerisch sein, erfolgversprechend ist sie nicht. Seehofers Vorschläge enthalten Förderungsansätze. Nicht von ungefähr sieht der Deutsche Städtetag in der in Aussicht genommenen Ausweitung der Beschäftigungsförderung eine neue Kostenlawine auf die kommunalen Gebietskörperschaften zukommen.
Ansätze, die Sozialämter in aktive und aktivierende Dienstleistungszentren umzuwandeln, gibt es bereits in der Praxis. Die Informationen für Hilfesuchende durch die Sozialämter sind als unzulänglich erkannt, auch Beratung wäre auszubauen - für beide Aufgaben finden die unterbesetzten Ämter nach Aussagen von Mitarbeitern jedoch nicht genug Zeit. Auch wären Qualifikations- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auszubauen, wie in Bremen, Hamburg oder Frankfurt mit Erfolg geschehen. Dann ist die traditionelle „Hilfe zur Arbeit" der Sozialämter stärker mit Maßnahmen der Arbeitsverwaltung zu verzahnen. Aber Arbeit ist nicht alles: Auch Hilfen bei Wohnungssuche und Kinderbetreuung wären wichtig, um Wege aus der Sozialhilfe zu unterstützen. In kaum einem anderen Land wird so wenig getan, um Erwerbsarbeit und Familienarbeit vereinbar zu machen, wie in Deutschland.
Derartige Maßnahmen setzt allerdings auch voraus, daß die Sozialämter hinreichende Informationen haben, um ihren Klienten zielgerichtet und im Einzelfall helfen zu können. Bislang haben sie nicht einmal einen Überblick über die Qualifikation all derer, denen sie bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß helfen wollen. Armut und Sozialhilfe sind Stiefkinder der Sozialberichterstattung. Es gibt Familienberichte, Jugendberichte, Gesundheitsberichte und Bildungsberichte, aber bis heute keinen nationalen Armutsbericht. Immerhin gibt es seit den achtziger Jahren
[Seite der Druckausg.: 76]
zahlreiche kommunale Armutsberichte und seit 1994 eine reformierte Sozialhilfestatistik, mit ersten Ergebnissen ab 1996.
[Fn.16: Marin Beck/Hermann Seewald, Zur Reform der amtlichen Sozialhilfestatistik, in:Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 1994, Jg. 74, Nr. 1, S. 27-31.]
In den Kinderschuhen steckt auch die in anderen Behörden und Ressorts längst selbstverständliche Wirkungskontrolle politischer Maßnahmen. Die Sozialhilfeverwaltung weiß wenig darüber, bei welchen Adressaten ihre Beratung und Arbeitsförderung erfolgreich ist und bei welchen nicht - und warum.
So wurde in der Bremer Langzeitstudie erkennbar: Diejenigen, die Hilfe am meisten brauchen - nämlich verfestigte Langzeitbezieher mit mehrfacher Benachteiligung in verschiedenen Lebensbereichen - erfahren paradoxerweise am wenigsten Unterstützung.17 Sie werden allzu leicht von Mitarbeitern im Sozialamt und Arbeitsamt als hoffnungslose Fälle abgeschrieben. Ein Betroffener aus Bremen berichtet: „... an dem Leben hänge ich überhaupt nicht, jedenfalls jetzt nicht mehr, seit das alles so schief läuft. Ich habe auch nichts, was habe ich zu erwarten: arbeitslos sein, kein Geld haben, keine Freundin oder Frau und weiter so rumdrömeln. ... für Behinderte, die 50% schwerbehindert sind, da wird nichts getan. Man hat mir beim Arbeitsamt gesagt, weil ich eine Zeit so einmal die Woche hingefahren bin, man hat mir gesagt: 'Wissen Sie was, kommen Sie einmal im Jahr, das reicht'. Und das ist gesetzlich gar nicht zulässig."
[Fn.18: Für eine ausführliche Analyse von Sozialhilfebiographien vgl. Monika Ludwig, Ar mutskarrieren zwischen sozialem Abstieg und Aufstieg, Opladen: Westdeutscher Verlag (in Vorbereitung).]
Hier ist es mit Geld allein nicht getan. Während für die meisten Bezieher gesicherte Geldleistungen für Unterhalt, Miete und besondere Ausgaben ausreichen, um Selbsthilfe anzustoßen, müssen bei den besonders benachteiligten Fällen medizinische, organisatorische, sozialarbeiterische, psychologische und andere Hilfen hinzutreten.
Verschärftes „Fordern" setzt nicht nur mehr „Fördern" voraus, als Politiker es wahrhaben wollen. Der Spielraum für Forderungen ist auch viel begrenzter als in der Debatte vielfach angenommen wird. Die Mehrzahl der Hilfeempfänger, so Ergebnisse der Bremer Studie, gehen schon heute
[Seite der Druckausg.: 77]
aktiv mit ihrer Situation um. Ausstiege aus der Sozialhilfe nach einer begrenzten Zeit herrschen vor. Kleine Nebeneinkommen - was formell teilweise als „Mißbrauch" angesehen werden könnte - sind zudem vielfach gerade Ausdruck aktiver Lebensbewältigung, also Schritte auf einem Weg, der zügig aus der Sozialhilfe herausführt, was offiziell anerkannt und legalisiert werden sollte. Hierzu finden sich Ansätze im vorliegenden Reformentwurf. Aber die Idee, (Erwerbs-)Einkommen von Hilfebeziehern mehr als bisher nicht auf die Sozialhilfe anzurechnen und so zu einem Ausstieg durch Arbeit zu motivieren, ist folgenreich. Richard Hauser und Max Wingen [Fn.19: Hindernis für „Neujustierung" der Tarifpolitik, in: arbeitgeber 1994, Nr. 24, S. 913-915.] haben gezeigt, daß bei der breiten Schicht unmittelbar oberhalb der Sozialhilfegrenze viele neue Ansprüche entstünden, wenn ein wirklicher Anreiz zur Verbesserung des Haushaltseinkommens gesetzt werden soll. Dabei erscheint jede Einengung solcher ja allgemein begründeter Ausstiegswege auf wenige Sondergruppen, etwa auf Jugendliche, oder in beengende zeitliche Korsetts fragwürdig.
Reformmaulhelden gibt es viele, aber der Reformkorridor in der Sozialhilfe ist schmal. Zynisch könnte man ausrufen: Schön wär's, wenn „Mißbrauch" und „Arbeitsscheu" in der Sozialhilfe so ausgeprägt wären, daß durch deren Bekämpfung die Kostendynamik der Sozialhilfe gestoppt werden könnte - so hat es etwa zuletzt der Deutsche Industrie- und Handelstag nahegelegt. Die „Stihl-Säge" hilft aber mitnichten weiter. Horst Seehofer selbst rechnet nur mit bescheidenen Einsparungen von 1 bis 2 Mrd. DM. Die wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen der Hilfesuchenden werden durch eine Sozialhilfereform nicht behoben, angemessene Hilfemaßnahmen sind eher teurer. Auch von bürokratischen Wasserköpfen, die sonst gern für die Kostendynamik im Sozialstaat mitverantwortlich gemacht werden, ist in der Sozialhilfe weit und breit nichts zu sehen.
4. Keine Mindestsicherung ohne Maßstab
Die Sicherung eines Existenzminimums für alle Bürger erscheint politisch wohlfeil. Alle Parteien sind sich einig, daß niemand unter eine Armutsgrenze fallen darf. Auch bei Einschnitten etwa im Gesundheitsbereich
[Seite der Druckausg.: 78]
wird immer betont, daß die Grundversorgung selbstverständlich gesichert sei. In Konzepten eines systematischen Abbaus des Sozialstaats, etwa dem „Bürgergeld" der FDP oder der Mindestrente bei Kurt Biedenkopf, dient die Sicherung „wirklich Bedürftiger" sogar dazu, Sozialleistungen jenseits von Mindestleistungen abzuschaffen. In jedem Fall gilt ein staatlich verbürgtes Existenzminimum als einfache Lösung.
Der Schein trügt. Denn die Logik von Mindestsicherung ist die Logik des Bedarfs. Bedarfsbezogene Mindestleistungen sind sensibel gegenüber Eingriffen und sie müssen vor allem immer neu „gegen den Strom", aus sich heraus „gesetzt" werden. Sie sind sensibler als Löhne oder Renten, die leistungs- statt bedarfsbezogen sind und in Deutschland meist oberhalb eines Existenzminimums liegen und die sich zudem aus in der Zeit sehr stabilen (Renten-)Formeln ableiten lassen. Bei Mindestleistungen haben Kürzungen nicht allein relative Wohlfahrtseinbußen zur Folge. Vielmehr können sie dazu führen, daß Leistungsempfänger in wesentlichen Bereichen daran gehindert werden, am normalen gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Es ist daher unerläßlich, stabile Maßstäbe für Minima zu entwickeln. Eine Mindestsicherung, die ihren Maßstab nicht nennt, nicht in verbindlichen Wertvorstellungen verankert und nicht auf Dauer stellt, ist keine Mindestsicherung, sondern ein politisches Feigenblatt.
Die Geschichte der Sozialhilfe und ihrer Vorläufer ist auch eine Geschichte des Kampfes um einen solchen Maßstab, [Fn.20: Zur Geschichte dieser Auseinandersetzung vgl. Stephan Leibfried, Nutritional Minima and the State. On the Institutionalization of Professional Knowledge in National Social Policy in the U.S. and Germany, Bremen: Zentrum für Sozialpolitik, Arbeitspapier Nr. 10/92, 57 S. Hier findet sich eine ausführliche Bibliographie.] ein Kampf, ihn zu sichern vor der Willkür von Sozialverwaltung und Politik, gegenüber den Begehrlichkeiten von Stadtkämmerern und Finanzministern, aber auch egoistischer Bürger. Mehrere Aufgaben sind zu lösen: Es müssen Kriterien für eine Grundnorm festgelegt werden, die die Höhe des Minimums bestimmt, etwa als Warenkorb oder als Statistik-Modell, [Fn.21: Der Referentenentwurf spricht insoweit von einem „statistischen Verfahren". Zur Begründung der Verzögerung bis 1999 heißt es: „Die erste gesamtdeutsche EVS von 1993 wird aber erst für die Regelsatzfestsetzung ab 1. Juli 1999 ausgewertet zur Verfügung stehen" (Begründung S. 23). Diese Begründung mag in sich zutreffen. Allein, ein schlüssiges „statistisches Verfahren" bis dahin sollte entweder an das Statistik-Modell, wie es 1993 galt, also an die EVS 1983, 1996 wieder anknüpfen. Oder es sollte sobald als möglich auf der EVS 1988 aufbauen, auch wenn diese nicht gesamtdeutsch ist. Der so gewonnene Maßstab wäre in jedem Falle „bedarfsnäher" und weit „treffgenauer" (s. S. 27) als eine ausschließliche Steuerung über nicht bedarfskongruente Anpassungsnormen, die von 1993 bis 1999 durchgehend zur Anwendung kämen, Im Zweifel wird diese Anpassungsserie 1999 ein reformiertes Statistik-Modell bewirken, welches das dann vorgefundene Regelsatzniveau als „Geschäftsgrundlage" schlicht übernimmt.] ein solches Modell ist in
[Seite der Druckausg.: 79]
regelmäßigen Abständen (etwa alle 5-7 Jahre) fortzuentwickeln, weil ihm sonst die gesellschaftliche Entwicklung davonläuft; in den „Zwischenjahren" ist es anhand eines weiteren Maßes - analog zur „dynamischen Rente" - anzupassen; [Fn.22: Im Referentenentwurf wird dies „Fortschreibungsmodus" genannt (s. S. 7).] und schließlich sind relativ unabhängige Stellen damit zu beauftragen, diese Maßgaben zu entwickeln und umzusetzen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte 1954 erstmals einen Rechtsanspruch auf Fürsorge. Das Bundessozialhilfegesetz von 1962, der letzte Ausläufer jener Sozialreform, die 1957 in der großen Rentenreform ihren Höhepunkt gefunden hatte, schaffte einen standardisierten und bundesweit einheitlichen Warenkorb als Maßstab für das „soziokulturelle Existenzminimum", verwaltet durch den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.
Der Warenkorb wurde 1990 durch das „Statistikmodell" abgelöst, das sich nur am faktischen Konsumverhalten unterer Schichten orientiert. Seit 1993 ist es bis 1996 aufgehoben, wir befinden uns also gänzlich in maßstabloser Zeit. Im einschlägigen Haushaltsstrukturgesetz, dem „Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms" (FKPG), wurde nicht einmal rhetorisch beansprucht, daß ein irgendwie begründeter Bedarf gedeckt würde; es wurde nur pauschal gedeckelt mit der Folge, daß das Existenzminimum 1996 mehr als 5% niedriger liegen wird als es ohne diesen Eingriff liegen würde.
[Fn.23: Der Referentenentwurf benennt auch die Wirkungen dieser Deckelung: „Dabei ist davon auszugehen, daß ein Prozent Regelsatzsteigerung zusätzliche Kosten im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Höhe von 150 bis 200 Millionen DM verursacht ..." (S. 11 der Begründung). Damit wären bei -5% 1993-1996 Spareffekte von etwa 1 Milliarde DM erzielt worden.]
Das wirkt nicht als einmalige Sonderstreichung, sondern als dauerhafter „Solidaritätsabschlag", als bleibende Verformung der Grundnorm selbst. Schon seit den achtziger Jahren sind die Sozialhilfesätze hinter dem Anstieg der verfügbaren Haushaltseinkommen in der Gesamtbevölkerung zurückgeblieben (vgl. Schaubild).
[Seite der Druckausg.: 80]
Die gängige Behauptung des Gegenteils kann sich nur auf Vergleichsgrößen wie Lohn- und Rentenentwicklung berufen. Diese sind jedoch als Maßstäbe ungeeignet, da Erwerbstätige bzw. Alte neben Löhnen und Renten in der Regel noch weitere Einkommen beziehen, während Sozialhilfeempfänger nicht mehr als das Sozialhilfeniveau haben.
Deshalb ist auch die Diskussion über den angeblich gefährdeten Lohnabstand der Sozialhilfe heiße Luft: Es werden Äpfel mit Birnen verglichen, nämlich Haushaltsgesamteinkommen von Sozialhilfeempfängern, eben die Sozialhilfe, mit Teileinkommen von Erwerbstätigenhaushalten, nämlich
[Seite der Druckausg.: 81]
dem Lohn des Ernährers.
[Fn.24: Wie die Begründung zum Referentenentwurf erkennen läßt, ist die Größe von 15% durchaus politisch strategisch gewählt: „Der zugrunde gelegte prozentuale Abstand von 15% ist erreichbar, wenn die geplante Neuregelung des Familienlastenausgleichs so erfolgt, wie dies von den Koalitionsfraktionen beschlossen wurde und zugleich die steuerliche Freistellung des Existenzminimums entsprechend den Vorstellungen der Bundesregierung im Jahressteuergesetz 1996 durchgeführt wird. Davon wird ausgegangen." (S. 25) Auf Dauer recht komplexe Voraussetzungen für die Festschreibung einer konkreten Prozentzahl, die erst 1999 voll greifen soll.]
Wie in einer Auftragsstudie des Bonner Familienmisteriums noch 1994 gezeigt wurde, kollidiert die Sozialhilfe zudem nur in den wenigen Fällen kinderreicher Familien mit den Löhnen;
[Fn.25: Vgl. Wilhelm Breuer/Dietrich Engels, Bericht und Gutachten zum Lohnabstandsgebot, Stuttgart usf.: Kohlhammer 1994 (Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie und Senioren, Bd. 29).]
das verweist eher auf ein Versagen der Familienpolitik. Bei Alleinstehenden wird das Lohnabstandsgebot ohnehin nicht verletzt.
Die von Seehofer für 1996 bis 1999 ins Auge gefaßte Kopplung der Sozialhilfesätze an die Nettolöhne klingt zunächst nur recht und billig. Warum sollten Sozialhilfebezieher besser gestellt werden als Arbeiter und Angestellte? Übersehen wird dabei wieder, daß Löhne als Maßstab für Mindestbedarfe ungeeignet sind. Wenn etwa die Lebensverhältnisse auch in Zukunft zunehmend durch Doppelverdiener im Haushalt geprägt werden, so führt eine Orientierung des Sozialhilfesatzes an Einzellöhnen die Hilfebezieher immer mehr ins soziale Abseits. Die Bedarfslogik der Sozialhilfe verbietet es, sie mit anderen Sozialleistungen oder mit Löhnen unmittelbar zu parallelisieren.
[Fn.26: In der Sozialhilfenovelle Seehofers kumulieren zwei Prozesse: eine Verunsicherung der Grundnorm (Statistik-Modell seit 1993 suspendiert; reformierter Anschluß nun für 1999 verheißen) und eine zum Bedarfsprinzip nicht passende Anpassungsnorm (praktisch von 1993 bis 1996 anzuwenden). Bei einer an sich stabilen Grundnorm ließe sich über Zwischen- und Notlösungen bei Anpassungsnormen reden. Wenn aber beide Größen fließend gemacht werden, ist in den Fundamenten der Sozialhilfe kein Halten mehr.
In früheren Eingriffen in das Bedarfsprinzip der Sozialhilfe, etwa im 2. Haushalts strukturgesetz von 1981 (BGB1.1, S. 1523) unter Helmut Schmidt, wurden bedarfs widrige Anpassungsnormen nur für kürzere Zeiträume (1982 bis Mitte 1985) ver wendet. Ferner wurde im Anschluß daran, die alte Norm tendenziell wieder voll angewandt, was einem erheblichen Nachholbedarf Raum gab. Einem ähnlichen Pro zeß soll aber gerade, so scheint es, für 1996 wie für 1999 vorgebeugt werden.]
Da dann also von 1993 bis 1999 die Sozialhilfe nicht bedarfsbezogen angepaßt werden sollte, könnten - vergli-
[Seite der Druckausg.: 82]
chen mit dem Statistik-Modell 1992 - dauerhafte Wohlfahrtsverluste von etwa 5% (1993-96) und mehr (1996-99) eintreten: jedenfalls, eine verewigte Niveausenkung für die Armen im Kontrast zu dem befristeten „Solidaritätszuschlag" für die anderen. Soziale Symmetrie? Dadurch könnte zudem 1999 die noch gültige Grundnorm, das Statistik-Modell, bei hinreichendem Verlustniveau (10%?) in die Krise geraten: es wird entweder so umgebogen, daß es die 10% Minus schluckt; oder es wird als unrealistisch verworfen, dann wird aus dem Diktat der Anpassungsnorm, der Deckelungsserie 1993 bis 1999, die neue Grundnorm der Sozialhilfe. So könnten auch Maßstäbe „kaputtgespart" werden.
Zwar gibt es keinen einzig richtigen, wissenschaftlich bestimmbaren Maßstab für das soziokulturelle Existenzminimum. Der Maßstab ist aber auch nicht beliebig. Er kann nur in einem gesellschaftlichen Willensbildungsprozeß gewonnen werden, bei dem auf gesichertes Wissen über die Lebensverhältnisse am Rande der Gesellschaft und die Voraussetzungen gesellschaftlicher Teilhabe zurückgegriffen wird. Könnte nicht ein neu zu bildender Sachverständigenrat eine solche Aufgabe dauerhaft übernehmen, verbunden mit einem längst überfälligen regelmäßigen nationalen Armutsbericht? Für die Wirtschaft haben wir Fünf Weise, während die Sozialpolitik verwaist ist, keine unabhängige Dauerberichterstattung kennt - wohl aber viele regierungsinterne Kommissionen. Ohne eine unabhängige Instanz könnte die von kritischer Seite seit langem geforderte Festlegung des Regelsatzes auf Gesetzesebene zum Bumerang werden und eine finanz- wie steuerpolitische Indienstnahme festschreiben.
Würde man die Steigerung der Hilfesätze an die Renten und damit an die Nettolöhne koppeln, schüfe dies zwar eine gewisse Sicherheit, würde aber gleichfalls die Bedarfslogik aushöhlen. Denn die Alterung der Bevölkerung wird relative Rentensenkungen erzwingen, die in Zeiten wachsender Rentenansprüche von Frauen und Männern für die meisten Rentner auch verkraftbar wären, aber nicht schadlos auf Mindestleistungen übertragen werden könnten. Wenn die Beiträge zu Renten- und Krankenversicherung steigen, wird auch die Nettolohnentwicklung als Maßstab für Mindestbedarfe unbrauchbar.
[Seite der Druckausg.: 83]
5. Ein sozialstaatliches Minimum ist nicht wohlfeil
Die Sicherung eines Minimums für alle ist nicht wohlfeil. Zusammenfassend: Ohne eine über die Sozialhilfe hinausgreifende Sozialreform, ohne Ausbau effektiver Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Sozialhilfe, ohne Institutionalisierung eines verbindlichen Maßstabs für die zu erbringenden Leistungen - ohne ein solches Bündel von Maßnahmen ist ein soziales Minimum nicht zu haben, das seinen Namen verdient. Einfache Rezepte, mit denen nur „Mißbrauch" und „Arbeitsscheu" bekämpft werden soll, greifen zu kurz - so wie die Zauberformel „garantiertes Grundeinkommen" über die anstehenden Schwierigkeiten hinwegfliegt. Für die Grundsicherungsfraktion in FDP und CDU folgt: Die Probleme der Expansivität des Sozialstaats verflüchtigen sich keineswegs, wenn man ihn auf eine Mindestsicherung reduziert.
Die Reform der Fürsorge 1962 hat uns ein Leistungssystem, die Sozialhilfe, beschert, die im internationalen Vergleich gut dasteht. Kaum ein Mindestsystem in anderen Ländern deckt so viele Bedarfslagen ab, und nur wenige gewähren ähnlich hohe Leistungen. Nachdem mit der Rentenreform '92 und der Einführung der Pflegeversicherung die deutsche Sozialversicherung ansatzweise konsolidiert und auf neue Herausforderungen vorbereitet worden ist, sollte nun auch in der Armutsbekämpfung die Sozialreform der frühen sechziger Jahre fortgeführt und neuen gesellschaftlichen Entwicklungen angepaßt werden. Es geht darum, fort- und nicht rückzuentwickeln.
Das rasante Wachstum der Sozialhilfeausgaben und der Anzahl der Leistungsempfänger ist nur ein Vorbote tiefgreifenderer Probleme der Sicherung eines sozialen Minimums. Ist schon eine Mindestsicherung des Lebensunterhalts nicht wohlfeil, so sind andere Grundbedürfnisse, vor allem gesundheitlicher Art, noch schwieriger zu sichern. Auch solche Bedürfnisse sind gemeint, wenn aus dem Grundgesetz das Recht auf ein menschenwürdiges Lebens abgeleitet wird. Wie schwer eine Grundversorgung außerhalb des Einkommensbereichs zu sichern ist, zeigt sich bereits in den öffentlich weniger strittigen „Hilfen in besonderen Lebenslagen" der Sozialhilfe. Auf sie entfallen nicht nur weit mehr Ausgaben als auf die viel diskutierte „Hilfe zum Lebensunterhalt". Auch die Kosten pro Leistungsfall steigen wesentlich schneller - weil Dienstleistungen im Heim- und
[Seite der Druckausg.: 84]
Pflegebereich überproportional teurer werden. Nicht von ungefähr bricht die neue Pflegeversicherung mit dem Grundsatz voller Risikoabdeckung, der bislang in allen Zweigen der Sozialversicherung galt: Während Renten als Lohnersatz angelegt sind und die Leistungen der Krankenversicherung grundsätzlich nach den medizinischen Möglichkeiten bemessen werden, zielt die Pflegeversicherung ausdrücklich nur darauf, Teile des Pflegerisikos abzusichern, macht Leistungen damit von vornherein von den verfügbaren Mitteln abhängig („Budgetprinzip"). [Fn.27: Heinz Rothgang, Die Einführung der Pflegeversicherung - Ist das Sozialversicherungsprinzip am Ende?, in: Riedmüller/Olk, a.a.O. (s. Fußnote 8), S. 164-187.]
In der Krankenversicherung wird besonders handgreiflich, wie explosiv ein soziales Minimum sein kann. Der Dynamik der Sozialausgaben soll durch Beschränkung auf eine „Grundversorgung" begegnet werden - ein sozialpolitisches Irrlicht. Denn deutlicher als bei Geldleistungen können medizinische Leistungen nicht schadlos begrenzt werden.
[Fn.28: Vgl. Lutz Leisering, Sozialstaat und demographischer Wandel. Wechselwirkungen, Generationenverhältnisse, politisch-institutionelle Steuerung, Frankfurt a.M.: Campus.]
Die kostengünstige „Grundversorgung" wird sich, wenn sie auf Ausgabenbegrenzung zielt, aus dem kostentreibenden medizinischen Fortschritt ausklinken müssen - und damit Krankheit und Tod für Personen in Kauf nehmen, die einen vollen Einsatz der verfügbaren Hilfen nicht bezahlen können. Für alte Menschen ist dies bereits heute eine Realität, wenn auch weniger offen als in anderen Ländern. Daß die Sozialhilfe nach einer Odyssee durch verschiedene Ressorts nun im Ministerium von Horst Seehofer gelandet ist, entbehrt insoweit nicht einer gewissen Symbolik.
Gefordert ist eine Verständigung über einen Grundwert sozialstaatlicher Demokratien, die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle, und über die Anstrengungen, die zu seiner Umsetzung erforderlich sind. In Zeiten, in denen dauerhaft Ausgegrenzte und auch immer mehr ehedem sich gesichert wähnende „normale" Bürger und Bürgerinnen einer Mindestsicherung bedürfen, wird es ernst mit sozialstaatlichen Leistungszusagen. In der Sozialhilfereform geht es nicht um Zahlungen an lästige Randgruppen, um das „Füttern von Krokodilen", nicht um ein Nebengebäude des Sozialstaats, dessen Überbelegung durch preiswerte Maßnahmen einzudämmen wäre. Es geht um das Fundament, ein zivilisatorisches Minimum.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Oktober 2000