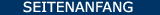![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 23]
Prof. Ulrich Pätzold
„Die Entwicklung der Medien und ihre Auswirkungen auf die Journalistenausbildung„
Meine Damen und Herren, ich möchte anknüpfen an die Begrüßung von Thomas Meyer. Ich habe heute zum ersten Mal so umfassend und so präzise gehört, was in der neuen JournalistenAkademie geschehen wird. Ich denke, dafür sollen wir ihm herzlich gratulieren, dass es so weit gediehen ist und dieses Werk nun in Gang gesetzt wird. Und wir hoffen, dass möglichst viel davon Wirklichkeit wird, was er für die Zukunft versprochen hat.
Wenn ich den fachwissenschaftlichen Diskurs in Amerika über Journalismusforschung richtig verstehe und richtig beobachte, dann polarisieren dort die Theoriebildungen über den Journalismus in viel radikalerer Weise, als das in unserem Land der Fall ist. Auch wir hier sind weiter denn je davon entfernt, einen Konsens zu haben oder konsensuale Grundsätze über die politische und gesellschaftliche Funktion der Medien im Zusammenhang mit ihrer ökonomischen Entwicklung. Die hilfreichen Ausführungen aus dem Bundesverfassungsgericht dürfen uns nicht darüber täuschen, dass in Wirklichkeit andere Ziele die Dynamik beherrschen. Deshalb fällt es umso schwerer, eindeutige konsensuale Merkmale, Leistungsmerkmale, Leistungsanforderungen an einen modernen Journalismus aus dem Zusammenspiel normativer und ökonomischer Wirkungen in der Publizistik abzuleiten.
Also Sie merken, ich versuche, eine etwas andere Position aufzubauen als die lediglich dem demokratietheoretischen Modell folgende, wonach Journalismus eigentlich immer nur das sein kann, was Thomas Meyer eben beschrieben hat.
Ich werde auf diese Polarisierung à la USA gleich noch mal zurückkommen. Zunächst zwei Thesen, mit denen ich den Standort für unsere Analysen deutlich machen möchte:
- Von der Zeitung bis zum Internet wird das Mediensystem immer diversifizierter, was die Medientypen und ihre Angebotsformen angeht. Der
[Seite der Druckausg.: 24]
Wettbewerb dieser unendlich vielen Medien, von denen wir umgeben sind, bezieht sich in erster Linie auf die Aufmerksamkeit des Publikums. Medienproduktionen, Medienformate konkurrieren um Wahrnehmungszeit. Um diese Konkurrenz erfolgreich managen und bestehen zu können, werden möglichst viele horizontale, vertikale und diagonale Verbindungen im Mediensystem aufgebaut. Cross promotion, cross ownership, cross cooperation sind alles unternehmerische Antworten auf die Diversifikation des vielkanaligen Mediensystems. Medienkonzentration ist die wirtschaftliche Basis von Medienkultur.
- Welche Angebote der Medien journalistisch sind und welche nicht, hängt von der Sichtweise ab, was Journalismus ist oder sein soll. Ist Journalismus eine Nachfrage orientierte Dienstleistung, wird der journalistische Anteil im Mediengesamtangebot größer zu gewichten sein, als wenn man Journalismus als autonomes Handlungssystem versteht, das den Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Gesellschaft offen zu halten hat. Uns bleiben die funktionalen Zusammenhänge zwischen Periodizität, Universalität, Aktualität und Publizität, die Grundkategorien, in denen sich der Journalismus entwickelt, wie sie seit Otto Groth für unsere Wissenschaft gelten.
Die Abgrenzung des Journalismus von anderen Mediendiskursen kann in der Auseinandersetzung mit zwei kategorialen Begriffen gefunden werden: die öffentliche Relevanz von Ereignissen und Entwicklungen und die Gewährleistung größtmöglicher Zuverlässigkeit von verbreiteten Informationen. Das ist also aus meiner Sicht Kern des journalistischen Beitrags in den Medien. Die darin enthaltene qualitative Dimension des Journalismus ist sowohl angebotsorientiert (oder produktbezogen) als auch nachfrageorientiert (also ökonomisch) zu behandeln.
Und nun vielleicht noch ein paar Anmerkungen: Warum polarisiert Journalismus? Also warum kann man sich darauf nicht einigen und sagen, das soll in den Medien so – und möglichst nur so - geschehen, und wo immer es Medien gibt, soll es so einen – und nur einen solchen - Journalismus geben.
Ich habe eben auf die radikale Polarisierung journalismustheoretischer Diskussionen in den USA hingewiesen. Vor wenigen Tagen erschien in der Fachzeitschrift Journalism. Theory, Practice, and Criticism – das ist eine sehr
[Seite der Druckausg.: 25]
renommierte Zeitschrift – ein Aufsatz des ebenso renommierten Wissenschaftlers John Heartly. Darin schreibt er plakativ und provokant: „Journalismus ist Krieg.„ Amerikaner neigen dazu, sehr plakativ zu formulieren. „Journalismus ist Krieg.„ - mit dieser These fasst er Untersuchungsergebnisse zusammen, nach denen erfolgreiche Journalisten „kämpfende Interviewer„ seien, „die ein Nein als Antwort nicht akzeptieren.„ Zeitungen gewinnen Auflagen, so Heartly, wenn sie mit Kampagnen wie Kreuzzügen zu Felde ziehen. Journalismus sei deshalb „die Profession der Gewalt„. Erfolgreiche Journalisten kämpfen für die Veröffentlichung von Geschichten, die eigentlich keiner erzählen will. Geschichten sind dann gut für das Geschäft der Medien, wenn sie Gewalt und Korruption dort enthüllen, wo man eigentlich respektable Institutionen vermutet. Heartly folgert daraus, die wichtigste theoretische Aussage über den Journalismus laute: „Wahrheit ist Gewalt. Realität ist Krieg. Nachrichten sind Konflikt.„ Vielleicht das noch mal als Erläuterung und Anschaulichkeit zu dem Begriff Inszenierung, der im Rahmen der aktuellen Konstruktivismustheorien eine so prominente Rolle für die Erklärung der Medienattraktivität spielt.
So wie in den USA würden wir in Deutschland wahrscheinlich nicht formulieren. Journalisten verstehen sich hier in ihrer Mehrheit als schnelle, zuverlässige und neutrale Vermittler, so wenigstens das Ergebnis der letzten großen Journalistenuntersuchung, die wir von Weischenberg, Löffelholz und Scholz von vor ungefähr drei Jahren vorgelegt bekommen haben. Eine kämpferische Berufsgruppe sind Journalisten in der Regel wohl kaum. Deswegen zwei weitere Thesen:
- Der Journalismus als Teilgröße der Medienproduktion kann sich als Medienangebot im Markt durchaus behaupten. Trotz aller Attraktivität fiktionaler und unterhaltsamer Angebote bleibt die Nachfrage nach unabhängiger kompetenter und glaubwürdiger Information. Sie herzustellen, ist die Aufgabe journalistischer Systeme. Aber jeder Journalismus findet in einem spezifischen Medienumfeld statt. Deshalb kommt es immer mehr darauf an, die professionellen Grundlagen des recherchierenden, pluralitätsbildenden Journalismus zu verbinden mit den medienspezifischen Techniken attraktiver Darstellungs- und Vermittlungsformen.
[Seite der Druckausg.: 26]
- Journalistische Konstrukte entstehen nicht in der Abgrenzung zwischen Information und Unterhaltung. Sie entstehen durch Authentizitätsglaubwürdigkeit und politische Reichweite ihres Bedeutungsgehaltes. Deshalb ist Journalismus eine mögliche Grundform eines jeden Mediums, ob an die allgemeine Öffentlichkeit gewandt oder an eine definierte Zielgruppe, ob in Zeitungen, Zeitschriften, im Hörfunk, Fernsehen oder ob im Internet.
Wenngleich in seiner medienspezifischen Form abhängig von der Nachfrage, vom Markt, vom Marketing, vom Medienmanagement, vom Medienunternehmen, bleibt Journalismus im Kern auf Autonomie angewiesen. Die Auswahl der Themen, ihre Präsentation, die Demonstration des Politischen in den alltäglichen Ereignissen, die Gewichtung und Akzentuierung von Unterschieden in der politischen Bewertung und Strategie, die Hervorhebung von Gefährdungspotenzialen, die Versuche des Erklärens und Verstehens komplexer Entwicklungen, die Repräsentanz der öffentlichen Relevanz von Themen und Ereignissen sind redaktionelle Entscheidungs- und Handlungsprozesse, die professionell unabhängig bleiben müssen. Alle Interventionen gegen die redaktionelle Autonomie in den Medien, alle Schwächungen des organisatorischen Status der redaktionellen Autonomie müssen als Alarmzeichen wahrgenommen werden. Hier ist Medienpolitik gefordert.
Allerdings stellt sich die Frage, ob wir mit solchen inzwischen konservativen Beschreibungen des Journalismus noch tatsächlich seine unterschiedlichen Kernbereiche verbinden können. Ich komme noch einmal auf den Aufsatz von John Heartly zurück. Neben dem kämpferischen Journalismus, neben der Profession der Gewalt identifiziert er noch eine andere erfolgreiche Gruppe im Journalismus. Er sagt nämlich, Journalismus expandiere hin zu den lächelnden Berufen, die im Namen von Freude, Unterhaltung und ständigem, aufbauendem Spaßsinn Kontakt mit dem Publikum pflegen. So gesehen ist es nicht schwer nachzuvollziehen, dass auch in der Qualifizierung, in der Journalistenausbildung, Ziele und Methoden auseinanderdriften und sich schließlich institutionell verselbstständigen. Wir merken es in unseren Instituten, in denen wir Journalisten aus- und weiterbilden: Die Gesichter, die Gestik und Mimik rücken in den Vordergrund. Das Informationsdesign beginnt sich bisweilen zu verselbständigen, wird wichtiger als
[Seite der Druckausg.: 27]
die Information. Von der Information zum Infotainment geht die Entwicklung, vom Nachrichtengeber zum Nachrichtenentertainer.
Dazu meine abschließenden drei Thesen, mit denen ich die Diskussion anregen möchte:
In den letzten 30 Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass journalistische Aus- und Weiterbildung notwendige Voraussetzung für die Professionalisierung des Journalismus ist. Das hat sich jetzt ja auch in der Friedrich-Ebert-Stiftung durchgesetzt. Ich empfinde das als Fortschritt.
Zunächst haben davon Einrichtungen profitiert, die Unabhängigkeit garantieren und ihre Arbeit in der Tradition eines Journalismus betrieben haben, die von der öffentlichen Aufgabenbestimmung des Journalismus geprägt war. Nachhaltiges Problem dieser Einrichtungen war ihre permanente Unterfinanzierung, weswegen es nur schwer gelang, die Anpassung an die medientechnischen Anforderungen im Beruf voranzutreiben. Trotzdem gehören auch heute noch zum Beispiel das Institut, das ich selber vertrete, die Journalistik in Dortmund, wie auch viele andere zu den erfolgreichsten Ausbildungseinrichtungen. Gleiches gilt für die drei wesentlichen unabhängigen alten Institute der journalistischen Aus- und Weiterbildung in Hamburg, Hagen und München. Die Diskussion ist überfällig, wie viel der öffentlichen Hand solche unabhängigen Einrichtungen wert sind.
Es ist legitim, dass auch gesellschaftliche Großgruppen, Parteien, Kirchen und andere ihre Journalistenwerke geschaffen haben. Wie weit über sie der Mediendialog gefördert, Journalisten für die eigene Sache gewonnen oder umfassende Bildungsarbeit betrieben werden soll, ist nicht immer ganz zu durchschauen, wie überhaupt die journalistische Aus- und Weiterbildung an den Rändern immer unübersichtlicher wird. Nach der Professionalisierung des Journalismus und dessen positiven Auswirkungen auf die Aus- und Weiterbildung besteht nun die Gefahr einer Entgrenzung des Journalismus, eine Überlagerung seines notwendigen Profils.
Eine neue Entwicklungslinie der journalistischen Aus- und Weiterbildung geht seit einigen Jahren von den großen Medienunternehmen aus. Sie gründen ihre eigenen Journalistenschulen und Akademien. Jüngst haben
[Seite der Druckausg.: 28]
das Bertelsmann und RTL in Köln mit der RTL-Journalistenschule getan. Bei Durchsicht des Curriculum ist der Verdacht nicht auszuschließen, dass in solchen Einrichtungen die journalistische Aus- und Weiterbildung zu einem Instrument des Unternehmensmarketing wird und nicht vornehmlich am öffentlichen Interesse und an der öffentlichen Aufgabe ausgerichtet ist. Zumindestens wird wohl damit gerechnet werden müssen, dass im Zweifelsfall die Quote für journalistische Produkte seine Qualitätsmerkmale beeinflussen.
Das wäre bei den zwei Richtungen, in denen sich Journalismus entwickelt, an sich ja auch noch nicht weiter schlimm, zumindest systemimmanent. Nur gerät die journalistische Aus- und Weiterbildung im Zuge der Medienentwicklung in einen Wettbewerb zwischen öffentlich unabhängigen und privaten unternehmensgebundenen Einrichtungen. Auch dagegen wäre angesichts der Medienrealität ernsthaft nichts einzuwenden, wenn dieser Wettbewerb nicht ausgerechnet durch die Förderpolitik der öffentlichen Hand und gesellschaftlicher Entwicklungen verzerrt würde. So erhält die RTL-Schule von der nordrhein-westfälischen Landesregierung eine Startförderung von nahezu 900.000 Mark und einen jährlichen Förderzuschuss von 360.000 Mark. Ich erwähne diese Zahlen nur deswegen, weil – manche hier im Raum wissen es aus eigener Erfahrung – das alles astronomisch hohe Zahlen sind im Verhältnis zu den Zuwendungen, die öffentliche unabhängige Institute wie Journalistenakademien oder gar Universitäten je in ihrem Leben gesehen haben.
Ich plädiere dafür, sich der Unterschiedlichkeit öffentlicher und privater Ausbildungseinrichtungen für den Journalismus sehr bewusst zu bleiben. Und ich plädiere dafür, dass finanzielle Förderungen von journalistischen Bildungseinrichtungen nicht der Laune und der Opportunität von Kanzleien der Landesregierungen überlassen bleiben dürfen, sondern den öffentlichen und parlamentarischen Diskurs voraussetzen müssen. Denn sonst entstehen Wettbewerbsverzerrungen, wie wir sie zur Zeit in Nordrhein-Westfalen erleben. Ich rede von mir, der ich an einer Universität arbeite, an der in den letzten Jahren eine der erfolgreichsten Innovationen in der fernsehjournalistischen Ausbildung aufgebaut wurde. Nach einer Aufbaufinanzierung geraten wir jetzt in die Unterfinanzierung, weil die öffentliche Förderung zurückgefahren wird. Wir haben in Dortmund eine sehr praktische
[Seite der Druckausg.: 29]
Fernsehausbildung. Mit den Studierenden produzieren wir wöchentlich 75 Minuten journalistisches Fernsehprogramm, das durchaus respektable Resonanz findet. Ungefähr 250.000 Mark sind dafür jährlich nötig. Die Universität hat bestenfalls 100.000 DM einzubringen. Wenn wir nicht eine weitere Förderung erhalten, etwa von der Landesanstalt für Rundfunk, dann müssen wir abschalten, dann ist diese seriöse Fernsehausbildung beendet. Dann bleibt halt die RTL-Journalistenschule, aber eben auch nur ihr favorisierter Journalismus. Die Gefahr sehe ich als Folge der Wettbewerbsverzerrung, mit Verlaub einer durch öffentliche Gelder bewirkten Verzerrung.
Was ich sagen will: Die diskursive Auseinandersetzung über die Journalistenausbildung im Rahmen der Medienentwicklung ist notwendig, aber nicht ausreichend. Es ist dringend an der Zeit, politisch gewollte Rahmenbedingungen zu setzen und über die Finanzierung einer aktiven Medienpolitik zu reden, also Bildungspolitik nicht nur vom Curriculum und von den Zielen her zu diskutieren, sondern auch danach zu fragen, mit welcher Infrastruktur, mit welchem Geld denn diese Strategien umgesetzt werden sollen. [Beifall]
Diskussion
Ulrike Helwerth
Herzlichen Dank, Herr Pätzold. Das war kompakt. Ich gehe davon aus, dass die Gäste auf dem Podium dazu Fragen und Anmerkungen haben.
Ich habe auf der Grundlage Ihrer Thesen, Herr Pätzold, für die einzelnen Gäste hier oben auf dem Podium Fragen vorbereitet und würde diese bitten, in ihrer Antwort vielleicht auch ihre eigenen Fragen an Herrn Pätzold zu formulieren. Was Sie als Publikum betrifft: Sie werden Ihre Zeit bekommen für Nachfragen und Kommentare. Ich bitte Sie, diese aber zurückzustellen bis zum Ende des zweiten Blocks, so dass wir dann kompakt Ihren Bedürfnissen gerecht werden können.
Zunächst an Sie, Frau Junker: Herr Pätzold hat gesagt, dass die Medienkonzentration die wirtschaftliche Basis der Medienkultur sei. Wie behauptet sich aber dann die Meinungsfreiheit und -vielfalt und das Gebot der Information und Aufklärung in diesen Zwängen?
[Seite der Druckausg.: 30]
Karin Junker
Als Mitglied des Europäischen Parlamentes bin ich in einem Feld tätig, das viel zu wenig Aufmerksamkeit findet. Hier wird massiv über die Bedingungen von Journalismus entschieden, egal in welcher Ausbildung sich die Leute befunden haben oder noch befinden. Im Augenblick geht es um das so genannte Telekom-Paket, fünf Richtlinienentwürfe der Europäischen Kommission, die bis Anfang des Jahres abgeschlossen sein sollen. Für zwei bin ich Berichterstatterin im Ausschuss, der für Medien zuständig ist. Auf den ersten Blick hören sich die Entwürfe so an, als ob sie überhaupt nichts mit Medien zu tun hätten. Es geht zum Beispiel um Harmonisierung und Koordinierung der Frequenzpolitik auf der europäischen Ebene. Ich muss feststellen, dass hier eine große Wachheit besteht bei denen, die ein kommerzielles Interesse daran haben, das zu nutzen.
Wir versuchen von der politischen Seite her Informationsvermittlung überhaupt sicherzustellen. Wir wollen erreichen, dass die Mitgliedsländer der Europäischen Union im Fernsehen und bei Multimedia-Angeboten so genannte Mass-carry-Regeln verwirklichen, was bedeutet, dass Angebote, die im Sinne der demokratischen Meinungsbildung und des öffentlichen Interesses für wichtig gehalten werden, auch verbreitet werden können.
Man darf sich ja nichts vormachen. Es geht um einen Krieg der Angebote und um die Machtverteilung auf dem Markt. Und der tobt ganz schön. Wir sind da außerordentlich den Lobby-Interessen ausgesetzt, wir kriegen es täglich zu spüren, was es bedeutet, den Kampf zu führen. Deshalb glaube ich, man muss das ganze Thema etwas breiter ins Auge fassen als nur zu fragen, was journalistisches Ethos ist und an welchen Kriterien es sich fest macht. Es geht um Marktbedingungen und die Möglichkeiten, das, was diejenigen, die kulturorientiert sind, die informationsorientiert sind, die publizistische Relevanz eben immer noch für ein wichtiges Mittel der demokratischen Meinungsbildung halten, dass das nicht verschwindet in diesem Kampf um die Inszenierung, im Kampf um die Marktmacht, was letztlich immer mit dem Wort Quote umschrieben ist.
Mit diesem Spannungsfeld muss man sich auseinander setzen. Wenn Politik angesprochen ist, die Orientierung am öffentlichen Interesse, dann muss ein klares Bekenntnis abgelegt werden, dass öffentliches Interesse nicht nur
[Seite der Druckausg.: 31]
festgemacht werden kann an einem Mehrheitsinteresse. Die Verbreitung bestimmter Werte und Inhalte muss auch dann sichergestellt werden, wenn es sich um ein Minderheiteninteresse handelt, weil sonst eine völlige Nivellierung der Medienlandschaft stattfindet. Das ist völlig unabhängig davon, über welche Infrastruktur das verbreitet wird. Hier versuche ich meinen Beitrag im Rahmen der Politik zu leisten in der Hoffnung, Pluralität zu sichern.
Ulrike Helwerth
Vielen Dank, Frau Junker. Bleiben wir beim Markt. Herr Doerry, Herr Pätzold hat gesagt, Journalismus ist eine nachfrageorientierte Dienstleistung. Und aus den USA haben wir gelernt, dass Journalismus zu den „lächelnden„ Berufen gehört, was ja zu den Dienstleistungen auch gehört. Wenn denn das so ist: Was unterscheidet dann Journalismus heute eigentlich noch von dem, was man in den Medien neudeutsch so schön Content nennt, also diese Vermischung von redaktionellen und kommerziellen Angeboten? Was unterscheidet Journalismus von dem, was wir sonst noch in den Medien vorfinden?
Dr. Martin Doerry
Das ist schwierig. Ich bin im Ernst nicht der Meinung, dass – zumindest was den SPIEGEL angeht – eine Vermischung von solchen Inhalten stattfindet. Ich glaube, wir achten traditionell sehr, sehr streng auf eine Unterscheidung in solche Inhalte, journalistische Inhalte und Dinge, die etwas mit dem Markt oder mit Werbung zu tun haben. Wir haben diese Debatte in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv geführt, weil wir – sprich der SPIEGEL – ja mit Spiegel-online Großes vorhaben. Wir haben vor, unser Internet-Angebot stark auszuweiten. Und im Zusammenhang mit dieser geplanten Ausweitung wurde natürlich auch diese Diskussion geführt, wie man im Internet das fortsetzt, was im SPIEGEL seit nun schon 53 Jahren geheiligte Tradition ist, also keine Vermengung von Werbewirtschaft auf der einen Seite, von Anzeigen, und journalistischem Anspruch auf der anderen Seite. Das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, weil Sie auf dem Computerbildschirm zunächst mal nicht so reinlich trennen können – viele tun es auch überhaupt nicht – wie Sie das auf den Seiten des SPIEGEL-
[Seite der Druckausg.: 32]
Heftes machen können, wo Sie einerseits die Anzeigen haben und andererseits die journalistischen Texte. Da gibt es also viele Gefahren, denen Sie ausgesetzt sind, wenn Sie solche Internet-Angebote machen.
Wir haben versucht – und ich hoffe, die Praxis wird zeigen, dass die Regeln, die wir nun gefunden haben, sich auch bewähren – sehr strenge Richtlinien zu verabschieden und auch, wenn man so will, in Konzepte umzugießen, wie wir uns selbst nicht angreifbar machen, damit man uns in Zukunft nicht vorwerfen kann, dass wir zum Beispiel Rücksicht nehmen auf Produkte, Rücksicht nehmen auf Verbände, Rücksicht gar auf Parteien oder Gewerkschaften. Diesem Druck von außen, der im Internet auf eine ganz neue Weise zu spüren ist, diesem Druck wollen wir standhalten. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Aber das ist eine Debatte, die stark in die Zukunft reicht. In der Gegenwart gibt es ja noch ein paar andere Konflikte. Darauf kommen wir sicher noch.
Ulrike Helwerth
Herr Pätzold, Sie haben das Recht und das Privileg, immer einzugreifen, wenn Sie es wünschen.
Prof. Ulrich Pätzold
Aber ich brauche nicht einzugreifen, weil ich bisher nichts gehört habe, was ich korrigieren müsste...
Ulrike Helwerth
… was Ihnen widerspricht.
Prof. Ulrich Pätzold
Ich nehme mit großer Freude immer neue Begriffe auf: Also, offen halten für Angebote, die nicht der Abstimmung am Kiosk geopfert werden müssen. Richtlinien: Wie gehen wir mit einem neuen Medium journalistisch um? Ich denke, das sind alles gute Hinweise, in welche Richtung wir hier weiterdiskutieren sollten.
[Seite der Druckausg.: 33]
Ulrike Helwerth
Frau Jochimsen, auch auf die Gefahr hin, dass Sie nichts zum Dissens beitragen können: Herr Pätzold hat gesagt, der Journalismus ist im Kern auf Autonomie angewiesen. Wie kann diese Autonomie behauptet werden, wenn selbst die öffentlich-rechtlichen Anstalten ja immer mehr unter den viel zitierten Quotendruck geraten?
Dr. Luc Jochimsen
Ich denke, worüber wir mit all diesen interessanten Thesen bisher nicht geredet haben, ist eine grundsätzlich neue Tatsache, mit der sich Journalismus auseinander zu setzen hat. Wie er das eigentlich bewältigen soll, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weiß ich auch nicht genau. Seit wir um die Pressefreiheit kämpfen in Europa und auch in Amerika, haben wir immer die Befürchtung gehabt, dass die Pressefreiheit, die Informationsfreiheit gefährdet ist durch Politik, durch Machthaber, dass sie unterdrückt wird von den Herrschenden. Wir haben sehr Interessantes gehört zu dem Ineinanderübergehen von Politik, Machthabenden und den Medien. Die Beschreibung, die Herr Meyer uns geliefert hat, ist, glaube ich, sehr zutreffend.
Nachdem wir die Pressefreiheit mit Verfassungsrang in unserem Grundgesetz haben und sie nicht gefährdet ist von Machthabenden - wenigstens nicht in unserem Land –ist unser heutiges Problem, dass der Artikel 5 kommerzialisiert wird und die Pressefreiheit durch und durch ein kommerzielles Gut geworden ist. Der Sündenfall ist das Ausrufen des dualen Systems, zumindest was die elektronischen Medien angeht. Das hat die Politik so gewollt. Hätte man damals klarsichtig gesagt, die einen sollen wirklich nur Entertainment machen, dann könnten die anderen Information und Politik betreiben. Stattdessen hat man den umgekehrten Weg gewählt und den kommerziellen Anbietern gesagt, Ihr müsst einen bestimmten Bereich der Information abdecken. Das Ergebnis, das wir heute haben, haben Sie eben angesprochen:
Den Öffentlich-Rechtlichen wird neuerdings zum Vorwurf gemacht, sie liefen den Quoten hinterher. Natürlich sind Quoten Ausdruck des Masseninteresses, des öffentlichen Interesses an dem, was die Öffentlich-
[Seite der Druckausg.: 34]
Rechtlichen als Information und Programm hervorbringen. Das ist nicht nur Quotendruck in Form einer Pression von außen. Ich stehe auf dem Standpunkt, ein Massenmedium muss ein Massenpublikum haben. Wenn ein Massenmedium kein Massenpublikum hat, dann läuft ja irgendwas nicht ganz richtig. Also wenn wir sagen würden, es interessiert uns nicht, wie viele Leute uns zuschauen und zuhören, dann geben wir unsere Berechtigung vollkommen auf.
Die durchgreifende Kommerzialisierung all dessen, was Information und Politik ist, und gleichermaßen von dem, was Unterhaltung, Ablenkung und Spiel ist, führt eben dazu, dass man in der Tat schon gar nicht mehr sagen kann, wo eigentlich die Information beginnt, und zwar nicht nur im Sinne der Inszenierung oder wo die Grenzen des Wahrheitsgehaltes verlaufen. Meines Erachtens kann man auch nicht mehr beantworten, was denn eigentlich Journalismus ist und was journalistisches Arbeiten, abgeleitet davon, wie wir eigentlich zum Journalismus hin ausbilden.
Ich finde die Zitate aus Amerika nicht gerade übertragbar auf unsere Verhältnisse, andererseits sehr schön, um mit ihnen zu arbeiten. Es gibt in der Tat den kämpferischen Kampagnentyp des Journalismus - und das nicht nur aus der Sichtweise des Altkanzlers Kohl – der auch sagt, er sei Opfer einer Kampagne.
McLouven hat das aus Amerika schon vor Jahrzehnten ziemlich genau beschrieben, was passiert, wenn Aufklärung, wenn Wahrheit, wenn Information in Form von Wellen publiziert wird. Dann hat das wirklich einen bestimmten Rhythmus: Die Welle kommt, sie geht hoch, sie steigert sich, sie kommt, und sie kommt auch wieder zum Verlaufen. In dieser Bewegung befinden wir uns. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich darüber hinwegzumogeln. Die Gefahr, die ich sehe, liegt in der Tat darin, dass eine Öffentlichkeit für längere Zeit nicht mehr herstellbar ist, als durch Inszenierungen.
Lassen Sie mich kurz einen zweiten Gedanken einbringen: Wenn Sie sich die politischen Skandale in unserem Land angucken, dann fragen Sie sich ja wirklich, muss der Journalismus überhaupt noch inszenieren? Die Geschichte mit dem berühmt-berüchtigten Koffer mit einer Million im Dreiländereck an der Autobahnraststätte und den Herren, die das Geld entgegengenom-
[Seite der Druckausg.: 35]
men und weitergetragen haben – da brauchen Sie ja nichts mehr zu inszenieren. Das sind politische Inszenierungen, die einen Selbstlaufcharakter haben. Oder auch der frühere Kanzler, der mit einer Inszenierung des Ehrenwortes eine ganze politische Kultur oder Unkultur etabliert hat. Da laufen in der Tat Politik und Journalismus, Politik und die Kunst der Inszenierung, wie sie uns überkommen ist, ineinander über.
Wie vorhin gesagt wurde, leben Diskurs und Information von der Kontroverse. Nach meiner Erfahrung findet politische Kontroverse in unserem Lande so gut wie gar nicht mehr statt, wenn man mal absieht davon, dass um 2,80 DM mehr oder weniger Rente im Jahr 2013 gestritten wird. Richtige politische Kontroverse findet nicht statt. Ich hatte neulich in einer Sendung Bundesinnenminister Schily und den bayerischen Innenminister Beckstein. Vom politischen Lebenslauf und den Biografien her gibt es kaum zwei Menschen, die gegensätzlicher sein könnten. In ihrer augenblicklichen politischen Arbeit in Bezug auf NPD-Verbot und auf Einwanderungsgesetze belobigen sich die beiden Politiker aber gegenseitig. Es gibt offenbar so gut wie keine Kontroversen, die sie in einem Diskurs aufführen könnten. Wo sind die politischen Themen? Selbst die Homo-Ehe ist eigentlich kaum mehr wirklich kontroversefähig.
Ich kann Ihnen nur sagen, am Ende eines langen journalistischen Arbeitens herrscht bei mir totale Ratlosigkeit: Ich weiß nicht, was ich heute jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns mit auf den Wege geben soll außer dem ganz klassischen alten Handwerk. Die müssen dann irgendwie sehen, wie sie damit zurechtkommen. Meistens wird sehr schnell offenkundig, wie verdammt schwierig das ist.
Dr. Martin Doerry
Vielleicht darf ich kurz etwas dazu sagen: Ich glaube tatsächlich – da sind wir sehr nahe beieinander –, dass das Problem nicht so sehr im Journalismus liegt, sondern in der Politik. Nicht nur die Ferne von jeglicher Kontroverse, dieses Nicht-Austragen von wirklich inhaltlichen Debatten, ist ein Riesenproblem, mit dem wir Journalisten zu tun haben. Der SPIEGEL ist da vielleicht sogar ein bisschen wie eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Der gibt sich nämlich redlich Mühe, diese politischen Konflikte zu finden und dann
[Seite der Druckausg.: 36]
auch noch – möglicherweise würden Sie jetzt sagen – zu inszenieren, aber wir versuchen sie nur so darzustellen, dass sie für den Leser von Interesse sind, dass sie überhaupt wahrgenommen werden als Konflikte. Wir wissen ganz genau, insbesondere bei Europafragen, wie unsere Leser dabei auf Distanz gehen. Wir merken das immer an den Auflagen, wenn wir Europa-Titel machen.
[Zwischenruf: Das sind Ihre Quoten.]
Das sind unsere Quoten. Deswegen komme ich darauf. Wir machen das trotzdem, weil wir der Meinung sind, dass das erstens zum Image des SPIEGEL gehört, da sind wir ganz egoistisch. Ein politisches Nachrichtenmagazin muss politische Themen auch vorne drauf plakatieren. Zum anderen ist es auch das Selbstverständnis der Redakteure, die interessieren sich nämlich sehr für politische Themen und ärgern sich nur manchmal über das Personal, mit dem sie es zu tun haben, weil das nicht hergibt, was sie brauchen.
Ulrike Helwerth
Danke, Frau Jochimsen. Danke, Herr Doerry. Sie sind schon in den zweiten Block eingestiegen, nämlich die Frage, ob Medien überhaupt inszenieren müssen, oder ob sie nicht einfach nur politische Inszenierungen aufgreifen, ob Politik eigentlich nur noch die Frage ist, wie inszeniere ich mich am besten? Das zweite große Problem ist die Öde oder die Monothematik in der Politik. Das wollen wir dann in der zweiten Runde besprechen.
Ich komme auf eine Sache von Ihnen zurück, Frau Jochimsen. Sie haben über die Kommerzialisierung des Artikel 5 gesprochen. Herr Pätzold hat gefordert, dass die Medienentwicklung neue politische Rahmenbedingungen, eine aktive Medienpolitik fordert.
Frau Griefahn, wie müssen die Grundzüge einer solchen Politik aussehen oder wie können sie aussehen?
[Seite der Druckausg.: 37]
Monika Griefahn
Ein Punkt, der vielleicht ein bisschen unterschätzt wird, ist die Konvergenz der Medien. Nach der Statistik nutzen nur 28 Prozent der Erwachsenen über 14 Jahre das Internet; die Hauptinformationsquelle der unter 40-Jährigen sind die regionalen und überregionalen Zeitungen mit ihrem Online-Angebot. Diese Nutzer sehen 34 Prozent weniger fern, hören 15 Prozent weniger Radio und lesen 21 Prozent weniger Zeitung. Wir sehen also, dass die Frage der Konvergenz der Medien ein wichtiges Thema ist.
Das ist ja auch eine Debatte, die wir zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern im politischen Raum sehr intensiv haben. Wenn dann einige Länder meinen, die Öffentlich-Rechtlichen dürften keine Angebote machen, bedeutet das im Klartext, dass im Prinzip die unter 40-Jährigen vom Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr erreicht werden, auch nicht von dessen Informationsangebot, das sie eigentlich suchen. Dieses Suchen machen sie sehr spezifisch, sie setzen sich an den Computer und wählen bewusst, ob sie gerade Internet-Seiten, oder ob sie sich Online-Informationen anschauen wollen und gucken zwischendurch auch mal in den SPIEGEL rein und solche Geschichten. Das hat ja auch zur Folge, dass der SPIEGEL seine Online-Angebote enorm ausweitet, und andere tun das auch, und zu Recht.
Wenn ich jetzt anschaue, was wir bei uns in der Bundespolitik machen, dass wir sagen: Welche Deutschlandportale brauchen wir denn? Da gibt es ein Deutschlandportal der Deutschen Welle, ein Deutschlandportal der Goethe-Institute, ein Deutschlandportal der Bundespressekonferenz; dass die jetzt koordiniert werden und auch Informationen über Deutschland in koordinierter Form anbieten sollen, zeigt, wie wichtig dieses Medium wird.
Nachdem gerade die UMTS-Lizenzen verkauft wurden, wird deutlich, dass die Konvergenz der Medien stark unterschätzt wird. Demnächst hat man ein Handy, auf dem man dann alles machen kann, Fernsehen gucken, Internet-Seiten ansehen etc. – dann brauchen wir dafür auch rechtliche Rahmenbedingungen. Das ist es, was uns gerade sehr beschäftigt. Wir haben für das Fernsehen, den Hörfunk, die Printmedien Gesetze, die innerhalb Deutschlands relativ gut zu handhaben und auch kontrollierbar sind. Wenn die Anbieter aber über das Internet kommen, sind sie nicht mehr so gut zu
[Seite der Druckausg.: 38]
handhaben, denn die Internet-Angebote können von woher auch immer eingespeist werden. Die müssen nicht in Deutschland abgesendet werden. Wenn wir hier einen Rundfunksender haben, der in Deutschland sitzt, dann kann man den kontrollieren, weil er seinen Sitz hier hat. Wenn aber meinetwegen von den Philippinen, wo es solche Gesetze nicht gibt, so ein Programm eingespeist wird, und sei es in deutscher Sprache, dann sind sämtliche Rechtsgrundlagen, die wir für Jugendschutz oder für Verbraucherschutz haben, die wir auch in der Frage Vermischung von Werbung und Inhalten haben, obsolet. Deswegen ist eine der wichtigen Fragen: Kann man das eigentlich mit dieser alten Struktur der Teledienste und Mediendienste, das heißt also mit der Trennung zwischen Länder- und Bundesaufgaben zukünftig überhaupt handhaben? Oder brauchen wir nicht eine Abstimmung auf europäischer Ebene – es wird ja versucht über die Richtlinien –, oder auch auf internationaler Ebene? So wie wir eine Klimakonvention haben, die 171 Länder unterschrieben haben. Brauchen wir nicht auch eine Air-Konvention, die alles regelt, was über das Netz transportiert wird? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, an den wir heran müssen und bei dem wir auch als Bundespolitiker Einigkeit brauchen mit den Ländern, die ja eigentlich dafür zuständig sind.
Der zweite Punkt: Wenn ich mir den amerikanischen Wahlkampf anschaue, der etwa 2 Milliarden Dollar gekostet hat. Warum? Dort wird keine der Informationen mehr kostenlos transportiert, die heute in Deutschland noch als Information vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber auch von privaten Fernsehanstalten kostenlos an die Bürgerinnen und Bürger gebracht wird. Das heißt, wenn Al Gore im Fernsehen spricht oder wenn George Bush im Fernsehen spricht, ist das bezahlte Zeit. Die Rundfunkanstalten, die Fernsehanstalten, die dort irgendeine Verlautbarung veröffentlichen oder auch nur ein Interview, bekommen das bezahlt. Jetzt stellen Sie sich das mal übersetzt auf die Bundesrepublik vor, wenn ein Wahlkampf bei uns so viel Geld kosten würde. Wir regen uns jetzt schon auf, was das kostet. Ein normaler Bürger kann dann eigentlich überhaupt nicht mehr Politik machen. Das würde sich reduzieren auf die, die reich sind oder in der Lage, Sponsoren zu bekommen.
Besonders apart fand ich das Beispiel der Fernsehakademie des RTL, das Sie angeführt haben, Herr Pätzold, und das Streichen der Zuschüsse für die Uni
[Seite der Druckausg.: 39]
Dortmund. Da habe ich gedacht, mein Gott, Dortmund ist nicht weit von Gütersloh, da geht man dann zu Bertelsmann, um Sponsorgeld einzusammeln. Das ist natürlich etwas absurd, die nordrhein-westfälische Landesregierung gibt das Geld an Bertelsmann/RTL und nimmt es Dortmund weg und Dortmund soll sich Sponsorengelder einsammeln. Das erscheint mir so etwas von pervers. [Beifall]
Das ist der erste Schritt in die Amerikanisierung, die ganz schnell weitergeht. Das heißt, dass wir dann irgendwann Wahlkämpfe machen müssen, an denen kein Normalsterblicher mehr teilnehmen kann, aber Sie als Bürgerinnen und Bürger auch nicht mehr die Informationen bekommen über Politik.
Der erste Vortrag hieß ja „Zwischen Big Brother und Tagesschau„ – Warum ist denn Big Brother so erfolgreich? Big Brother ist erfolgreich nicht nur wegen der einen Stunde, die täglich im Fernsehen gesendet wird, sondern weil es 24 Stunden im Internet läuft und man scheinbar ständig dabei sein kann. Diese scheinbar aktive Teilnahme an Dingen ist genau das, was das Internet ausmacht und was Journalismus und Journalistenausbildung auch schwierig macht. Das führt dann zu diesen Kurven, die Frau Jochimsen eben beschrieben hat. Man greift irgendein Ereignis auf und versucht es ganz aktuell und dabeiseiend darzustellen und überbietet einander dann noch. Durch die Konkurrenz zwischen Privaten und Öffentlichen wird zusätzlich noch die Frage nach Prioritäten entwertet.
Also, was muss Politik tun? Erstens: Politik muss die Kontroversen inhaltlich gestalten. Ich denke, gerade jetzt bei dem Thema Leitkultur läuft das ja auch ein Stück weit. Zweitens: Wir brauchen wirklich eine Verhandlung auf internationaler Ebene, damit nicht all das, was wir uns an Werten aufgebaut haben, unterminiert wird.
Und drittens: Wir müssen dafür sorgen, dass gute Ausbildung geboten wird. Es gibt natürlich auch ein Problem der Masse. Wir haben inzwischen so viele Fernsehsender und so viele neue Zeitungen, dass es gar nicht mehr genügend gut ausgebildete Journalisten geben kann. Wenn ich heute mit Leuten zusammenkomme, die sich Journalisten nennen, dann denke ich oft, die haben nie eine Ausbildung gemacht. Die haben sich ein Mikrofon
[Seite der Druckausg.: 40]
in die Hand genommen und gesagt: Ich mache jetzt ein Interview. Es gibt nicht so viele, die ausgebildet sind in einer der Institutionen. Dabei ist das doch eine notwendige Voraussetzung, dass man überhaupt lernt: Wie beschafft man sich eine Information? Wie checkt man die gegen etc.?
Meiner Ansicht nach ist das eine Sache, bei der wir die Voraussetzungen mitschaffen können. Trotzdem können wir nicht verhindern, dass es eben auch Leute gibt, die sagen, wir machen eine Meldung, damit wir eine Meldung haben, wir können ja morgen dann eine als Gegendarstellung, oder nicht als Gegendarstellung sondern als zweite Meldung hinterher bringen. Das können wir nicht verhindern. Das ist etwas, das Gesellschaft vielleicht auch durch gesellschaftlichen Disput wieder hinkriegen muss, das kann Politik allein nicht lösen.
Ulrike Helwerth
Danke, Frau Griefahn. Frau Junker, Sie haben das Wort.
Karin Junker
Also ich denke, man darf Vergangenes auch nicht glorifizieren. Ich habe bei einer Tageszeitung volontiert. Mit Ausbildung hatte das damals aber nichts zu tun. Das war im Jahr 1960. Wir sind verschlissen worden als billige Arbeitskräfte. Heute gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten als damals. Als ich 1960 eingestiegen bin ging es nach dem Motto: Entweder man hat die Begabung oder man hat sie nicht. Das war also die Maxime, mit der – egal, in welchem Medium – damals vorgegangen wurde. Das, der historischen Wahrheit zuliebe.
Frau Griefahn hat das Stichwort Konvergenz hier auf den Plan gebracht. Wir haben uns sehr bemüht im Europäischen Parlament deutlich zu machen, dass unter Konvergenz das technische Zusammenwachsen zu verstehen ist und mediale Angebote heute über unterschiedliche Vertriebswege stattfinden, und dass alles auf Digitalisierung hinausläuft und es dann ziemlich schnurz ist, ob man den klassischen Fernseher einschaltet oder den Computer. Wir haben uns dagegen gewehrt, eine Konvergenz der Inhalte zu erkennen. Das halte ich immer noch für richtig. Denn es hat ja die Inten-
[Seite der Druckausg.: 41]
tion bestanden, Rundfunkrecht beispielsweise völlig aus der Welt zu schaffen. Da war unter anderem Herr Bangemann sehr aktiv. Nun haben wir inzwischen eine etwas andere Besetzung. Aber es waren auch die Aktivitäten des Parlaments, das sich sehr daran beteiligt habt, Rundfunk – egal, ob öffentlich-rechtlich oder privat – als ein Kulturgut zu definieren und dafür andere Maßstäbe zu setzen als für Wirtschaftsdienste. Wir haben darauf bestanden, dass hier eine getrennte Beurteilung erfolgt und nicht jedes Medienangebot subsummiert werden kann nur unter Wirtschafts- und Kartellrecht. Um diese Intention ging es. Und wir haben uns durchgesetzt: Ich will das ausdrücklich sagen, dass wir heute immerhin eine getrennte Rechtsetzung vornehmen für die technische Infrastruktur einerseits und Inhalte andererseits.
Schon bei der Technik gibt es Probleme; ich habe das eben am Beispiel der Frequenzpolitik gesagt. Denn wofür Frequenzen verteilt werden, die noch zu knapp sind, das ist auch eine interessante Frage. Zum Inhalt oder von mir aus auch Content: Es gibt eine Richtlinie, die zurzeit diskutiert wird, die heißt E-Content. Das heißt, dass nach wie vor ein qualifiziertes Rundfunkrecht akzeptiert wird und angewandt werden kann. Das war uns ganz wichtig. Ich möchte deutlich machen, dass ich in Übereinstimmung mit vielen meiner Kolleginnen und Kollegen nicht so ohne weiteres von einer Konvergenz der Inhalte sprechen würde.
Worum es geht, ist in der Tat ein völlig verändertes Konsumverhalten. Da hat es keinen Sinn zu jammern, die Jüngeren reagieren anders und haben andere Interessen als die Älteren. Das ist auch der Kummer der Öffentlich-Rechtlichen, wie ich als Vorsitzende eines Programmausschusses weiß. Den Zeitgeist kann man nicht ignorieren, den muss man akzeptieren. Und deshalb finde ich es wichtig, deutlich zu machen, dass beispielsweise Angebote, die im öffentlichen Interesse sind, für ihre Verbreitung alle Möglichkeiten nutzen können, und dass das nicht beschränkt werden darf. Man darf also nicht sagen: Hier ist Öffentlich-Rechtlich und da machen wir das klassische Vollprogramm und schränken die Online-Möglichkeiten ein und dort können die anderen alles machen. Es muss eben auch Chancengleichheit am Markt sein und die Chance bestehen, dass alle sich dieser neuen Möglichkeiten bedienen und damit auch jede Zielgruppe ansprechen können ohne Einschränkungen zu unterliegen. Dies ist mir wirklich ganz wichtig.
[Seite der Druckausg.: 42]
Nun höre ich, Monika Griefahn, es gibt gewisse Übereinstimmungen zwischen uns, was die internationalen Regelungen angeht. Aber am Vorabend von Nizza, das will ich ja doch mal sagen, haben wir eine herbe Enttäuschung erlitten bei der Beratung der Grundrechte-Charta, in der die Medienfreiheit – also den Begriff der Pressefreiheit gibt es da nicht unter Hinweis darauf dass wir es heute nicht mehr nur mit Print-Medien zu tun haben – nicht gewährleistet, sondern nur geachtet wird. Dies hat zu erheblichen Irritationen geführt.
Das ist unter anderem auf Betreiben der deutschen Bundesländer so geschehen. Kurt Beck (der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der Medienkommission der Bundesländer, d. Red), der ja hier als der Rundfunkverantwortliche der Länder tätig ist, hat es ausdrücklich begrüßt und es erklärt, dass damit nun klargestellt sei, Europa habe da nicht reinzufingern. Das finde ich außerordentlich bedenklich, denn es ist eine Grundrechte-Charta und nicht irgendeine Detailvorschrift. Es geht hier um eine politische Rahmensetzung, die damit gerade von deutscher Seite verwässert worden ist. Dies bedaure ich außerordentlich.
Wir kommen mit dieser Form von Europhobie und der Abwehrhaltung gegenüber allem, was über die Grenzen geht, wirklich nicht weiter, das müssen wir akzeptieren. Also, da sehe ich Euch hier an unserer Seite, was ja nicht heißt, dass alles bis zum Ende harmonisiert werden muss. Aber wir müssen natürlich Standards finden, auf die wir uns über die Grenzen hinweg verständigen. Das ist völlig klar. Deshalb bedaure ich das so sehr. Auch der Satz „Eine Zensur findet nicht statt.„ ist entfallen. Das tut mir noch mehr weh, denn im Hinblick auf die Erweiterung der Europäischen Union, vor der wir ja stehen, hätte ich gerade diesen Satz für außerordentlich wichtig gehalten, denn dieses „learning by doing„ gilt ja auch für die Erweiterungsländer, die noch kein gefestigtes unabhängiges Mediensystem haben, wie das bei uns in den westeuropäischen Demokratien der Fall ist. Hier müssen wir, glaube ich, noch bei vielen Empfindlichkeiten gegenhalten.
Ein Wort noch zu dem, was Luc Jochimsen gesagt hat. Ich bejahe es ausdrücklich, dass auch öffentlich-rechtliche Angebote die Akzeptanz eines Massenpublikums haben müssen. Die Chance für Öffentlich-Rechtlich liegt
[Seite der Druckausg.: 43]
ja darin, dass auch andere Programme von öffentlichem Interesse eingebunden werden können, wenn massenattraktive Programme gemacht werden, was bei Kommerziellen praktisch ausgeschlossen ist. Das ist einfach die Systemfrage, die damit verbunden ist. Wenn ich das also in der Konsequenz durchspiele, könnte man ja Herrn Dötz von seinen Eiterbeulen befreien, als die er die Fensterprogramme bezeichnet hat, die man den kommerziellen Vollprogrammen aufs Auge gedrückt hat. Dann müssten sie darunter eben nicht mehr leiden. Aber das ist nur eine scherzhafte Nebenbemerkung.
Dr. Luc Jochimsen
Nur ein Satz. Gerade bei der Grundrechte-Charta bin ich die falsche Ansprechpartnerin, denn für die habe ich mich vehement eingesetzt.
Karin Junker
Das wollte ich auch nicht – ich habe von den Ländern gesprochen.
Dr. Luc Jochimsen
Recht auf Kultur. Nur um das mal deutlich zu machen, das ist nämlich auch rausgeflogen. Und das finde ich schon einen Hammer.
Karin Junker
Ich habe mich ausdrücklich auf die Länder bezogen, damit da keine Unklarheiten aufkommen.
Ulrike Helwerth
Danke. Ich möchte aber noch einmal auf die Journalistenausbildung zurückkommen, die ja immerhin Thema unseres ersten Teil ist. Frau Griefahn hat festgestellt, dass immer mehr Leute ohne qualifizierte Ausbildung zum Mikrofon greifen. Wenn das im Moment stärker auffällt, hat es vielleicht etwas mit der Quantität zu tun. Aber es ist ja bekannt – Frau Junker hat es auch angesprochen–, dass Journalismus bisher ein ungeschützter Beruf ist,
[Seite der Druckausg.: 44]
der auf vielen Wegen und nicht immer nur über Ausbildung zu erreichen und zu praktizieren ist. [Zwischenruf: Politiker auch!] Ja.
Herr Pätzold hat gesagt, journalistische Aus- und Weiterbildung wird an den Rändern immer unübersichtlicher. Herr Mielke, wie lassen sich bei der Vielzahl von journalistischen Aus- und Weiterbildungsangeboten – wir haben im Referat von Herrn Pätzold gehört, wer noch alles neue Schulen aufmacht – und dem zunehmenden „Parajournalismus„, professionelle Standards sichern, bzw. wer hat die Definitionsmacht über das, was guter und qualitätsvoller Journalismus ist, und wie lässt er sich durchsetzen?
Dr. Friederich Mielke
Ja, ganz herzlichen Dank. Da sind wir bei dem Thema „Qualität im Journalismus„, ein ganz sensibles, ein wichtiges Thema.
Aber noch mal zu Frau Junker: In den sechziger Jahren - Sie haben Recht - gab es wirklich keine Möglichkeiten zu journalistischer Aus- und Fortbildung. Inzwischen haben wir aber die Akademien, die Professor Pätzold erwähnt hat, also Hagen und München und Hamburg. Und diese Aus- und Fortbildungsinstitutionen haben Qualität auf ihre Fahnen geschrieben. Das ist ganz wichtig.
Wichtig ist aber auch die Beantwortung der Frage der Auswirkungen der Medienentwicklung. Wir reagieren auf die Entwicklung der Medien mit unserem Aus- und Fortbildungsprogramm und wie reagieren dann die Medien darauf? Meistens ist es ein wechselseitiges, abhängiges Verhältnis.
Ein klassisches Beispiel ist der Online-Journalismus. An der Akademie für Publizistik in Hamburg haben wir seit zweieinhalb Jahren Fachseminare zum Online-Journalismus entwickelt. Die sind sehr wichtig, sehr beliebt, werden stark nachgefragt - wie beispielsweise „Texten für Online„, „Online-Recherche„ oder auch „Multimediales Erzählen„, „Web-Design„ und ähnliche Fachseminare. Bundesweit sind unsere Kollegen dankbar, dass wir das entwickelt haben. Jede Diskussion in Hamburg um Journalismus ist heute prinzipiell eine Diskussion um Online-Journalismus. Das ist das allerwichtigste zur Zeit, was wir diskutieren. Wenn wir dazu eine Veranstaltung
[Seite der Druckausg.: 45]
haben, ist das Haus richtig voll. Zusätzlich entwickelt die Akademie für Publizistik – das ist einmalig in Deutschland – einen Online-Kompaktkurs, einen vierwöchigen für Volontäre an Online-Medien. Das ist etwas ganz Neues. Darüber ist schon geschrieben worden. Wir werden im Februar konkret einsteigen.
Einige Verlage und Medienhäuser in Deutschland haben Volontärsstatuten entwickelt für ein zweijähriges Volontariat an Online-Medien. Diese Volontäre haben grundsätzlich einen Anspruch, einen Rechtsanspruch auf überbetriebliche Aus- und Fortbildung. Dieser Anspruch wurde Anfang der neunziger Jahre in einem Streik erzwungen, so dass alle unsere Volontäre heute in Deutschland, wenn sie einen Volontärsvertrag haben, den Anspruch darauf haben, eine einmonatige überbetriebliche Aus- und Fortbildung zu bekommen an den so genannten renommierten Akademien für Volontärsausbildung, klassisches Beispiele wären München und Hagen oder auch Hamburg.
Das ist als Reaktion auf die große Entwicklung in der Medienlandschaft, im Online-Journalismus unser Bemühen, einen Online-Volontärskurs zu konzipieren und zu verwirklichen. Den bieten wir dreimal im nächsten Jahr an. Wir sind diejenigen, die dies ausführen. Geschrieben wird sehr viel über alle möglichen Konzepte und Ideen und Möglichkeiten, wie man Konzepte und Ideen verwirklichen sollte, aber an der Akademie für Publizistik wird es tatsächlich gemacht. Ich möchte damit sagen, dass die Medienentwicklung natürlich stringente Auswirkungen auf die Journalistenaus- und –fortbildung hat.
Ein zweites Beispiel wäre die Digitalisierung in Hörfunk und Fernsehen. Wir haben in der Akademie für Publizistik mit Unterstützung von der ULR (Unabhängige Landesanstalt für das Rundfunkwesen, Schleswig-Holstein), der Medienstiftung in Hamburg und anderen ein digitalisiertes Hörfunkstudio aufgebaut. Die Journalisten, die Volontäre, die in diese vierwöchige Aus- und Fortbildung kommen lernen, ein Hörfunkmagazin und ein Fernsehmagazin zu produzieren. Das Hörfunkmagazin wird digital geschnitten. Es wird an Rechnern vorbereitet, geschnitten und dann mit den Kommentaren, der Reportage, den O-Tönen, mit Interviews versehen. Noch ein Beispiel dafür, wie die Journalistenaus- und -fortbildung reagiert.
[Seite der Druckausg.: 46]
Dann haben wir die Fachseminare. Insgesamt sind es inzwischen 40 bis 45 zwei- bis fünftägige Fachseminare für die Fortbildung. Ich möchte hier betonen: Die Fortbildung von Journalisten ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, wir sind als Gesellschaft dazu verpflichtet, Journalisten aus- und fortzubilden. Dagegen passiert genau das, was heute von Professor Pätzold und von anderen angesprochen wurde, dass die öffentliche Hand sich zurückzieht und sagt, das ist jetzt Aufgabe der privaten Unternehmen, wir als Staat haben dazu keine Verpflichtung mehr.
Wenn ich da klagen darf: Die beiden norddeutschen Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben sich im Lauf des Jahres 2000 aus der öffentlichen Förderung der Akademie für Publizistik herausgezogen, erst Niedersachsen Anfang des Jahres, und jetzt dramatisch vor wenigen Tagen auch Schleswig-Holstein. Es geht, bitte schön, um 26.000 Mark bei einem Haushalt von 2,2 bis 2,3 Millionen. Das war bisher der Beitrag aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen, der nun gestrichen ist. Und dann heißt es, wie es schon angesprochen wurde: Geht mal und sucht Euch ein Sponsoring. Und nun klopf´ mal an bei Bertelsmann, oder wo auch immer, das heißt Klingelbeutel, und nun mal los. Jetzt such´ mal die Sponsoren, die das abdecken. Der Staat zieht sich aus seiner Mitverantwortung für die Journalistenfortbildung zurück. Das macht er ganz konsequent. Ich kann es jetzt aktuell aus Hamburg berichten.
Natürlich haben wir mitbekommen, dass der Staat Nordrhein-Westfalen diese massive Summe an RTL gegeben hat. Das ist nicht an uns vorbeigegangen. Da stehen wir fassungslos. Aber die Politiker in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sagen uns: Es nützt nichts. In Niedersachsen müssen 230 Millionen Mark gespart werden, in Schleswig-Holstein sind es 70 Millionen Mark. Und Ihr seid „nice to have, but not necessary to have, as we say in American Controlling.„ Es ist zwar ganz nett, dass es Euch gibt, aber es ist nicht notwendig, dass es Euch gibt. Also werdet Ihr gestrichen.
Erstmals wird die Akademie für Publizistik im nächsten Jahr einen Volontärskurs auflegen, der nur für Volontäre an Privathörfunkstationen konzipiert wird. Das ist auch etwas Neues, weil die Nachfrage so stark ist, dass
[Seite der Druckausg.: 47]
wir unser Konzept ändern müssen, mit Inhalten für die spezifischen Interessen der Hörfunkstationen. Wir machen zwei Wochen Einführung in das journalistische Handwerk, zwei Wochen spezifische Ausbildung für die Anforderungen von Redakteuren an Hörfunk-, Privathörfunkstationen in Norddeutschland, also Radio Hamburg, Radio Schleswig-Holstein, Radio FFN und Ähnliche. Auch das ist eine Reaktion der Journalistenausbildung in Deutschland auf die Auswirkungen der Medienentwicklung.
Was die finanzielle und gesellschaftspolitische Situation betrifft, ist der Staat dabei sich rauszuziehen. Und ich werde gebeten, den Klingelbeutel groß zu machen, rauszugehen und überall bei der Wirtschaft anzuklopfen. Die Antwort ist dann oft: Ja, sag´ mal, für die Journalistenausbildung sind doch die großen Verlage zuständig, dann geht doch zum Staat, dann geht doch zur Bundesregierung hin, wo auch immer. Warum sollen wir aus der Wirtschaft etwas für die Journalistenausbildung tun? Da haben wir ein Dilemma. Uns steht das Wasser noch nicht bis zum Hals, aber doch ziemlich hoch. Herzlichen Dank. [Beifall]
Ulrike Helwerth
Danke, Herr Mielke. Frau Jochimsen.
Dr. Luc Jochimsen
Es ist ja sehr schön zu hören, was die Akademie alles für die journalistische Ausbildung tut. Dennoch finde ich, gerade in Bezug auf Digitalisierung als Stichwort, zumindest im Fernsehbereich ist doch zu sagen, die Qualität der journalistischen Arbeit der Zukunft definiert Sony und keine Akademie oder kein journalistischer Ethoskatalog. Denn wie sieht – ich beschränke mich im Moment auf ein Beispiel – im elektronischen Medium Fernsehen das Arbeiten in Zukunft aus?
Sie werden den so genannten Videoreporter haben. Wenn der zu Ihnen kommt, liebe Frau Griefahn, ist das eine Person, die leisten muss die Kameraarbeit, die Tonarbeit, den Schnitt, die Fragestellung, die Recherche, die gesamte Darstellung des Stücks, was bisher im Medium Fernsehen ganz bewusst Teamarbeit war, in der es auch wirklich unterschiedliche Aufgaben
[Seite der Druckausg.: 48]
gab. Die Qualität der Bilder im Fernsehen, auch im Informationsbereich, in der schnellen, aktuellen Geschichte hatte ja einen bestimmten Qualitätsanspruch. Und deswegen sage ich, das definiert Sony. Sony sagt: Ihr bekommt eine digitale Kamera, die ist erstens so leicht, dass Ihr sie körperlich bewältigen könnt; sie hat zudem Lichtkorrekturen; sie hat ein eingebautes Mikrofon. Und es kommt diese eine Person, sei sie ein Mann oder eine Frau, sei sie im Schnellkurs bei Ihnen in der Akademie ausgebildet oder nicht.
Ich erlaube mir einfach zu sagen, dass der große Sprung der Qualität unabhängig ist von den Ausbildungsmöglichkeiten. Diese eine Person wird konditioniert, dieser Videoreporter oder diese Videoreporterin im Medium Fernsehen der Zukunft, Bereich Information, über das Kernstück öffentlicher Aufklärung und politischer Darstellung unserer gesellschaftlichen Zustände. Die wird konditioniert ganz schnell im Verlauf eines Tages, handwerklich fünf, sechs Tätigkeiten auszuüben und diese ganz zwangsläufig auf einem minimalen Standard. Und im Übrigen am nächsten Tag die neue Story zu machen.
Und wenn es ein paar Jahre weitergeht, wird ihr auch aufgetragen aus diesem einen Auftrag drei Stücke machen, vier Stücke zu machen, das eine 40 Sekunden, das andere 1:10, das nächste 1:30, die anderen nur noch 10 Sekunden, da nimmst Du nur noch den O-Ton des Politikers, anderthalb Sätze raus, und das machst Du so.
Parallel zu dieser Konditionierung der journalistischen Arbeit im elektronischen Medium Fernsehen gibt es die Rezeption des Publikums. Es ist bisher noch nicht das Stichwort gefallen, dass es bereits eine Art Sucht auf neue Informationen gibt und in verstärktem Maße geben wird. Was die Leute interessiert, ist eigentlich nur noch die neue Nachricht, die nicht mehr in Bezug gesetzt wird zu der Nachricht von gestern oder gar zur Nachricht von vorgestern oder von vor einem Monat. Damit geht der Bezug auf die Bedeutung der Nachricht verloren, auf das, was die Nachricht vermittelt. Es zählt nur die neue Information, die neue Nachricht von heute Früh, die von heute Nachmittag, die von heute Abend und morgen Früh wieder nur die neue. Das ist das journalistische Arbeiten im Massenfeld des elektronischen Mediums Fernsehen der Zukunft. Darüber müssen Sie diskutieren.
[Seite der Druckausg.: 49]
Und da bezweifle ich, ob und wieweit Schulung etwas bewirken kann. Was soll denn diese Person eigentlich noch alles leisten und bewältigen? Wie soll sie die notwendige Ruhe und Distanz haben, um zum Beispiel Recherche und agierendes journalistisches Arbeiten zu verknüpfen? Das korreliert mit den Ansprüchen, die wir mal hatten. [Beifall]
Dr. Martin Doerry
Zunächst zu Frau Jochimsen. Ich glaube, dass sich einfach Berufsbilder verändern und damit auch das Handwerk, was man lernen muss als junger Journalist. Sie mögen Recht haben, dass das zuweilen auf die Qualität schlägt. Ich wäre da nicht so pessimistisch. Aber die Zukunft wird das erweisen.
Ich wollte noch etwas sagen zu den Ausführungen von Herrn Mielke. Ich glaube, dass die Arbeit einer solchen Akademie wichtig und erfolgreich ist. Dennoch bin ich ein bisschen skeptisch, was die Bedeutung dieser journalistischen Aus- und Weiterbildung angeht. Ich will mich da ein wenig auf Distanz begeben.
Ich fange am besten mit einer kleinen Anekdote an. Als ich zum SPIEGEL kam Mitte der achtziger Jahre, hatte ich einen älteren Ressortleiter, einen ganz gestandenen Mann, der hat den Spruch geprägt: „Der Erste, der hier Bildungsurlaub beantragt oder Weiterbildung machen will, wird entlassen.„ Das ging als „running gag„ durch die Redaktion. Es hatte einen wahren Kern, nämlich ein abgrundtiefes Misstrauen in den Sinn solcher Veranstaltungen. Zugleich enthielt dieser Satz aber auch die Aufforderung an uns alle – und ich glaube, die gilt wirklich für jeden Journalisten heute und in Zukunft – die Aufforderung, dass man sich selbst um diese Dinge bemühen müsse, dass man also selbst sich die Informationen verschaffen muss – das gehört mit zum journalistischen Berufsbild–, die man braucht, um erfolgreich als Journalist zu arbeiten, um es gut und richtig zu machen.
Natürlich können einem solche Kurse helfen. Aber ich glaube dennoch, dass diese Vorstellung, die bei uns in Deutschland so verbreitet ist, dass alles in feste Regeln gegossen werden muss, alle Ausbildungen in bestimmten Katalogen festgehalten werden müssen in Punkten, die zu erfüllen sind,
[Seite der Druckausg.: 50]
dass Zertifikate angestrebt werden und all dies in Deutschland ohnehin überhand nimmt, ich glaube, dass wir Journalisten uns davon frei halten sollten.
Ich finde es ganz prima, dass das Berufsbild des Journalisten nicht geschützt, ist wie das des Politikers ja auch nicht. Frau Griefahn hat es gesagt. Ich finde es sehr gut, dass da Freiheit herrscht, dass es viele Quereinsteiger gibt, dass es viele erfolgreiche Journalisten gibt, die weder Volontäre waren noch irgendwelche anderen Ausbildungswege durchlaufen haben. Und umgekehrt kenne ich eine Reihe Journalisten, die Journalistenschulen absolviert haben und die dann zum SPIEGEL gekommen sind, denen mussten wir erst das Schreiben beibringen, weil sie tatsächlich einen so formal korrekten Stil gepflegt haben, dass man eigentlich nichts daran aussetzen konnte, er aber einfach sterbenslangweilig war.
Also wir dürfen uns da nicht die Illusion machen, dass diese journalistische Ausbildung nun lauter Superprofis in die Medien bringt, von denen wir alle dann prima objektiv informiert werden. Das ist kein Allheilmittel. Das kann funktionieren, es kann aber auch schief gehen. Und deswegen glaube ich, wir sollten so liberal bleiben, wie wir sind in Deutschland. Das heißt: Viele Wege führen zum Journalismus, auch Umwege. Zum Teil sind das ganz interessante Persönlichkeiten, die dann in den Medien Karriere machen oder jedenfalls interessante Informationen vermitteln können an die Leser, an die Zuschauer. Also dieser Liberalismus hat uns eigentlich bislang gut getan. Wir sollten daran festhalten. [Beifall]
Ulrike Helwerth
Danke, Herr Doerry. Ich weiß, Herr Mielke, dass Sie darauf reagieren wollten und dass das jetzt sicher der Anfang einer interessanten Diskussion wäre. Aber es wäre ungerecht gegenüber unserem zweiten Referenten, der mit seinem Beitrag schon wartet. Ich bitte deshalb um Verständnis, dass wir hier den ersten Teil abbrechen.
Ich danke Herrn Pätzold für seinen Input und bitte Herrn Dr. Otfried Jarren auf das Podium. Ich darf Sie kurz vorstellen. Herr Jarren ist Direktor des Instituts für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität
[Seite der Druckausg.: 51]
Zürich, Direktor von Swiss GIS (Swiss Centre for Studies of the Global Information Society, Centre of Competence) auch der Uni Zürich, und er ist Vorsitzender des Direktoriums des Hans-Bredow-Instituts für Rundfunk der Uni Hamburg.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juli 2001