

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
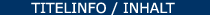
TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 7 ]
Dieter Birnbacher
Einführung
Fragen des würdigen Sterbens und der Sterbehilfe sind in unserer Gesellschaft seit längerem kein Tabu mehr. Dennoch hat sich an der nach wie vor beklagenswerten Situation Sterbender nur wenig geändert:
- Der Wunsch der meisten Menschen, zu Hause und in ihrer vertrauten Umgebung zu sterben, bleibt immer öfter unerfüllt. Immer mehr Bundesbürger, inzwischen etwa drei Viertel, sterben im Krankenhaus, u. a. weil sie im eigenen Haushalt nicht angemessen versorgt werden können. Erschwerend kommt hinzu, daß ein wachsender Anteil von Sterbenden ohne Angehörige ist oder die Angehörigen nicht in der Nähe leben. Anders als etwa in England sind Hospize und ambulante Hospizdienste in Deutschland noch nicht vollständig in das Gesundheitssystem integriert und sind durch den Leistungskatalog der Krankenkassen nur teilweise abgedeckt.
- Die Schmerzbehandlung Schwerkranker und Sterbender ist nach wie vor unzureichend. Johann-Christoph Student, Professor an der Evangelischen Fachhochschule Hannover, schätzt, daß 80 % aller deutschen Krebspatienten keine ausreichende Schmerzbehandlung erhalten. Noch immer gehört die Bundesrepublik bei der Verordnung von morphinhaltigen Schmerzmitteln im Vergleich mit anderen europäischen Ländern zu den Schlußlichtern.
- Vielfache Unzulänglichkeiten und Befangenheiten verhindern, daß mit den Betroffenen über Sterben und Tod einfühlsam, aber auch offen und realistisch gesprochen wird. Die Kommunikation über Tod und Sterben ist zwischen Ärzten und Patienten, Ärzten und Pflegenden, Patienten und Angehörigen systematisch gestört. Ärzte sind von ihrer Ausbildung und Aufgabe her zuallererst auf das Heilen ausgerichtet und nicht immer fähig oder willens, mit dem Sterbenskranken über sein bevorstehendes Sterben zu sprechen und ihn im Sterben zu begleiten.
- Dem zunehmenden Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben auch in der letzten Lebensphase steht keine entsprechende Bereitschaft der Behandelnden gegenüber, der Autonomie des Patienten Raum zu geben und die zu ihrer Entfaltung notwendigen Bedingungen zu schaffen. Der von dem früheren Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) betriebene Handel mit Zyankali wäre nicht möglich gewesen ohne die weit verbreitete Furcht vor einem fremdbestimmten Hinauszögern des Todes mit den Mitteln der modernen Medizin. Der schwer leidende Patient mit nachhaltigem und nachvollziehbaren Sterbewunsch kann nicht darauf hoffen, daß ihm die zu einer Lebensverkürzung notwendigen Mittel bereitgestellt werden. Viele Ärzte, die eine Beihilfe zum Patientensuizid oder eine aktive Sterbehilfe ablehnen und sich darauf berufen, daß der Wunsch danach von Patienten selten geäußert wird, übersehen, daß Patienten diesen Wunsch ernsthaft nur dann äußern, wenn sie eine Chance sehen, ihn auch gewährt zu bekommen. In den Niederlanden, wo eine von Ärzten ausgeführte aktive Sterbehilfe unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist, bitten 8 % der Krebskranken im letzten Stadium der Krankheit um (aktive) Sterbehilfe.
- Die Not vieler Sterbender ist unleugbar. Nach Einschätzung des niederländischen Anästhesisten Admiraal sind 5% der Krebspatienten auch mit einer optimalen Schmerzbehandlung nicht schmerzfrei zu halten. Angesichts dessen ist eine Diskussion um die Sui-
[Seite der Druckausg.: 8 ]
zidbeihilfe bzw. die aktive Sterbehilfe zumindest für Extremfälle auch hierzulande nicht zu umgehen. Bisher jedoch hat es die Politik an der ernsthaften Bereitschaft fehlen lassen, die gesellschaftliche Diskussion um die Sterbehilfe aufzugreifen und rechtspolitische Konsequenzen zu ziehen.
- Die Rechtslage zur Sterbehilfe in Deutschland läßt es an der nötigen Rechtssicherheit für Ärzte, Patienten und Angehörige fehlen und ist auch inhaltlich unzureichend. Das deutsche Strafrecht weist dabei das besondere Paradox auf, daß es einerseits die Beihilfe zum Suizid selbst in Fällen erlaubt, in denen der Suizid nicht auf eine freie und wohlinformierte Entscheidung des Suizidenten zurückgeht, daß es aber andererseits die Verhinderung des durch den Suizid eingetretenen Todes (d. h; die Wiederbelebung nach eingetretener Bewußtlosigkeit) von allen fordert, die - wie Ärzte und Angehörige - als "Garanten" für den Suizidenten in besonderer Weise verantwortlich sind. Auch wenn die Rechtsprechung mittlerweile dazu übergegangen ist, in Fällen eines "freiverantwortlichen" Suizids die Verpflichtung zum rettenden Eingreifen fallenzulassen, kann doch bis heute kein Arzt oder Angehöriger sicher sein, daß er sich durch die Nichtverhinderung eines Suizids nicht strafbar macht. Ähnlich paradox ist das rigide strafrechtliche Verbot der aktiven Sterbehilfe auf Verlangen des Patienten (als Tötung auf Verlangen) selbst in Fällen, in denen dies die einzig verbleibende Möglichkeit ist, einen Patienten ohne Aussicht auf Besserung seines Zustands vor weiteren unerträglichen Leiden zu bewahren. Der 1986 von einem Kreis von Professoren des Strafrechts und der Medizin vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe ("Alternativentwurf Sterbehilfe") hat hierzu weiterführende und diskutierenswerte Vorschläge gemacht, die zwar zunehmend in der Rechtsprechung aufgegriffen werden, jedoch ohne Einfluß auf Politik und Gesetzgebung geblieben sind.
Debatten über Sterbehilfe verlieren sich leicht in scholastischen Abstraktionen. Der im folgenden dokumentierte Workshop, zu dem die Friedrich-Ebert-Stiftung zusammen mit der Philosophisch-Politischen Akademie und dem Humanistischen Verband Deutschlands eingeladen haben, stellte dagegen die praktisch-politische Fragen deutlich in den Vordergrund. Deshalb waren neben Ethik (Johannes Gründel) und Recht (Hans-Georg Koch) vor allem Ärzte als Referenten gefragt, die - in unterschiedlichen Rollen - über praktische Erfahrungen mit dem Umgang mit Sterbenden verfügen. Auf diese Weise blieb die Diskussion nah bei den Problemen der Praxis, ohne freilich die ethischen Grundsatzfragen aus dem Blick zu verlieren.
Trotz der unübersehbaren Gegensätze in ethischen Ausgangspunkten und politischen Positionen zeichneten sich einige von allen Diskutanten gemeinsam getragene Voten ab:
- Im Bereich von Sterben und Sterbehilfe bedarf es klarer kollektiver Verbindlichkeiten, die zugleich Spielräume für persönliche Optionen eröffnen. Bei Ärzten, Patienten, potentiellen Patienten und Richtern bestehen rechtliche Unsicherheiten, die nach gesetzlicher Klarstellung verlangen. Demokratisch legitimierte rechtliche Regelungen sind bloß standesrechtlichen oder standesethischen Regelungen vorzuziehen. Die ärztliche Standesethik sollte ihrerseits die rechtlich eröffneten Spielräume nicht wieder beschneiden. Rechtliche Regelungen sollten dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten auch im Sterben Vorrang geben, ohne allerdings den Patienten zur Selbstbestimmung zu nötigen. Autonomie ist ein Recht und keine Pflicht. Das Individuum kann seine Entscheidungsvollmacht durchaus auch auf andere delegieren. Die individuellen Vorstellungen jedes einzelnen vom "richtigen" Sterben sind zu achten.
- Die Verbesserung der Kommunikation über Sterben und Sterbehilfe ist eine Zukunftsaufgabe für unsere politische und gesellschaftliche Kultur. Die wechselseitige Diffamierung der Gruppen und Verbände mit unterschiedlichen Vorstellungen von Sterbehilfe - wie die Hospizbewegung einerseits, die Deutsche Gesellschaft für Humanes
[Seite der Druckausg.: 9 ]
Sterben andererseits - schaden der gemeinsamen Sache und verdecken grundlegende Gemeinsamkeiten.
- Bei Ärzten und Patienten besteht Bedarf nach verbesserter Aufklärung über die Möglichkeiten der Schmerzbehandlung. Darüber hinaus sollte die Verschreibung von Schmerzmitteln weiter erleichtert werden. Nachdem einer ausreichenden Schmerztherapie lange Zeit unsinnige Ängste vor Suchtgefahren im Wege standen, sind es nunmehr Unkenntnis und die Erschwernisse im praktischen Umgang mit den für die Verschreibung von Morphinen notwendigen Rezeptformularen, die eine angemessene Schmerzbekämpfung verhindern. Hier sind weitere Erleichterungen angebracht. Der Sinn der gegenwärtigen Kontrollinstrumente (die Kontrolle der Formularanforderungen durch die Nachfolgebehörden des Bundesgesundheitsamts) ist ohnehin zweifelhaft, da die konkrete Anwendung der Formulare nicht im einzelnen überprüft wird.
- Es fehlt an empirischen Grundlagen für eine sachgemäße Diskussion. Der Status quo von Sterbebegleitung und Sterbehilfe ist unzureichend bekannt. Notwendig wäre ein deutsches Pendant zum niederländischen Remmelink Report, der erkennen läßt, unter welchen Bedingungen und in welcher Weise medizinische Behandlungen abgebrochen werden (passiv durch Unterlassen einer möglichen Weiterbehandlung oder aktiv durch Abstellen von Geräten), und in welchem Umfang Beihilfe zum Patientensuizid oder (in einer rechtlichen Grauzone) aktive Sterbehilfe geleistet wird.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Oktober 2000