

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
-
I Strategische Ansätze zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Frauen auf dem Arbeitsmarkt ( 1 )
- Die wirtschaftliche Diskriminierung von Frauen, deren gesellschaftliche Ursachen und ökonomische Folgen
Patrik Schellenbauer
- I. Einleitung: Die wirtschaftliche Stellung der Frauen im gesellschaftlichen Spannungsfeld
- II. Diskriminierungsbegriffe in der Ökonomie und in der Sozialwissenschaft
- III. Die Messung der ökonomischen Diskriminierung
- IV. Probleme bei der Messung der ökonomischenDiskriminierung
- V. Ökonomische Ansätze zur Erklärung von Diskriminierung
- VI. Persistenz von Diskriminierung durch negative Rückkoppelung
- VII. Implikationen für die Gleichstellungspolitik
- hier:
[Seite der Druckausg.: 29 = Zwischen-Titelblatt]
I Strategische Ansätze zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Frauen auf dem Arbeitsmarkt
[Seite der Druckausg.: 30 = Leerseite]
[Seite der Druckausg.: 31]
Dr. Patrik Schellenbauer
Technische Hochschule Zürich
Die wirtschaftliche Diskriminierung von Frauen, deren gesellschaftliche Ursachen und ökonomische Folgen
Der vorliegende Text ist eine leicht überarbeitete Version des Referates, das ich an der 4. Arbeitsmarktkonferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung und des Landesfrauenrates Thüringen am 07. Mai 1998 in Erfurt gehalten habe. Auch in der Schweiz ist das Thema Gleichstellung der Geschlechter ein Dauerbrenner auf der politischen Agenda. Dies mag nicht erstaunen, wenn man bedenkt, dass das Frauenstimmrecht in der Schweiz erst im Jahr 1971 eingeführt wurde, dies nach mehreren erfolglosen Versuchen. Es vergingen noch weitere 20 Jahre, bis die politische Gleichberechtigung der Frauen auch im letzten Kanton der Schweiz Tatsache wurde. Schlimmer noch: Der Kanton Appenzell-Innerhoden musste durch das höchste Gericht zu diesem Schritt gezwungen werden, nachdem die Appenzeller Männer dies mehrmals abgelehnt hatten.
Ich möchte aber nicht die Situation der Schweizer Frauen besprechen, sondern das Phänomen der Diskriminierung aus der Sicht der Ökonomie ganz allgemein beleuchten. Das Ziel meines Referates besteht also darin, Ihnen die Sichtweise und das Denken der Nationalökonomie zum Thema Diskriminierung von Frauen näherzubringen. Welches ist der ökonomische Diskriminierungsbegriff, wie erklären sich Ökonominnen und Ökonomen dieses Phänomen, welches sind die wirtschaftlichen Konsequenzen? Dies sind die Fragen, auf die ich eingehen möchte. Mein Referat ist folgendermaßen aufgebaut:
- Einleitung: Die wirtschaftliche Stellung der Frauen im gesellschaftlichen Spannungsfeld
- Diskriminierungsbegriffe in der Ökonomie und in der Sozialwissenschaft
- Die Messung der ökonomischen Diskriminierung
- Probleme bei der Messung der ökonomischen Diskriminierung
- Ökonomische Ansätze zur Erklärung von Diskriminierung
- Persistenz von Diskriminierung durch negative Rückkoppelung
- Implikationen für die Gleichstellungspolitik
- Einleitung: Die wirtschaftliche Stellung der Frauen im gesellschaftlichen Spannungsfeld
[Seite der Druckausg.: 32]
I. Einleitung: Die wirtschaftliche Stellung der Frauen im gesellschaftlichen Spannungsfeld
Frauen verdienen im Durchschnitt weniger als Männer. Diese unbestrittene empirische Tatsache galt und gilt quer durch verschiedene Wirtschaftssysteme und in verschiedenen Zeitperioden. Im europäischen Durchschnitt verdienen Frauen nur rund die Hälfte der Männer. Da die meisten Teilzeitstellen von Frauen besetzt werden, verringert sich diese Differenz auf rund 30 Prozent, wenn man die Monatsverdienste auf Stundenlöhne umlegt. Diese objektiven Fakten werden von niemandem ernsthaft bestritten.
An der Frage, wie die ungleiche Entlohnung von Männern und Frauen zu interpretieren sei, beginnen sich die Geister jedoch zu scheiden. Es gibt auf der einen Seite nach wie vor Meinungen, wonach die Lohndifferenz Ausdruck einer freiwilligen Spezialisierung der Frauen im nicht-marktlichen Bereich - sprich im Haushalt sei. Da sich Frauen stärker für Haushalt und Familie einsetzen, werden sie sich - so dieses Argument - weniger am Arbeitsmarkt orientieren und damit Stellen annehmen, die weniger Engagement erfordern, angenehmere Arbeitsbedingungen bieten oder mehr zeitliche Flexibilität erlauben. Auf dem Arbeitsmarkt müssen diese Stellenattribute in Form tieferer Stundenlöhne bezahlt werden. Dies hätte natürlich zur Konsequenz, dass die Gehaltsunter-
[Seite der Druckausg.: 33]
schiede nicht diskriminierend zustande kommen, da sie letztendlich auf Freiwilligkeit beruhen. Auf der anderen Seite der Meinungsskala wird die ganze beobachtete Lohndifferenz von 50 Prozent als diskriminierend betrachtet. Man geht hier davon aus, dass die Minderentlohnung der Frauen einerseits auf Geringschätzung der weiblichen Arbeitskräfte durch den Markt beruht, andererseits auf starren Rollenbildern und den entsprechenden gesellschaftlichen Sanktionen, wenn diese durchbrochen werden.
In der „Neuen Zürcher Zeitung" wurde kürzlich von einem Sozialwissenschaftler die Meinung vertreten, dass in einem funktionierenden und transparenten Arbeitsmarkt Diskriminierung nicht von Dauer sein könne, da diskriminierende Arbeitgeber höhere Kosten zu tragen hätten, wenn sie das produktive Potential der Frauen nicht oder zu wenig nützten, und daher langfristig aus dem Markt fielen. Die Lohndifferenz sei deshalb das Resultat freiwilliger Entscheidungen der Frauen. Das Echo auf diesen Beitrag füllte den Wirtschaftsteil und die Leserbriefspalte der Zeitung während Wochen. Das Spektrum der Voten reichte von entrüsteter Ablehnung bis zu unverhohlener Zustimmung. Auch wenn die ablehnenden Meinungen in der Mehrzahl waren, so zeigt dieses Beispiel doch deutlich, dass wir von einem gesellschaftlichen Konsens weit entfernt sind. Ich vermute, dass dies auch in Deutschland nicht anders ist. Es bringt uns aber auch zur Frage, was unter Diskriminierung denn genau zu verstehen ist.
II. Diskriminierungsbegriffe in der Ökonomie und in der Sozialwissenschaft
Von Einkommensdiskriminierung gegenüber Frauen spricht die Ökonomie dann, wenn bei gleichen produktivitätsrelevanten Merkmalen Frauen ein geringeres Einkommen erhalten als Männer, obwohl kein geschlechtsspezifischer Produktivitätsunterschied besteht, bzw. die Einkommenslücke bereits von diesem Produktivitätsunterschied bereinigt wurde. Die Lohnbildung beruht in diesem Fall u. a. auf einer Eigenschaft der Erwerbstätigen, die nicht produktivitätsrelevant ist, nämlich dem Geschlecht an sich.
[Seite der Druckausg.: 34]
Mit gutem Grund kann allerdings schon die Lohnlücke an sich als stoßend empfunden werden, auch wenn keine Diskriminierung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt schlüssig nachgewiesen werden kann. Man spricht dann von einer allgemeinen gesellschaftlichen Diskriminierung der Frauen. In diesem Fall führen gesellschaftliche und staatliche Regulierungen dazu, dass Frauen bei Eintritt in den Arbeitsmarkt und im Verlauf ihrer Erwerbskarriere weniger produktives Humankapital bilden können und darum schlechter entlohnt werden oder stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Die Grundfrage besteht also darin, ob die Gesellschaft und der Staat schon vor dem Eintritt in den Arbeitsmarkt die Weichen zum Nachteil der Frauen stellt, oder ob der Arbeitsmarkt selbst die Frauen diskriminiert. Diese Differenzierung zwischen marktlicher und gesellschaftlicher Diskriminierung ist keineswegs nur von akademischer Relevanz. Vielmehr ist die Kenntnis der Mechanismen zentral, wenn es um die Beurteilung von Frauenförderungsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt geht. So kann eine Politik, die einseitig von einem Versagen des Arbeitsmarktes ausgeht und darum in den Markt eingreift, leicht zu einem Boomerang für die Frauen werden. So würde z. B. ein generelles Anheben der Frauenlöhne mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass weniger Frauen angestellt werden. Andererseits nützen spezielle Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme wenig, wenn die Frauen von den Arbeitgebern von vielen Stellen ausgeschlossen werden.
III. Die Messung der ökonomischen Diskriminierung
Die Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich seit gut 40 Jahren mit dem Phänomen der Diskriminierung. Allerdings ist das Ausmaß der Diskriminierung im ökonomischen Sinn nach wie vor umstritten. Woran liegt dies? Wir haben gesehen, dass der Diskriminierungsbegriff bei der Produktivität ansetzt. Die Produktivität einer Person - verstanden als individueller Beitrag zur Wertschöpfung einer Unternehmung - ist aber meistens nicht direkt beobachtbar. Man versucht deshalb, die Produktivität einer Person mittels ihres Humankapitals zu beschreiben.
[Seite der Druckausg.: 35]
Das Humankapital umfasst alle Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, die auf dem Arbeitsmarkt wichtig sind. Analog dem physischen Kapital kann der Arbeitslohn als Zins verstanden werden, den man erhält, wenn man sein Humankapital einsetzt, d. h. erwerbstätig ist. Humankapital erwirbt man sich einerseits über die formale Schulbildung aber auch über Weiterbildung. Ein wesentlicher Bestandteil des Humankapitals besteht andererseits aus der Berufserfahrung sowie der Anstellungsdauer beim gleichen Arbeitgeber, also der Betriebszugehörigkeit. Es darf nämlich nicht vergessen werden, dass man sich während der Berufstätigkeit zentrale Kompetenzen und Kenntnisse aneignet und den Betrieb besser kennenlernt, wodurch die Produktivität ansteigt.
Das Standardverfahren in der volkswirtschaftlichen Forschung besteht darin, Lohnunterschiede mittels unterschiedlicher Ausstattung an Humankapital zu erklären. Als diskriminierend wird nun jener Teil des Lohnunterschiedes bezeichnet, der nicht durch eine unterschiedliche Humankapitalausstattung - und daraus abgeleitet - durch eine abweichende Produktivität erklärt werden kann. In der Regel erklären die Unterschiede in der Humankapitalausstattung rund 50 Prozent der Differenz der Stundenlöhne zwischen Männern und Frauen, die restlichen 50 Prozent bleiben unerklärt und werden darum diskriminierendem Verhalten seitens der Unternehmen zugeschrieben. Bezogen auf die eingangs erwähnte 30-prozentige Lohnlücke muss daraus der Schluss gezogen werden, dass den Frauen rund 15 Lohnprozente vorenthalten werden, die ihnen, gemessen an ihrer Produktivität, eigentlich zustünden. Sehen wir uns dazu ein Beispiel einer solchen Zerlegung der Lohnlücke genauer an. Es stammt aus einer Untersuchung, die Diekman und Engelhardt im Jahr 1994 für die Schweiz durchführten.
Wir sehen, dass die Bruttolohndifferenz von 43,1 Prozent auf 17,9 Prozent zurückgeht, wenn man die unterschiedliche Humankapitalausstattung sowie die tiefere Arbeitszeit der Frauen korrigiert. Interessant ist, dass die Ausbildung und die Berufserfahrung in etwa zu gleichen Teilen für die tiefere Entlohnung der Frauen verantwortlich ist. Hierin spiegelt sich die Tatsache, dass viele Frauen während der Familienphase Erwerbsunterbrüche einlegen und darum über weniger Berufserfahrung verfügen als die Männer. Ein weiterer, für die Frauen nachteiliger Effekt
[Seite der Druckausg.: 36]
besteht darin, dass Berufsunterbrüche das im Arbeitsmarkt relevante Humankapital effektiv vermindern, da man Kenntnisse verliert oder den Anschluss an neue Technologien verpasst. Berufsunterbrüche wurden in der präsentierten Studie nicht als separate Variablen berücksichtigt. Würde man dies tun, so würde sich die gemessene ökonomische Diskriminierung weiter verringern. Übrigens wirken sich Berufsunterbrüche bei Männern ebenfalls sehr nachteilig auf den Lohn aus.
Zerlegung der Einkommensdifferenzen zwischen Männern und Frauen nach Ausstattung und Diskriminierung für die Schweiz 1993
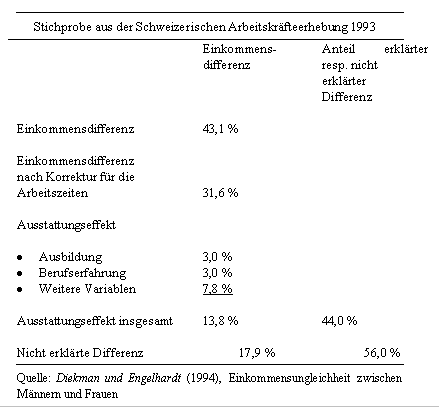
[Seite der Druckausg.: 37]
Hübler erhielt am Anfang der Neunziger Jahre eine Lohndiskriminierung von 10 - 20 Prozent der Männereinkommen für die alte BRD. Sehr interessante Erkenntnisse finden sich einem Beitrag von Pischke aus dem Jahr 1993.
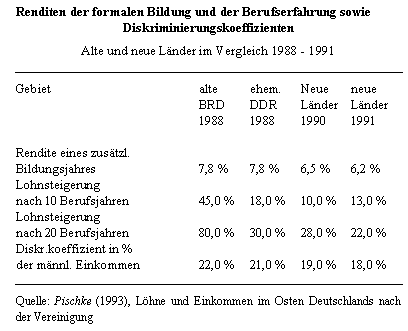
So konnte er zeigen, dass die Lohndiskriminierung in der BRD und der DDR mit 22 Prozent resp. 21 Prozent ein sehr ähnliches Ausmaß annahmen. Danach ist die Diskriminierung im Osten gesunken. Dies ist aber wahrscheinlich eine statistische Täuschung: Frauen waren stark überproportional vom Beschäftigungsabbau und der daraus entstehenden Arbeitslosigkeit betroffen. Es ist daher anzunehmen, dass vor allem schlecht gestellte Frauen nach der Vereinigung ihren Job verloren und somit aus der Stichprobe der Erwerbstätigen fielen. Die im Arbeitsmarkt verbliebenen Frauen stellen so - gemessen an ihrer Produktivität - eine positive Auswahl der Grundgesamtheit aller Frauen in den neuen Län-
[Seite der Druckausg.: 38]
dern dar, wodurch die gemessene Diskriminierung die effektive unterschätzt.
Weiter zeigte sich, dass die Renditen der formalen Schulbildung in der BRD und der DDR mit 7,8 Prozent pro zusätzlichem Bildungsjahr identisch waren. Nach der Vereinigung sanken die Bildungsrenditen in den neuen Ländern allerdings leicht, was sicherlich damit zu erklären ist, dass viele Ausbildungsgänge entwertet wurden. Einen markanten Unterschied sehen wir hingegen im Zeitprofil der Berufserfahrung. Während eine 10-jährige Berufserfahrung in der alten BRD zu einem Einkommensanstieg von 45 Prozent im Vergleich zu einem Berufsanfänger führte, betrug diese Differenz in der DDR lediglich 18 Prozent.
Mit Überraschung nimmt man zur Kenntnis, dass sich dieses Profil in den neuen Ländern in den Jahren 1990 und 1991 weiter verflacht hat. Dies ist sicherlich eine Folge des Anpassungsprozesses, der auf die Vereinigung folgte und eine erhebliche Neuorientierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verlangt. Sie müssen sich an völlig neue berufliche Anforderungen anpassen, neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt ausloten und somit viele Lernprozesse nochmals durchlaufen. Längerfristig gehe ich jedoch davon aus, dass das zeitliche Lohnprofil im Osten wesentlich steiler werden wird; für die Kohorten von Erwerbstätigen, die zur Zeit am Anfang ihrer Karriere stehen, wird die Berufserfahrung - neben Ausbildung und Weiterbildung - zu einer zentralen Lohndeterminante werden.
Daraus ergibt sich eine wichtige Politikimplikation für die Frauen in den neuen Ländern, die sie wahrscheinlich nicht überraschen wird. Es muss darauf hingewirkt werden, dass die jungen Frauen keinen oder einen möglichst kurzen Erwerbsunterbruch während der Familienphase einlegen. Die Förderung aller Angebote zur außerhäuslichen Kinderbetreuung - seien dies Krippen, Horte, Kindergärten oder Tagesfamilien - muss damit ein zentrales Element der Frauenförderungspolitik im Osten sein.
[Seite der Druckausg.: 39]
IV. Probleme bei der Messung der ökonomischen
Diskriminierung
Die auf der Humankapitalausstattung basierende Methode zur Aufdeckung von Lohndiskriminierung ist mit mehreren Problemen konfrontiert. So zeichnen die berücksichtigten Variablen nur ein stark vereinfachtes Abbild der wahren Produktivität. In der Regel erklären sie 20 - 40 Prozent der Varianz der Löhne. Natürlich kann man - sofern man über die entsprechenden Angaben verfügt - weitere Variablen berücksichtigen, um den Humankapitalbestand genauer zu beschreiben. Ein wichtiger Aspekt, den wir oben vernachlässigt haben, ist die Weiterbildung, sei sie unternehmensintern oder -extern. Vergleicht man verschiedene Untersuchungen zur Lohndiskriminierung von Frauen, so zeigt sich, dass die gemessene Diskriminierung der Frauen sinkt, je genauer ihr Humankapitalbestand beschrieben wird. Dies ergibt sich daraus, dass die Frauen in den zusätzlich berücksichtigten Aspekten des Humankapitals meist über tiefere Ausstattungen verfügen als die Männer. Damit sind wir gleich beim nächsten Problem dieser Methode.
Sie nimmt nämlich stillschweigend an, dass die geschlechtsspezifischen Humankapitalausstattungen das Resultat freiwilliger Entscheidungen sind. Es ist aber sehr wohl möglich, wenn nicht wahrscheinlich, dass die kürzere Berufserfahrung von Frauen zumindest teilweise das Resultat einer Benachteiligung ist. In Anlehnung an die oben skizzierte gesellschaftliche Diskriminierung müssen wir davon ausgehen, dass Berufsunterbrüche von Frauen nicht ausschließlich freiwilliger Natur sind, sondern die Folge von Normen bezüglich der Frauen- und Mutterrolle, fehlenden außerhäuslichen Betreuungsangeboten usw.. Daraus wird klar, dass die Berücksichtigung immer weiterer Humankapitalvariablen die gemessene Diskriminierung reduziert, indem sie potentielle gesellschaftliche Diskriminierungsquellen eliminiert. Der ausgewiesene Diskriminierungskoeffizient wird also systematisch nach unten verzerrt, wenn auch die sozialen Komponenten der Diskriminierung berücksichtigt werden sollen.
Das grundlegende wissenschaftstheoretische Problem besteht darin, dass die Methode nicht die Diskriminierung selbst misst, sondern die auf-
[Seite der Druckausg.: 40]
grund unterschiedlicher Produktivitäten erklärbaren Lohnunterschiede. Die Diskriminierung ist quasi das Residuum, d. h. der unerklärte Rest der Lohnlücke. Dies führt dazu, dass wir über die zugrunde liegenden Prozesse, die zur tieferen Entlohnung des Humankapital der Frauen führen, keinen Aufschluss erhalten. Im speziellen wissen wir nicht, ob die Diskriminierung direkter oder indirekter Natur ist.
Von direkter Diskriminierung spricht man, wenn Frauen an der gleichen Stelle für die gleiche Leistung weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Von indirekter Diskriminierung spricht man hingegen, wenn Frauen nicht denselben Zugang zu Stellen, Berufen, Branchen, Kaderfunktionen oder zum Arbeitsmarkt insgesamt haben wie Männer, obwohl sie ein gleichwertiges Humankapital besitzen. Daraus resultiert in den meisten Fällen eine tiefere Rendite ihres Humankapitals, und wir messen deshalb ebenfalls einen tieferen Lohn bei gegebenem Humankapital.
Ich gehe davon aus, dass ein großer Teil der lohnmäßigen Benachteiligung von Frauen auf diesem indirekten Weg zustande kommt. Einerseits arbeiten der typische Mann und die typische Frau in verschiedenen Berufsfeldern und Kaderfrauen sind eher die Ausnahme als die Regel. Wir beobachten eine ausgeprägte horizontale und vertikale Segmentation des Arbeitsmarktes in Bezug auf das Geschlecht. Von daher ist ein direkter Vergleich zwischen Männern und Frauen in denselben Stellen oft nicht möglich. Des Weiterem werden die Löhne in großen Unternehmen und dem öffentlichen Dienst meist durch stark formalisierte Gehaltssysteme festgelegt, die den Spielraum für die direkte Diskriminierung von Frauen begrenzen. Ich will nicht behaupten, dass die direkte Diskriminierung unbedeutend ist; ich messe der indirekten Benachteiligung von Frauen aber die größere Bedeutung zu. Die indirekte Diskriminierung ist eine wesentlich subtilere Form der Benachteiligung von Frauen; im konkreten Fall ist sie zudem oft schwierig zu entdecken und nachzuweisen.
[Seite der Druckausg.: 41]
V. Ökonomische Ansätze zur Erklärung von Diskriminierung
In der ökonomischen Theorie nahmen die Diskussionen um die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen ihren Anfang mit dem Buch „Economics of Discrimination" von Becker, das im Jahr 1957 erschien. Becker erweiterte die Arbeitsmarkttheorie insofern, als er den Unternehmen nicht nur Gewinnmaximierungsziele unterstellte, sondern auch die persönliche Nutzenmaximierung der Unternehmer berücksichtigte. Eine Diskriminierung einzelner Gruppen entsteht nun durch Vorurteile und Abneigungen, mit einer anderen Gruppe in sozialen Kontakt zu treten. Dieser „taste for discrimination", die Diskriminierungsneigung, kann von verschiedenen Individuen und Gruppen ausgehen. Für ein Unternehmen entsteht durch die Beschäftigung einer Frau ein Nachteil, etwa in Form eines schlechteren Betriebsklimas oder einer direkten Nutzeneinbuße des Unternehmers. Das Unternehmen ist daher nur zu einer Anstellung bereit, wenn es lediglich einen Lohnsatz zu zahlen braucht, der unter der individuellen Produktivität liegt.
Der Erklärungsgehalt dieser Theorie ist allerdings begrenzt. Um Diskriminierung als persistentes Phänomen erklären zu können, müsste man davon ausgehen, dass alle Unternehmen auf einem bestimmten Markt einen „taste for discrimination" haben. Sobald nur ein einziges Unternehmen ohne Diskrimininierungsneigung die Lohnunterschiede nutzt, um mit den billigeren Frauen kostengünstiger zu produzieren, wird der Wettbewerb dafür sorgen, dass die Diskriminierung verschwindet. Denn auch die Konkurrenten müssten ihre Preise nach unten korrigieren, um zu verhindern, dass die mit Frauen produzierenden Unternehmen Marktanteile gewinnen und die diskriminierenden und deshalb teurer produzierenden Unternehmen langfristig vom Markt verdrängen. Dazu müssen sie mehr billige Frauen einstellen, und die Nachfrage nach Frauenarbeit steigt. Dieser Prozess geht so lange, bis die Diskrimierung beseitigt ist, Männer und Frauen also aufgrund ihrer tatsächlichen Produktivitäten bezahlt werden. Diskriminierung kann in diesem Modell nur ein vorübergehendes Phänomen sein, wenn wirksamer Wettbewerb herrscht. Dies widerspricht der empirischen Evidenz klar. Beckers Intention war es indessen, zu zeigen, dass funktionierende Märkte die Tendenz haben, diskriminierende Unternehmen zu bestrafen.
[Seite der Druckausg.: 42]
In dem auf Barbara Bergman zurückgehenden Overcrowding-Ansatz werden die unterschiedlichen Knappheitsverhältnisse in vornehmlich von Männern oder Frauen besetzten Berufen für einen Teil der Lohnunterschiede verantwortlich gemacht. Diese unterschiedlichen Knappheiten entstehen durch die Strategie der Unternehmen, Frauen - basierend auf dem Präferenzmodell von Becker - den Zugang zu bestimmten Berufen zu verweigern. Die weiblichen Arbeitskräfte massieren sich deshalb in einer begrenzten Anzahl von Berufen oder Branchen. Dieses Überangebot führt zu einem Sinken des Lohnsatzes in den weiblich dominierten Berufen. Frauen erhalten daher nicht eine andere Entlohnung für die gleichen Arbeitsplätze wie Männer, sondern die Benachteiligung bezieht sich auf die schlechtere Bezahlung in anderen Berufen.
Gegen diesen Ansatz sprechen grundsätzlich die gleichen Einwände wie oben: Ein einzelnes Unternehmen, dass den Frauen den Zugang zu männlichen Berufen gewährt, kann sich Vorteile verschaffen, indem es billigere Arbeitskräfte erhält. Langfristig wird sich die beschriebene berufliche Segmentation daher aufweichen. In diesem Sinne ist das Overcrowding-Modell von Bergman lediglich eine Erweiterung des Diskriminierungsmodells von Becker, in dem sich die Benachteiligung der Frauen nur in einem verweigerten oder erschwerten Zugang zu bestimmten Berufen manifestiert. Es zeigt damit die Auswirkungen indirekter Diskriminierung, wie wir sie oben definiert haben.
Insgesamt können uns die beiden Ansätze von Becker und Bergman nicht befriedigen. Falls genügend Wettbewerb auf den Gütermärkten herrscht und die Marktkräfte damit stark genug sind, kann Diskriminierung nur ein vorübergehendes Phänomen sein und wird langfristig abgebaut. Dies kontrastiert mit der Tatsache, dass die Benachteiligung von Frauen anhält. Sollen wir nun daraus schließen, dass wir Marktunvollkommenheiten, wie z. B. Kartelle und Monopole abbauen müssen, um die Diskriminierung zu beseitigen? Auch wenn dies ein Schritt in die richtige Richtung wäre, ist es doch sehr zweifelhaft, ob dies allein die Situation der Frauen nachhaltig verbessern würde. Dies wussten wohl auch Becker und Bergmann. Trotzdem sind ihre einfachen Modelle mehr als nur weltfremde theoretische Konstrukte. Die Quintessenz besteht nämlich darin, dass eine Diskriminierung, die allein auf der Abneigung
[Seite der Druckausg.: 43]
gegenüber weiblichen Arbeitskräften beruht, sich mit zunehmender Konkurrenz auf den Märkten abbauen wird. Angesichts der Globalisierung der Weltwirtschaft ist dies von einiger Relevanz.
Neuere Ansätze haben einen wesentlichen Fortschritt gebracht, indem sie wirklich ökonomische Erklärungen für die Job-Diskriminierung von Frauen anbieten, ohne auf irgendwelche dubiosen Abneigungen gegen Frauen im Arbeitsmarkt Rückgriff zu nehmen. Im Zentrum dieser Ansätze steht die unvollständige und asymetrische Information zwischen potentiellen Vertragspartnern auf dem Arbeitsmarkt. Diese Ideen werden vor allem in der Theorie der statistischen Diskriminierung aufgenommen ,die auf Phelps (1972) und Arrow (1973) zurückgeht.
Die Unternehmen haben bezüglich der individuellen Produktivität von Stellenbewerbern und -bewerberinnen nur unvollkommene Angaben. Produktivität wird hier in einem weiteren Sinn verstanden und umfasst neben der direkten Arbeitsleistung auch die für die Zukunft erwartete Regelmäßigkeit, mit der die Arbeit geleistet wird, da Unregelmäßigkeiten mit höheren Kosten verbunden sind. Aufschlussreiche Tests über die Produktivität - man denke an das Einholen von Referenzen, psychologische Tests, graphologische Gutachten und ähnliches - sind sehr kostspielig. Für die Unternehmen lohnt es daher, die durchschnittliche Produktivität einzelner Gruppen von Arbeitsanbietern zu berücksichtigen. Anstelle der tatsächlichen individuellen Leistungsfähigkeiten treten repräsentative Eigenschaften einer Gruppe, von welchen auf die persönlichen Fähigkeiten der Gruppenmitglieder geschlossen wird.
Sind die Arbeitgeber aufgrund bisheriger Erfahrung davon überzeugt, dass Frauen durchschnittlich weniger produktiv sind als Männer, werden sie sich bei der Beurteilung einer einzelnen Frau an diesem Durchschnitt orientieren, auch wenn die einzelne Frau weit produktiver sein kann. Ökonomisch gesprochen suchen die Arbeitgeber nach einem möglichst billigen „Signal" für die Produktivität. Das Signal „Geschlecht" enthält im Durchschnitt tatsächlich verhaltensrelevante Informationen. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der erwarteten zukünftigen Betriebszugehörigkeit. Gerade für qualifizierte Stellen ist ein längerfristiges und stabiles Beschäftigungsverhältnis sehr wichtig. Nur unter dieser Voraus-
[Seite der Druckausg.: 44]
setzung wird ein Arbeitgeber in das spezifische Humankapital eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin investieren wollen. Unter spezifischem Humankapital verstehen wir Kenntnisse und Fähigkeiten, die nur in einem bestimmten Unternehmen produktiv eingesetzt werden können. Solche spezifischen Investitionen sind für viele Stellen in einem komplexen Umfeld unabdingbar. Sie reichen von einer langen, intensiven Einarbeitungsphase bis zu internen oder externen Weiterbildungskursen. Der Arbeitgeber wird diese Investitionen nur tätigen, wenn er davon ausgehen kann, dass er auch an den Erträgen in Form höherer Produktivität partizipiert. Gleiches gilt übrigens auch für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin.
Geht der Arbeitgeber nun bei jüngeren Frauen bis 35 Jahren davon aus, dass sie ihre Berufstätigkeit zugunsten einer Familie aufgeben oder unterbrechen werden, so wird er vor spezifischen Investitionen zurückschrecken. Es wurde verschiedentlich empirisch nachgewiesen, dass jüngere Frauen tatsächlich eine markant erhöhte Wahrscheinlichkeit aufweisen, eine Stelle zu kündigen. Im Endeffekt bedeutet dies, dass die Unternehmen bei internen Beförderungen und Neueinstellungen für qualifizierte Stellen vor allem Männer berücksichtigen werden.
Hinzu kommt, dass Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit nicht unterbrechen wollen, wenig Möglichkeiten haben, dies dem Arbeitgeber glaubhaft zu signalisieren. Im Englischen gibt es dafür den sehr treffenden Ausdruck „commitment", der auf Deutsch ungefähr soviel heißt, wie Verpflichtung. Konkret stehen die Frauen vor dem Problem, den Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass sie entweder keine Kinder wollen oder, falls sie Kinder bekommen werden, keinen längeren Berufsunterbruch planen. Ein explizites „commitment" bestünde z. B. in einem privatrechtlichen Vertrag, der im Falle einer Schwangerschaft eine Konventionalstrafe vorsieht. Solche Verträge sind - zumindest in der Schweiz - rechtlich nicht zulässig und daher nichtig. Abgesehen davon würden solche Kontrakte wohl von einer Mehrheit der Bevölkerung aus ethischen Gründen abgelehnt werden.
Bei älteren Frauen kann zwar nur eine leicht höhere Kündigungswahrscheinlichkeit nachgewiesen werden als bei den Männern. Bedenkt man
[Seite der Druckausg.: 45]
aber, dass die Karriereweichen heute im Alter von 30-40 Jahren gestellt werden, ist dies für die älteren Frauen ein schwacher Trost. Auch ihnen werden Kaderstellen oft verwehrt bleiben. Einerseits verfügen viele infolge der durchlaufenen Familienphase über ein tieferes Humankapital als die gleichaltrigen Männer. Andererseits sind die notwendigen Investitionen in spezifisches Humankapital in höherem Alter weniger lohnend, da die Zeit, während derer die Erträge der Investition anfallen, kürzer wird.
Der Mechanismus der statistischen Diskriminierung kann für Frauen, die eine lückenlose Erwerbskarriere planen, sehr entmutigend wirken. Viele fühlen sich mit Recht diskriminiert. Frauen, die dem statistischen Mittel entsprechen, werden nicht hingegen in diesem statistischen Sinne nicht diskriminiert.
Die statistische Diskriminierung wird wohl vor allem in eine indirekte Diskriminierung münden, da vielen karrierewilligen Frauen die Aufstiegsmöglichkeiten verwehrt werden. Es ist aber auch eine direkte Diskriminierung denkbar, wenn die Arbeitgeber etwa davon ausgehen, dass Frauen infolge der Mehrfachbelastung durch Haushalt, Kinder und Beruf weniger Engagement an der Arbeitsstelle aufbringen als Männer.
VI. Persistenz von Diskriminierung durch negative
Rückkoppelung
Die statistische Diskriminierung müsste sich an sich verringern oder mit der Zeit ganz verschwinden, wenn sich das durchschnittliche Verhalten der Frauen zugunsten von Erwerbsarbeit und vor allem in Richtung einer durchgehenden Erwerbskarriere verschiebt. Dies müsste die negativen Erwartungen der Arbeitgeber gegenüber den Frauen verändern. Weiter wäre zu erwarten, dass die Unternehmen das zugrunde liegende Informationsproblem besser lösen, als alle Frauen in einen Topf zu werfen. Es müsste ihnen nämlich mit der Zeit auffallen, dass viele Frauen ihrem Bild nicht entsprechen. Es gehen Ihnen damit viele fähige Frauen als potentielle Mitarbeiterinnen verloren, was letztendlich mit einem Ertragsverlust verbunden ist.
[Seite der Druckausg.: 46]
Dadurch entsteht an sich ein starker Anreiz, ihre Erwartungsbildung bezüglich der gegenwärtigen Produktivität und dem zukünftigen Verhalten zu verfeinern. Im Fachjargon der Ökonomie spricht man in diesem Zusammenhang von verbesserter Technologie der Signalextraktion. Dem steht aber die empirische Tatsache entgegen, dass die vertikale und horizontale Segmentation der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt beharrlich weiterbesteht. Gegeben, dass dies auf statistische Diskriminierung zurückzuführen ist, müssen wir schließen, dass sich diese entgegen unseren Erwartungen nicht aufweicht.
Man kann nun argumentieren, dass der Anreiz zu höherer Bildung respektive zum Eindringen in typisch männliche Berufsfelder dadurch beeinträchtigt wird, dass die Frauen die statistische Diskriminierung durch die Arbeitgeber antizipieren. In Erwartung zukünftiger Diskriminierung haben Frauen verminderte Anreize zur Investition in ihr Humankapital. Dies wiederum bewirkt, dass die Stabilität der Arbeitsbeziehungen von Frauen tatsächlich tiefer ist als jene der Männer, da sie aufgrund ihres tieferen Humankapitalbestandes im Arbeitsmarkt weniger verdienen und darum eher zugunsten der Familie ihren Beruf aufgeben. Arbeitskräfte in schlecht bezahlten Stellen haben zudem ein höheres Risiko, ihre Arbeit durch Entlassung zu verlieren. Dadurch fühlen sich die Arbeitgeber in ihren negativen Erwartungen bezüglich der Betriebstreue der Frauen sowie der Stabilität ihrer Arbeitsbeziehungen bestätigt. Weiter folgt, dass junge Frauen für ihre Berufswahlentscheidung weniger Vorbilder in Kaderpositionen oder in frauenuntypischen Berufen haben. Die Sozialpsychologie misst der Vorbildfunktion große Bedeutung bei. Fehlende Vorbilder erschweren es den Frauen also zusätzlich, mit Nachdruck in diese männlichen Domänen einzudringen. Auch die Sozialisierung zu einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der Familie ist in dieser Sicht gleichzeitig Ursache und Resultat dieser Wirkungskette.
Es sind natürlich weitere wechselseitige Effekte dieser Art denkbar. Gehen die Arbeitgeber von einem kleineren Engagement der Frauen in ihrem Beruf aus, da sie auch mit dem Haushalt und den Kindern belastet sind, werden viele Frauen statistisch diskriminiert. Dies wird vor allem bei Frauen, die sich an sich an ihrer Arbeitsstelle engagieren möchten, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Haushalt zementieren, da
[Seite der Druckausg.: 47]
sie tatsächlich weniger verdienen als ihre Partner. Letztere werden darum kaum mehr Haushaltsarbeit leisten und ihre Partnerinnen entlasten. Dies wiederum bestätigt die Erwartungen der Arbeitgeber, in diesem Fall auch bezüglich des höheren Einsatzes der Männer im Beruf. Gerade diejenigen Frauen, die eigentlich eine Pionierrolle als engagierte Berufsfrauen einnehmen könnten, werden so frustriert.
Dies sind Beispiele, die als negative Rückkoppelung bezeichnet werden, in der sich ökonomische, soziale und psychologische Faktoren wechselseitig bedingen oder sich gar verstärken. Ansätze dieser Art - d.h. die Verbindung von ökonomischen, sozialpsychologischen und institutionellen Modellen - werden in der ökonomischen Arbeitsmarktliteratur heute verstärkt diskutiert. Tatsächlich vermögen sie, die Persistenz der Diskriminierung und gleichzeitig die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Haushalt besser zu erklären als ökonomische Ansätze allein. Ihre empirische Umsetzung ist hingegen sehr schwierig und bis anhin haben die Modelle mit negativen Rückkoppelungen eher den Status einer pragmatischen, dafür sehr plausiblen Sicht der Welt, als den einer konzisen Theorie. Das Hauptproblem besteht darin, dass die Rückkoppelungen nur sehr schwierig beobachtbar und daher messbar sind. Ein stringentes empirisches Forschungsprogramm, das auf diesen umfassenden Ansätzen aufbaut, steht bis jetzt noch aus.
VII. Implikationen für die Gleichstellungspolitik
Die Wirkung von verschiedenen Gleichstellungspolitiken hängt wesentlich vom korrekten zugrunde liegenden Modell des Arbeitsmarktes und den gesellschaftlichen Einflüssen ab. Liegt die Ursache der Diskriminierung vor allem im Arbeitsmarkt selbst, so sind korrigierende Eingriffe oder Regulierungen angezeigt. Ist die Benachteiligung von Frauen hingegen vor allem das Resultat von gesellschaftlichen Normen und Regulierungen zu Ungunsten der Frauen, können vorschnelle Markteingriffe kontraproduktiv sein. In diesem Fall müsste eine Gleichstellungspolitik die Verbesserung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vorantreiben. Im Falle von Rückkoppelungen ist es sicherlich angezeigt, in bei-
[Seite der Druckausg.: 48]
den Bereichen gleichzeitig einzugreifen, um den Teufelskreis zu Ungunsten der Frauen zu durchbrechen.
Ein kleines Beispiel mag dies zum Abschluss meiner Ausführungen verdeutlichen. In Skandinavien hat man den Mutterschaftsurlaub nach der Geburt eines Kindes in einen Elternurlaub umgestaltet. Der zweite Teil dieses Urlaubs kann wahlweise von der Frau oder vom Mann bezogen werden. Während der Absenz erfolgt eine volle Lohnfortzahlung. Die Idee dahinter ist klar: Wenn Arbeitgeber damit rechnen müssen, dass auch Männer ihre Arbeit bisweilen zugunsten der Familie unterbrechen, wird dies die statistische Diskriminierung gegenüber den Frauen vermindern.
Das Resultat dieser Politik bestand aber darin, dass zumeist die Frauen den ganzen Urlaub beanspruchten. Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass die Kosten des Unterbruchs in Form entgangener oder verspäteter Karrieresprünge für die Männer höher waren. Ein Elternurlaub muss deshalb so ausgestaltet sein, dass der zweite Teil zwingend vom Mann genommen werden muss. Tut er dies nicht, so verfällt die zweite Hälfte. Dies würde sicherlich dazu führen, dass ein Teil der Männer einen Berufsunterbruch einlegen würde. Gleichzeitig hätten diese Männer die Gelegenheit, sich mehr Kompetenz im Haushalt und im Umgang mit Kindern anzueignen. Dies würde tendentiell zu einer partnerschaftlicheren Aufteilung der Haushaltsarbeit führen und damit mehr Optionen für die Erwerbsarbeit beider Partner eröffnen. Ich denke aber, dass dies allein keine nennenswerten Effekte auf dem Arbeitsmarkt hätte. Zu kombinieren wären diese verbesserten staatlichen Rahmenbedingungen mit einer Maßnahme im Arbeitsmarkt, z. B. einer temporären Bevorzugung von Frauen bei Beförderungen und Neueinstellungen bei gleichen messbaren Qualifikationen.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Oktober 1999