

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
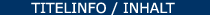
TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 17 ]
5.
Der Weltentwicklungsbericht '97:
„Der Staat in einer sich verändernden Welt"
Sanjay Pradhan präsentierte den Weltbankbericht mit Hilfe von Diagrammen und Grafiken, von denen einige im Text abgebildet sind. Pradhan gehört zum Team, das den Weltentwicklungsbericht 97 verfaßt hat. Er ist zudem der Leiter der Weltbank-Abteilung Öffentliche Verwaltung und Reformen in Osteuropa.
5.1. Der Vortrag von Sanjay Pradhan
„Staatliches Handeln und die Qualität dieses Handelns bewegt die Menschen in allen Teilen der Welt. Einige Regierungen haben ziemlich erfolgreich für eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung, der Bildungschancen und weniger Armut in einigen Teilen der Welt gearbeitet. Aber in vielen anderen Teilen war das Ergebnis staatlichen Handelns miserabel: Stagnierendes Wachstum, fortbestehende Armut, während der Zugang der Armen zur medizinischen Grundversorgung und zur Bildung unzulänglich blieb und die Korruption zügellos wucherte.
Vor kurzem haben wir uns aufgrund von vier weitreichenden globalen Entwicklungen noch einmal grundsätzlich mit der Frage der Rolle des Staates, und wie er diese Rolle am besten ausfüllt, auseinandergesetzt.
- Erstens gab es den Zusammenbruch der Kommando- und Kontrollwirtschaften in der früheren Sowjetunion und in Mittel- und Osteuropa, wo der Staat in allen Bereichen mitspielte.
- Zweitens gab es die andauernde Finanzkrise oder die neu entstandene Finanzkrise und damit die Forderung nach größerer Effizienz der Regierungen in den etablierten industrialisierten Volkswirtschaften der OECD-Länder.
- Drittens spielte der Staat eine wichtige Rolle in den leistungsstarken Ländern Ostasiens. Das gibt einem zu denken, worin denn eigentlich die Rolle des Staates besteht, wenn der Staat tatsächlich eine so wichtige Rolle in Ostasien gespielt hat.
- Und eine vierte weitreichende globale Entwicklung bestand im staatlichen Zusammenbruch, und damit einhergehend dem explosionsartigen Auftreten humanitärer Krisen in Teilen Afrikas, Osteuropas und einigen anderen Teilen der Welt.
Worin sich diese verschiedenen Entwicklungen weltweit, ihre Erfolge und Mißerfolge unterscheiden, ist: in der Leistungsfähigkeit des Staates.
|
Hinweis Das Foto der Druckausgabe (Seite 17) kann leider in der Online-Version nicht wiedergegeben werden. |
|
Sanjay Pradhan:„Ein leistungsfähiger Staat ist eine Grundvoraussetzung ..." |
Eine grundsätzliche Botschaft des Berichtes besteht deshalb vor allem darin, daß ein leistungsfähiger Staat eine Grundvoraussetzung für eine Versorgung mit
[Seite der Druckausg.: 18 ]
|
Ein leistungsfähiger Staat... |
Gütern, Dienstleistungen, für Regeln und Institutionen darstellt, damit die Märkte florieren und die Menschen gesünder und glücklicher leben. Davon abgesehen versucht diese zentrale Botschaft des Berichtes auch mit dem Mißverständnis aufzuräumen, das noch immer bei bestimmten Stellen in einigen Entwicklungsländern besteht, daß sich nämlich die Weltbank den Abbau des Staates auf ihre Fahnen geschrieben habe. Wir sind im Gegenteil der Meinung, daß ein leistungsfähiger Staat noch immer dringend notwendig ist, um wirtschaftliche und soziale Entwicklungen zu fördern. Wir treten dafür ein, daß selbst eine Entwicklung, die sich auf die Kräfte des Marktes verläßt und entsprechend ausgerichtet ist und die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, leistungsfähige staatliche Institutionen voraussetzt. Ein leistungsfähiger Staat ist immer der Grundpfeiler jeder erfolgreichen Volkswirtschaft gewesen.
|
... ist lebenswichtig für wirtschaftliche und soziale Entwicklung |
Jetzt werden Sie mir vielleicht vorhalten, daß man dasselbe schon vor fünfzig Jahren erzählt hat. Was ist also anders? Der Unterschied ist, daß man, als man vor fünfzig Jahren von der wichtigen Rolle des Staates gesprochen hat, damit meistens meinte, daß der Staat selbst die Entwicklung herbeiführen muß. Aber inzwischen haben wir dazugelernt. Der Staat spielt noch immer eine wichtige Rolle bei der Förderung wirtschaftlicher und sozialer Entwicklungen, aber heutzutage eher als Vermittler, als Katalysator, als Motor. Ein leistungsfähiger Staat fördert jene, die Motor der Entwicklung sind und unterstützt die Initiativen privater Märkte, von Einzelpersonen, NRO und Zivilgesellschaften, anstatt sie zu ergänzen. Märkte, die zivile Gesellschaft und staatliche Strukturen bilden heutzutage ein Ganzes, anstatt sich aneinander zu reiben. Das wäre eine der zentralen Botschaften, um die es uns geht.
Natürlich unterscheiden sich die Kriterien für das, was einen leistungsfähigen Staat ausmacht, je nach Land und Entwicklungsstand. Wir treten jedoch massiv für eine zweiteilige Strategie ein, wenn man die Leistungsfähigkeit des Staates steigern will:
Der erste Teil dieser Strategie geht davon aus, daß Länder mit begrenzten institutionellen Kapazitäten sich zunächst auf die Versorgung mit diesen notwendigen kollektiven öffentlichen Maßnahmen und öffentlichen Gutem konzentrieren sollten, die sowohl die Märkte wie auch die zivilen Gesellschaften nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang bieten können.
Der zweite Teil der Strategie besagt, daß Kapazitäten kein unabänderliches Schicksal sein müssen. Selbst Länder mit begrenzten institutionellen Kapazitäten können diese verbessern, indem sie Anreize schaffen und Politiker dazu bringen, im öffentlichen Interesse zu handeln; sie sollten gleichzeitig Kontrollmechanismen einführen, um willkürliche und korrupte Regierungsmaßnahmen einzuschränken.
|
Der Staat kontrolliert mehr als die Hälfte des Sozialproduktes weltweit |
Lassen Sie mich jedoch zunächst empirisch mit einigen Daten belegen, warum die Leistungsfähigkeit des Staates und der staatlichen Institutionen so wichtig ist:
Das ganze vergangene Jahrhundert lang erwarteten die Menschen von den Regierungen, daß sie sich mehr einmischen, mehr Geld ausgeben. Der Regierungsapparat hat sich infolgedessen in den entwickelten Ländern enorm ausgeweitet. Wir stellen fest, daß der Regierungsapparat in den entwickelten Ländern im Zeitraum zwischen 1870 und 1995 - für den uns Daten über die Situation in den entwickelten Ländern vorliegen - um das fünffache gewachsen ist. Und seit 1960 hat er sich verdoppelt, seit 1960, und zwar größtenteils durch Transferzahlungen und Subventionen. Der Gesamtumfang des Bruttosozialprodukts der Weltwirtschaft beträgt ungefähr 21 Billionen Dollar, von denen ungefähr 12 bis
[Seite der Druckausg.: 19 ]
13 Billionen Dollar durch die Hände des Staates gehen. Soweit das Gerede über den kaum noch präsenten Staat: Der Staat lebt und es geht ihm gut.
|
Trendwende in den 80er Jahren |
Aber selbst wenn wir uns nun die Situation in den Entwicklungsländern anschauen, stellen wir fest, daß auch dort die Regierungsapparate zwischen 1960 und 1985 rapide gewachsen sind. Dies spiegelt die vorherrschende Entwicklungsstrategie der Zeit nach der Unabhängigkeit in vielen Entwicklungsländern wider, als dem Staat eine führende Rolle in der Entwicklung zugedacht war. Erst in den 80er Jahren, angesichts von Finanzkrisen und einem aufkeimenden Unbehagen über die Dominanz des Staates in der Entwicklungsstrategie, begannen einige, diese aktivistische Rolle des Staates abzulehnen und weniger Staat zu fordern. Und mit den Sparprogrammen begannen die Staatsausgaben langsam zu schrumpfen.
|
Leistungsfähigkeit staatlicher Institutionen bestimmt Wirtschaftswachstum mit |
Um zu belegen, daß letzten Endes die Leistungsfähigkeit des Staates und nicht die Größe des Staatsapparates zählt, zogen wir Daten aus 94 Ländern über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten heran. Bei dieser Art von Analyse messen wir die institutionelle Kapazität der Regierung auf der Grundlage von Antworten von Investoren auf Fragen über Sicherheit und Eigentumsrechte, über die Art der bürokratischen Hemmnisse, über die Qualität des ordnungspolitischen Rahmens. Und wir stellten fest, daß die Meinungen hierzu nicht nur in den 80er Jahren einhellig waren. Es ist nicht nur eine Frage guter Politik und menschlicher Ressourcen, ob Länder höheres oder geringeres Wachstum haben. Es geht dabei auch um die institutionelle Qualität des betreffenden Staates, die erklärt, warum das System staatlicher Institutionen oder die institutionelle Kapazität des Staates zu höherem Wachstum beiträgt.
|
Investitionshemmnisse: politische Verwerfungen ... |
Wenn man sich wegbewegt von starken politischen Verwerfungen zu geringeren Verwerfungen, führt dies zu höherem Wachstum. Wenn man beides zusammen bringt und noch verstärkt durch verbesserte Verwaltungskapazitäten, erreicht man noch höhere Wachstumsraten. Und in diesem Zusammenhang erscheint es wichtig, sich noch einmal die Betonung marktfreundlicher Politik in den 80er Jahren vor Augen zu führen - warum war sie richtig? Weil sie versuchte, die wirtschaftlichen Verwerfungen zu minimieren, die ein tieferes zugrundeliegendes Problem verschleierten.
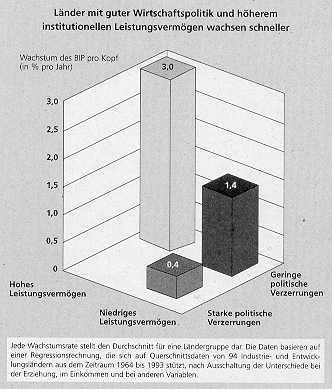
Viele Entwicklungsländer besaßen nicht die notwendigen institutionellen Fundamente in der Form von Sicherheit oder Eigentumsrechten, einer vertrauenswürdigen Rechtsprechung oder Kontrollmechanismen gegen die willkürliche Ausübung staatlicher Macht. Zur Diskussion steht also nicht nur, daß wir eine marktfreundliche Politik verfolgen, sondern uns auch Gedanken darüber machen müssen, wie wir die Kapazität staatlicher Institutionen verbessern können.
Um dem noch in weiteren Einzelheiten nachzuspüren, gaben wir uns nicht zufrieden mit einem Gesamtüberblick über 94 Länder. Wir wollten einen Überblick, der auch detailliertere Aufschlüsse ermöglichte. Und deshalb gaben wir zum ersten Mal eine Untersuchung in Auftrag, die insgesamt 3.600 Unternehmer in 69 Län-
[Seite der Druckausg.: 20 ]
dern umfaßte. Und um diese Variable der institutionellen Kapazität analysieren zu können, entschieden wir uns für die folgenden Fragen: Was sind die Haupthindernisse bei geschäftlichen Aktivitäten? Was sind die Schwachpunkte in den Kapazitäten der Verwaltungsinstitutionen, die privaten Investitionen und Wachstum im Wege stehen? Und die Ergebnisse waren wirklich auffallend.
|
... unberechenbare Gesetzesänderungen, unzuverlässige Rechtsprechung... |
Man stellt fest, daß die Unternehmer die Unberechenbarkeit gesetzlicher Änderungen als eines der Haupthindernisse anführten. Noch schlimmer stellt sich das Problem in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), Schwarzafrika, Lateinamerika und Mittel- und Osteuropa dar. Willkürliche Änderungen der Gesetze und der politischen Bedingungen in diesen Ländern sind also ein wesentliches Abschreckungsmittel gegen private Investitionen.
Ein weiteres von ihnen aufgelistetes Hindernis ist auch bemerkenswert. 70 Prozent der Befragten gaben an, daß sie kein Vertrauen in die Strafverfolgung oder die Unabhängigkeit oder Zuverlässigkeit der Gerichtsbarkeit hätten.
|
...sowie Kriminalität und Korruption. |
Ein drittes Ergebnis, was uns überraschte, war die Antwort von 80 Prozent der Befragten, insbesondere in den vier obengenannten Regionen, die angaben, daß Diebstahl und Kriminalität für sie ernsthafte Probleme darstellten. Wenn Kriminalität und Diebstahl des persönlichen Eigentums ernsthafte Probleme darstellen - dann ist auch das ein ernsthaftes Hindernis für geschäftliche Aktivitäten.
Und schließlich, aber nicht weniger wichtig, wurde die Korruption als viertes Hauptproblem im Geschäftsleben angegeben. Bei 40 Prozent der Unternehmer in den Entwicklungsländern werden Bestechungsgelder als etwas Selbstverständliches erwartet. Und das schreckt wiederum private Investitionen und Wachstum erheblich ab.
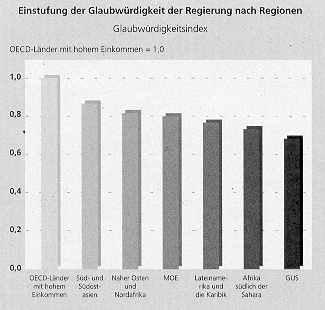
Wir haben alle diese Hemmnisse zusammengestellt und daraus einen Vertrauensindex geschaffen. Er besteht einfach aus diesen vier Indikatoren. Wir stellten dabei fest, daß es in allen Teilen und in allen Regionen dieser Welt Vertrauenskrisen gibt. Aber besonders deutlich zeigten sie sich wieder in der früheren Sowjetunion und in Afrika. Wirklich erstaunlich ist jedoch, wie wichtig Vertrauen für die wirtschaftliche Leistung zu sein scheint. Wir haben also nochmals statistische Analysen aus verschiedenen Ländern über einen sehr langen Zeitraum herangezogen, um zu sehen, wie wichtig Vertrauen ist, dieser Vertrauensindikator, der sich aus den verschiedenen angesprochenen Variablen zusammensetzt, was er für Investitionen und Wachstum bedeutet.
|
Verläßliche staatliche Institutionen sind wichtig für wirtschaftliches Wachstum |
Was dabei herauskommt, ist folgendes: Selbst wenn man einmal Einkommen und menschliche Ressourcen aus der Gleichung herausläßt, verzeichnen Länder, die auf der Vertrauensskala höher liegen, sehr viel bessere Investitionsraten und auch ein sehr viel höheres Wirtschaftswachstum. Wirklich auffällig ist aber, daß nur zwei Variablen, nämlich das Pro-Kopf-Einkommen und dieser Vertrauensindikator, 70 Prozent der Schwankungen des Investitionsumfangs zwischen einzelnen Ländern erklären. Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen und gut darüber nachdenken: So wichtig ist es also, sicherzustellen, daß Regie-
[Seite der Druckausg.: 21 ]
rungsinstitutionen Vertrauen wecken, Kontrollmechanismen einbauen und Willkürakte beschränken.
Wir haben uns übrigens nicht nur mit privaten Investitionen beschäftigt. Wir stellten darüber hinaus fest, daß Vertrauen auch sehr wichtig ist, um die höhere Rentabilität von Projekten der öffentlichen Hand zu erklären. Vertrauen ist also nicht nur für private Investitionen wichtig, es zählt auch bei der Versorgung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen.
|
Ohne verläßlichen Staat keine soziale Gerechtigkeit |
Wenn also Vertrauen und die Qualität staatlicher Institutionen so wichtig sind, was ist dann zu tun? Damit komme ich zurück auf die zweiteilige Strategie, die ich eingangs erwähnte. Der erste Teil der Strategie gilt für Länder, die in vielen Bereichen aktiv sind, aber deren Entwicklungsstrategie nicht klar ausgerichtet ist.
Die Aufgaben und die Kapazitäten von Institutionen unter einen Hut zu bringen bedeutet, sich zunächst auf jene kollektiven Maßnahmen zu konzentrieren, die die Märkte und die Zivilgesellschaft von sich aus nicht oder nur unzulänglich ergreifen. Das schließt gesetzliche Grundlagen ein, volkswirtschaftliche Stabilität, Investitionen in die medizinische Grundversorgung und in Grundschulerziehung, Schutz der Schwachen und Schutz der Umwelt. Das sind die Grundvoraussetzungen. Das wissen wir alle.
Aber wenn wir die Situation in vielen Ländern empirisch betrachten, stellen wir fest, daß die Regierungen eben nicht die Grundfundamente für Gesetz und Ordnung, die institutionellen Stützen geschaffen haben. Und sie schaffen noch nicht einmal die grundlegenden sozialen Fundamente. Um dies mit einem konkreten Beispiel zu untermauern: Wenn man sich Afrika und die Verteilung der Investitionen im Bildungsbereich dort anschaut, stellt man sozusagen fest, daß die reichsten 20 Prozent der Bevölkerung zu 25 bis 30 Prozent von dem Geld, was in Afrika für die Bildung in diesen Ländern zur Verfügung steht, profitieren, während den ärmsten 20 Prozent zwischen 10 und 15 Prozent zur Verfügung stehen. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, daß selbst im Bildungsbereich die Subventionen zugunsten der Reichen und nicht der Armen eingesetzt werden. Und wenn man sich auf die sozialen Fundamente konzentrieren möchte, setzt dies eine Verschiebung der Prioritäten in den Ausgaben der öffentlichen Hand zugunsten einer stärkeren Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialen Elemente voraus.
Grafik:
Der Weg zu einem effektiveren Staat
Lassen Sie mich nun auf den zweiten Teil der Strategie zu sprechen kommen, nämlich folgendes: Selbst wenn Regierungen ihre Aufgaben in Einklang bringen mit den Kapazitäten, wenn Länder mit schwachen institutionellen Kapazitäten sich auf die wirtschaftlichen und sozialen Grundpfeiler konzentrieren, selbst dann bleibt die Verbesserung ihrer institutionellen Kapazität, ihrer Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit wichtig, damit öffentliche Aufgaben besser erledigt werden können.
[Seite der Druckausg.: 22 ]
Zur Lösung des Problems haben wir drei allgemeine institutionelle Mechanismen vorgeschlagen, die einen Anreiz dafür schaffen können, daß Politiker und Bürokraten im öffentlichen Interesse arbeiten, und gleichzeitig ausreichende Kontrollen gegen staatliche Willkürakte und Korruption bestehen. Diese drei allgemeinen Mechanismen sind: Regeln und Beschränkungen, Mitspracherecht und Partnerschaften, was mit dem Thema dieser Arbeitstagung eng verwandt ist. Und der dritte ist Wettbewerb.
|
Regeln und Beschränkungen staatlichen Handelns |
Regeln und Beschränkungen der willkürlichen Ausübung von Macht durch den Staat und die Exekutive sind von grundlegender Bedeutung. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns als erstes mit der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit und der Strafverfolgung beschäftigt, da sie wiederum gegen eine willkürliche Ausübung staatlicher Macht schützen. Warum ist das so wichtig? In Ländern wie Malta, Polen, Ukraine, Pakistan stellen wir immer wieder fest, daß die Unabhängigkeit der Gerichte verletzt wurde. Wir stellen hierbei auch fest, daß eine Gewaltenteilung notwendig ist: Eine horizontale Trennung der Befugnisse der Gerichtsbarkeit, der Exekutive und der Legislative und eine vertikale Trennung der verschiedenen Regierungsebenen, zwischen der nationalen und subnationalen Regierungsebene, zum Schutz gegen willkürliche Machtausübung.
Aber wir stellen fest, daß in vielen Entwicklungsländern und Ländern im Übergang die Legislative schwach ist, weil es entweder eine zu dominante Exekutive gibt oder eine zu nachgiebige Legislative, oder weil die Legislative nicht die notwendigen Kapazitäten besitzt.
Wichtig ist dabei auch die Rolle unabhängiger Verfassungshüter, wie z.B. die unabhängige Anti-Korruptionskommission in Hongkong, die eine wesentliche Rolle im Kampf gegen die Korruption gespielt hat, wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen. Aber es dauert seine Zeit, bis diese zentralen Einrichtungen der Kontrolle, der gerichtlichen Unabhängigkeit und der Effektivität, der gesetzgeberischen Aufsicht geschaffen sind.
|
Auch externe Partner können in einer Übergangsphase Vertrauen schaffen |
In der Zwischenzeit schlagen wir für jene Länder, die unter Zeitdruck stehen, externe Mechanismen als Ersatz vor. Um ein Beispiel zu zitieren: Als Jamaika sein Telekommunikationsprogramm startete, hat es sich zunächst nur auf seine eigene Gerichtsbarkeit verlassen, die aber bei ausländischen Investoren als nicht vertrauenswürdig gilt. Später hat sich Jamaika dann stärker auf vertrauensschaffende externe Mechanismen verlassen. Ebenso signalisieren internationale Abkommen wie NAFTA oder die Europäische Gemeinschaft ein ausländischen Investitionen gegenüber aufgeschlossenes Klima. Das ist auch zum Teil die Erklärung dafür, daß der EU-Beitritt in vielen Ländern so ein heißes Thema ist.
|
Partnerschaft zwischen Staat und Zivilgesellschaft kann staatliche Leistungen verbessern helfen |
Lassen Sie mich zum zweiten Mechanismus kommen, der dem am nächsten kommt, was Sie hier auf der Tagung besprechen, nämlich Mitsprache und Partnerschaften. Dabei geht es uns darum, daß Kapazitäten des Staatsapparates entwickelt und gefördert werden können und damit eine Kontrolle über den Staat gewonnen wird, indem der Staat eine sehr viel engere Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft, den NRO und der Privatwirtschaft eingeht.
Wir konzentrieren uns zunächst auf die Demokratie. Demokratie demonstriert in kraftvoller Weise, wie Bürgerwillen zum Ausdruck gebracht werden kann. Und wir sehen, wie wirklich phänomenal sich die Demokratie ausgedehnt hat. 1974 waren 39 Länder demokratisch, was damals ein Viertel aller bestehenden Länder bedeutete. Heute sind 117 Länder Demokratien und damit zwei Drittel der Bevölkerung aller Länder. Wir vertreten also die Ansicht, daß ein demokratisches System offensichtlich den Bürgern das Recht einer gewissen Kontrolle zugesteht
[Seite der Druckausg.: 23 ]
und damit die Arbeit der Regierung beeinflußt. Wir sagen aber gleichzeitig, daß dies nicht der einzige Weg ist. Denn wenn man sich die empirischen Daten anschaut, findet sich nicht unbedingt eine Korrelation zwischen Demokratie und Wirtschaftswachstum.
|
Die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Kontrolle |
Wir untersuchen deshalb auch einige andere Mechanismen, die geeignet sind, die Zivilgesellschaft sowie öffentliche und private Unternehmen an der Gestaltung von Politik und bei staatlichen Aufgaben zu beteiligen. Zunächst müssen wir die Kongreßausschüsse in den großen industrialisierten Demokratien wie z.B. den Vereinigten Staaten nennen; dort werden die wesentlichen politischen Ziele vorgegeben, sie sind der zentrale Ort, wo Politik hinterfragt und debattiert wird. Aber wir weisen auch auf Mechanismen wie das amerikanische Verwaltungsgerichtsgesetz (US Administrative Procedures Act) aus dem Jahre 1948 hin, das Ankündigungen öffentlicher Projekte vorschreibt und den Bürgern, den NRO und anderen das Recht einräumt, politische Entscheidungen der Verwaltung vor Gericht anzufechten. Wir gehen auf die Beratungsgremien der Privatwirtschaft in Ostasien ein, die sich in Thailand, Singapur, Korea und anderen Ländern als sehr effektiv beim Austausch von Informationen erwiesen haben.
Aber wir schauen uns auch an, welche Rolle die intermediären Organisationen, die NRO und lokalen „community"-Initiativen spielen können, um den Armen und Schwachen, den Minderheiten und den Frauen ein Mitspracherecht im politikgestaltenden Prozeß zu verschaffen - übrigens in Kapitel 7, für jene unter Ihnen, die am Weltentwicklungsbericht interessiert sind. Und wir gehen näher auf einige Beispiele ein, wo dies praktiziert wurde - und zwar, um eine größere Partizipation zu erreichen, so daß der Staat besser reagiert, besser informiert ist und zur Rechenschaft gezogen werden kann. Wir beschäftigen uns auch damit, wie der Mitsprachemechanismus oder die Beteiligung der Zivilgesellschaft und anderer intermediärer Organisationen, der verschiedenen Formen der NRO und lokaler Initiativen einen Beitrag zur Verbesserung Öffentlicher Dienstleistungen leisten kann. Und damit kommen wir zu den Kernpunkten der Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor, die auf diesem Forum angesprochen wurden. Wir beschäftigen uns mit der Möglichkeit von gemeinsamen Maßnahmen oder eines gemeinsamen Angebots öffentlicher Dienstleistungen mit den Gemeinden, insbesondere bei lokalen öffentlichen Gütern.
Und lassen Sie mich ein Beispiel dafür zitieren, wie wichtig es sein kann, das öffentliche Dienstleistungsangebot zu verbessern. Wir haben die Ergebnisse ländlicher Wasserversorgungsprojekte in einigen Ländern verglichen. Es stellte sich dabei heraus, daß bei nur 8 Prozent der Länder, in denen die Nutznießer des Wasserprojektes in geringem Umfang an der Planung und Umsetzung beteiligt waren, die Projekte erfolgreich verlaufen sind, während 64 Prozent der Projekte mit hoher Verbraucherbeteiligung auch ein besseres Endergebnis aufwiesen.
|
Beteiligung der Öffentlichkeit kann die Erfolgschancen staatlichen Handelns steigern |
Darüber hinaus werfen wir auch einen Blick auf Bürgerrechtschartas und Klienten/Verbraucherbefragungen, die meiner Meinung nach einen sehr wichtigen Beitrag zur Beteiligung von NRO und ziviler Gesellschaft leisten und den Staat dazu zwingen, schneller, verantwortungsbewußter, effizienter und wirksamer öffentliche Aufgaben zu erfüllen. Bei Verbraucherbefragungen in Indien, Nicaragua, Uganda und sogar Tansania wurden die Verbraucher öffentlicher Dienstleistungen befragt. Wie beurteilen sie die Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen? Wie gut ist sie? Und diese Umfragen schlossen auch die Frage ein, wieviel Bestechung denn Verbraucher zahlen mußten, um überhaupt an Dienstleistungen heranzukommen, die ihnen zustanden. Das wurde übrigens auch in Indien von einer NRO namens „Public Affairs Centre" gemacht. Die NRO stellt
[Seite der Druckausg.: 24 ]
die Ergebnisse zusammen und veröffentlicht sie in einer Zeitung und wendet sich zur gleichen Zeit damit an die Regierung. Das hat - bei einer relativ freien Medienlandschaft - enormen Handlungsdruck bei den Verwaltungsbürokratien ausgelöst. Im Falle der Bangalore-Entwicklungsgesellschaft, die für den Wohnungsbau zuständig ist, hat es die Versorgungssituation merklich verbessert. Wir zitieren auch Fälle aus Recife in Brasilien zum Beispiel, wo diese gemeinsamen Maßnahmen von staatlichen Stellen und NRO zur Qualitätssteigerung beigetragen hat.
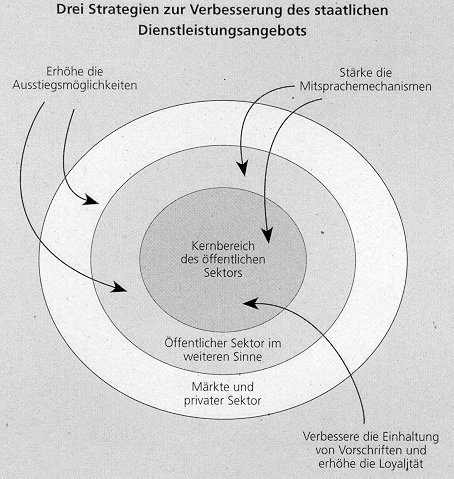
Im Zusammenhang mit der Mitsprache und Bürgerbeteiligung behandeln wir auch die Frage der Dezentralisierung von der nationalen zur sub-nationalen Regierungsebene, die immer mehr in den Vordergrund rückt. Besonders in Lateinamerika fällt auf, daß der Anteil öffentlicher Ausgaben auf der sub-nationalen Ebene im Vergleich zu den Gesamtausgaben in Argentinien, Brasilien, Kolumbien ganz schön gestiegen ist. Aufgrund der politischen Veränderungen kann man gleiches in Südafrika feststellen. Dies Phänomen greift also um sich und kann im Prinzip den Staat bürgernäher und die Versorgung mit Dienstleistungen auf lokaler Ebene transparenter und verbraucherfreundlicher machen. Die Beispiele - und mein Kollege Harald Fuhr, der sehr viel in diesem Bereich gearbeitet hat, kann dazu mehr sagen - beziehen sich auch auf Dinge wie die grundlegende soziale Infrastruktur in Argentinien, Entscheidungen über den öffentlichen Haushalt in Porto Alegre in Brasilien unter Beteiligung der Bürger, Grundschulerziehung in anderen Teilen Brasiliens. Es gibt also Beispiele von Dezentralisierung, die den Bürgern mehr Mitsprache und Beteiligung einräumen, die die Regierung bürgernäher werden läßt.
Wir möchten aber gleichzeitig auch darauf hinweisen, daß dies zwar Chancen, aber auch Risiken mit sich bringt. Ein Risiko liegt in der volkswirtschaftlichen Stabilität. Nehmen wir nur das Beispiel Chinas oder Brasiliens, wo sich zeigt, daß es im Zuge der Dezentralisierung zu Problemen der volkswirtschaftlichen Stabilität kommen kann. Ein regionales Ungleichgewicht ist ein weiteres Risiko der Dezentralisierung, wie das Beispiel Chinas beweist. Auch können lokale Interessen die Oberhand gewinnen, wie uns aus Polen berichtet wurde.
|
Wettbewerb unter staatlichen Einrichtungen |
Der dritte Mechanismus besteht darin, daß man mehr Wettbewerb bei der staatlichen Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen schafft. Auch das ist sehr wichtig in Bezug auf das Thema des Seminars. Das Problem bestand bisher darin, daß der Öffentliche Dienst eine Monopolstellung bei der Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen innehatte. Aber es gibt noch andere Formen und Möglichkeiten, wie diese Aufgaben erfüllt werden können. Man kann auf die Märkte in der Privatwirtschaft zurückgreifen. Ich schließe hier in den Begriff des Privatsektors die Gemeinden, die NRO und die Zivilgesellschaft ein. Oder man kann über den Öffentlichen Dienst hinaus auch allgemeine öffentliche Gesellschaften im größeren öffentlichen Rahmen mit diesen Aufgaben betrauen, da sie stärker ergebnisbezogen arbeiten und eine größere Flexibilität im Management besitzen.
[Seite der Druckausg.: 25 ]
Wenn man sich einmal die Reformen vor Augen führt, die in den fortschrittlichen OECD-Ländern durchgeführt werden und von denen Neuseeland, Australien und das Vereinigte Königreich wohl die markantesten Beispiele sind, haben sie alle eines gemeinsam: Sie sind so konzipiert, daß sie die Kommerzialisierung, Privatisierung und Auslagerung (contracting-out) des Leistungsangebotes vorantreiben und sogar Gesellschaften gründen, bei denen vor allem die Leistung zählt; damit fällt die Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen aus dem Öffentlichen Dienst heraus.
|
Staatliche Leistungen privatisieren... |
Aber was in Neuseeland funktioniert, muß nicht unbedingt in anderen Ländern auch funktionieren. Tatsächlich hängt die Möglichkeit zur Verbesserung des Leistungsangebots sowohl von der Beschaffenheit der Dienstleistungen wie auch von der Fähigkeit des Staates ab, externe oder interne Verträge abzuschließen. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Lassen Sie mich nur kurz erwähnen, daß uns empirisches Material vorliegt, das belegt, daß bei ausschreibungsfähigen Dienstleistungen - das heißt bei denen ein Markt geschaffen werden kann - ein besseres Ergebnis im Dienstleistungsangebot durch die Schaffung oder Stärkung der Märkte erzielt werden kann.
Beispiele hierzu: Telekom wegen der neuen Technologie im Telekombereich in Ghana, in Südafrika, Stromerzeugung auf den Philippinen und in Indonesien, oder selbst die externe Vergabe bestimmter Aufgaben, die staatlich kontrolliert werden können, wie Straßeninstandsetzung in Brasilien, durch die die Kosten für Instandsetzungsarbeiten um fast 25 Prozent reduziert wurden. Einfach zu beschreibende und zu kontrollierende Arbeiten wie im Straßenbau können also ohne Probleme an die Privatwirtschaft und die NRO vergeben werden. Aber selbst wo es nicht ganz so einfach ist, die durchzuführenden Aufgaben genau zu beschreiben, gibt es Regierungen, die die Schwächen ihrer institutionellen Kapazitäten erkannt haben und sich deshalb auf die NRO verlassen, die schon ihre Fähigkeit, Dienstleistungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen liefern zu können, unter Beweis gestellt haben: z.B. ist ein Teil der medizinischen Grundversorgung in Uganda einer NRO übertragen worden, und in Brasilien werden Aufgaben in der Sekundarerziehung ziemlich erfolgreich von einer lokalen Kirchenorganisation erledigt.
|
... aber nicht um jeden Preis |
Worum es aber letzten Endes geht: Was immer man auch den Marktkräften aussetzt, wie häufig man auch fest umschriebene Aufgaben entweder den NRO oder Privatfirmen überträgt, unter dem Strich werden immer einige zentrale Aufgaben übrigbleiben, die nicht einfach zu beschreiben sind, die sehr komplex sind, für die man noch immer eine motivierte professionelle Bürokratie, einen motivierten professionellen Öffentlichen Dienst braucht.
Auf dieses Thema möchte ich zu sprechen kommen, nämlich: Wie erhält man eine bessere Bürokratie? Wie schafft man einen leistungsfähigeren öffentlichen Sektor? Auch hierzu haben wir wieder eine Untersuchung machen lassen und stellten dabei fest, daß ein sehr wesentliches Element dabei in der Leistungsbezogenheit besteht: leistungsbezogene Einstellung und Beförderung. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die wir für ungefähr 30 Länder durchgeführt haben, wo wir fragten: In welchem Umfang spielt bei ihnen die Leistung eine Rolle bei der Einstellung und Beförderung? Und wieder stellen wir fest, daß, wenn andere Aspekte als konstant vorausgesetzt werden, eine stärkere Leistungsbezogenheit zu besseren Verwaltungskapazitäten führt, was die Verwaltungsarbeit entscheidend verbessern kann.
[Seite der Druckausg.: 26 ]
|
Verwaltungen motivieren und gut bezahlen |
Dazu ein konkretes Beispiel: wenn Sie sich den - nicht so positiven - Fall der Philippinen anschauen, ist dort die Besetzung von Stellen bis hinunter zum Amtsleiter stark von politischen Beziehungen abhängig. In anderen ostasiatischen Ländern wie Malaysia, Korea usw. betrifft dies nur einen Kernbereich, die anderen Stellen werden aufgrund leistungsbezogener Einstellung und Beförderung besetzt.
Aber damit nicht genug. Es ist auch wichtig, wieviel der Einzelne an Gehalt erhält. Und wir stellen fest, daß das Verhältnis zwischen dem Gehalt im öffentlichen und privaten Sektor auf den Philippinen nur 26 Prozent beträgt, während in anderen Ländern Ostasiens, wo das Verhältnis sehr viel höher liegt, die Verwaltung besser funktioniert. Diese zwei Faktoren zusammengenommen sind der Grund für die viel bessere Kapazität im Verwaltungsapparat in anderen Ländern Ostasiens im Vergleich zu den Philippinen. Es ist also wirklich wichtig, ein leistungsbezogenes Einstellungs- und Beförderungssystem und angemessene Bezahlung einzuführen, wenn man die Bürokratie leistungsfähiger machen will.
|
Gründe und Konsequenzen der Korruption |
Lassen Sie mich zum letzten Thema, der Korruption, kommen. Es war unsere Absicht, das Thema Korruption realistisch anzugehen und aufzuzeigen, daß es sich dabei um das Symptom tieferliegender Probleme handelt, das man mit konkreten politischen Maßnahmen lösen kann. Wir haben uns zunächst mit den Auswirkungen der Korruption beschäftigt. Wie sehen die negativen Auswirkungen der Korruption aus? Und wir griffen dabei auf unser Datenmaterial von der Befragung der Privatunternehmer zurück, wo wir gefragt hatten: Welche Art von Bestechung muß von ihnen gezahlt werden? Wieviel müssen sie an Bestechung zahlen? Und so weiter.
Dabei stellen wir erwartungsgemäß fest, daß viel Korruption mit weniger Investitionen einhergeht. Offensichtlich wirkt sich Korruption also negativ aus. Wenn man dies nun aber in einigen Teilen der Welt - besonders in Ostasien - so vorträgt, trifft das auf eine gewisse Ambivalenz oder Ungläubigkeit, denn es gibt in Ostasien einige Länder mit sehr viel Korruption, die aber trotzdem ein hohes Maß an Investitionen und Wachstum registrieren.
Die Frage ist: Wie läßt sich dieses Rätsel lösen? Wir haben uns dafür noch einmal die Frage der Berechenbarkeit der Korruption in unserer Befragung vorgenommen. Mit berechenbarer Korruption meinen wir: Wissen die Bürger im voraus, wieviel sie zahlen müssen? Und erhalten sie die Dienstleistungen so, wie sie es erwarten? Dabei stellt man fest, daß, ein gewisses Maß an Korruption vorausgesetzt, Länder mit einer besser berechenbaren Korruption, sowohl was den Zahlungsmodus wie die Ergebnisse anbetrifft, ein höheres Investitionsvolumen zu verzeichnen haben.
|
Auch ,berechenbare' Korruption bleibt schädlich |
Lassen Sie mich sofort hinzufügen, daß das nicht heißt, daß Korruption nicht schädlich ist. Denn wie genau auch immer das Ausmaß der Korruption vorauszuberechnen ist, kann das Investitionsniveau dadurch gesteigert werden, daß es weniger Korruption gibt. Korruption bleibt also schädlich. Es wird damit nur leichter und klingt weniger naiv, wenn man Korruption so bewertet, aber sie bleibt schädlich, denn sie unterminiert das Vertrauen in die Institutionen der Regierung und in die Zukunftsfähigkeit von Institutionen der Regierung.
Wenn die Korruption schädlich ist, was läßt sich tun, um die Korruption zu bekämpfen? Wir haben uns nochmals unser empirisches Material vorgenommen. Die Korruption gedeiht dort besonders gut, wo Kontrolleinrichtungen oder -mechanismen schwach sind.
[Seite der Druckausg.: 27 ]
Wir stellten fest, daß Länder mit einem stark verzerrten politischen Umfeld - was sich z.B. durch den Umfang vorgeschriebener Lizenzen und Quoten u.a. messen läßt, die den Ermessensspielraum der Politiker und Bürokraten erweitern - auch ein höheres Maß an Korruption aufweisen; das läßt darauf schließen, daß man deregulieren, die Steuerquote vereinfachen, mehr Wettbewerb einführen muß usw.
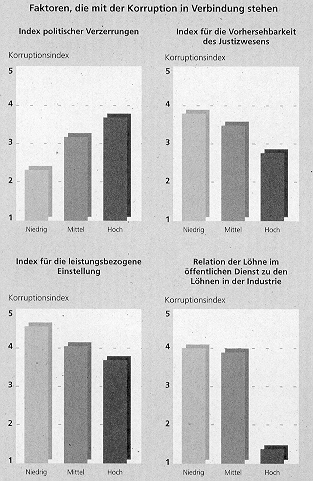
Wir stellen gleichzeitig fest, daß ein höheres Maß an Korruption auch in Ländern vorkommt, deren Gerichtsbarkeit wenig berechenbar ist, d.h. wo man hat keine Angst vor möglichen Strafen u.a. hat. Dann beschäftigen wir uns mit dem Öffentlichen Dienst, um zu sehen, wo die Korruption verursacht wird. Und wir stellen fest, daß bei relativ geringem Einkommen im Öffentlichen Dienst, im Vergleich zum produzierenden Gewerbe, das Ausmaß der Korruption größer ist. Auch dort, wo wenig leistungsbezogen gearbeitet wird, ist die Korruption größer, da sich die Bürokraten irgendwie der politischen Führung verpflichtet fühlen, die sie ins Amt gebracht hat.
Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, daß Korruption das Symptom eines tieferliegenden Problems darstellt, das mit konkreten Maßnahmen bekämpft werden kann. Man denke an Singapur und Hongkong in den 60er Jahren, als die Korruption dort weitverbreitet war. Sie bekämpften die Korruption dadurch, daß sie Verzerrungen im politischen Raum reduzierten und mehr Wettbewerb einführten, die Einkommen des Öffentlichen Dienstes erhöhten und stärker leistungsbezogen agierten.
Das ist alles ganz schön und gut. Aber wir wissen auch, daß in der realen Welt Reformen politisch sehr schwer durchzusetzen sind, weil es Verteilungskonflikte zwischen den Gewinnern und Verlierern geben wird.
|
Korruption mit politischen Reformen bekämpfen |
Um nur ein konkretes Beispiel zu erwähnen: Die dringend notwendige Rentenreform in den Vereinigten Staaten würde vor allem den mächtigen Gruppen nützen, die zufällig zur älteren Generation gehören. Das erklärt zum Teil, warum die Reform der Sozialversicherung und des Rentensystems in den Vereinigten Staaten solch eine schwierige Geschichte gewesen ist. Aber Reformen können auch durch ein falsches institutionelles Konzept erschwert werden; wenn sie viele wichtige Punkte des Wahl- und Parteiensystems betreffen, können sie auch schwer durchzuhalten sein.
Aber wir wissen, daß Reformen in Gang gesetzt und durchgehalten wurden. Wir stellen deshalb am Ende des Berichtes fest, daß es immer wieder neue Chancen für reformwillige Regierungen gibt, um diese Probleme anzugehen. Es kann sich dabei z.B. um eine neue Regierung handeln, wie in Kolumbien 1989, oder eine Wirtschaftskrise, die weitreichende Reformen des öffentlichen Sektors in Neuseeland und Australien in den frühen 80er Jahren nach sich zog, oder es könnte sich um eine Bedrohung von außen handeln, die zu den Reformen in Japan führte.
[Seite der Druckausg.: 28 ]
Wir weisen also auf diese Zukunftschancen hin, betonen aber gleichzeitig, daß es strategisch geplant werden muß.
|
Reformen brauchen Visionen |
Aber zum Schluß und keineswegs unbedeutend, ja vielleicht am wichtigsten von allen ist die Rolle der politischen Führung, die eine Vision haben und auf ansteckende Weise entschlossen sein sollte, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, eine Vision, die bei Gewinnern und Verlierern auf breite Zustimmung für die Einleitung und Umsetzung von Reformen stößt.
|
Hinweis Das Foto der Druckausgabe (Seite 28) kann leider in der Online-Version nicht wiedergegeben werden. |
Lassen Sie mich deshalb zum Abschluß die wesentlichen Elemente des Berichts wiederholen. Ein leistungsfähiger Staat ist eine Grundvoraussetzung für Entwicklung. Gute Regierungsführung („good government") ist kein Luxus, sondern absolute Notwendigkeit. Und um leistungsfähiger zu werden, schlagen wir eine zweiteilige Strategie vor. Zunächst die Aufgaben den Kapazitäten anpassen:
Länder mit schwachen institutionellen Kapazitäten sollten sich auf die sozialen, wirtschaftlichen und institutionellen Grundstrukturen konzentrieren. Zweitens: Kapazitäten verbessern, indem man Regeln und Beschränkungen, Mitsprache und Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft, den NRO, dem Privatsektor usw. einführt und indem man mehr Wettbewerb in der Verwaltung zuläßt."
(Übersetzung: Annette Brinkmann)
[Seite der Druckausg.: 29 ]
5.2.
Kommentare und Diskussion zum Weltbankbericht
Einleitend sei gesagt, daß die anschließende Diskussion um den und die Kritik an dem Weltbankbericht sich nicht nur an den Darstellungen von Pradhan orientierte. Insbesondere die Teilnehmer an der Podiumsrunde hatten Stellungnahmen vorbereitet, die sich am gesamten Weltentwicklungsbericht ausrichteten.
|
Der Staat muß mehr leisten, als Märkte zu organisieren |
Der Kritikpunkt, den Dr. Uschi Eid, MdB, ins Zentrum ihrer Überlegungen stellte, sei an dieser Stelle wörtlich zitiert:
„Der Bericht hebt meines Erachtens zu einseitig auf die Rolle des Staates bei der Rahmensetzung für die Entwicklung des Privatsektors ab. Nun ist zwar die Rahmensetzung für die Entwicklung privatwirtschaftlicher Initiative eine wichtige und notwendige, aber keineswegs hinreichende Aufgabe staatlichen Handelns. Der effektive Staat muß, gerade auch aus entwicklungspolitischer Sicht, durch den sozialen Staat und durch den demokratisch-partizipativen Staat ergänzt werden."
Anschließend zählte Eid fünf Aufgaben des modernen Staates auf, die ihrer Meinung nach im Weltbankbericht nicht ausreichend berücksichtigt worden sind.
|
Demokratisches Rechtswesen und globale Bekämpfung der Korruption |
I. „Eine zentrale Aufgabe staatlichen Handelns muß in der Sicherstellung eines demokratischen Rechts- und Justizwesens liegen". Gerade die Ereignisse in Ruanda hätten gezeigt, wie bedeutsam es sei, Täter juristisch zur Verantwortung ziehen zu können. Fehle diese Möglichkeit, dann fehle „die Basis für den Aufbau eines friedlichen Gemeinwesens, die auch die Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung ist".
II. Die Bekämpfung der Korruption bleibe essentiell. Sie habe sich zu einem weltweiten Problem ausgewachsen und müsse global angegangen werden. Die Initiative der OECD sei sehr begrüßenswert. Die deutsche Praxis, nach der im Ausland gezahlte Bestechungsgelder steuerlich geltend gemacht werden können, müsse ein Ende finden.
|
Effektives Steuersystem, soziale Grundsicherung, Dezentralisierung |
III. Eine vordringliche Aufgabe für schwache Staaten und die Entwicklungszusammenarbeit bleibe es, für den Aufbau gerechter und leistungsfähiger Steuersysteme zu sorgen. Nur so könnten diese sich aus der Abhängigkeit von finanziellen Transfers aus den Industrieländern befreien.
IV. „Der Staat im Norden, wie der Staat im Süden versagt derzeit an den Aufgaben, die Armut wirksam zu bekämpfen und eine soziale Grundsicherung zu gewährleisten". Diese Aufgaben dürften nicht „auf NRO und die Wohlfahrtsverbände abgeschoben werden". Die Bedeutung des 20:20 Beschlusses von Kopenhagen könne deshalb kaum unterschätzt werden.
V. „Ein starker Staat", so Eid abschließend, „ist ein dezentraler Staat". „So viele Entscheidungsbefugnisse wie möglich" müßten auf die unteren Ebenen verlagert werden. Dabei gelte es in der Entwicklungszusammenarbeit, die Bedeutung traditioneller Partizipationsformen „wiederzuentdecken". Gerade in einer Zeit, in der Entstaatlichung in aller Munde sei, sei es auch die Aufgabe der Entwicklungspolitik, „auf die unersetzbaren Funktionen und Aufgaben des Staates hinzuweisen".
[Seite der Druckausg.: 30 ]
Die kritischen Anmerkungen von Prof. Dr. Rainer Tetzlaff (Universität Hamburg) befaßten sich vornehmlich mit den Grundannahmen, auf denen der Weltbankbericht aufbaut.
|
Besitzt der Staat heute noch ausreichende Steuerungsfähigkeit? |
Vorweg stellte Tetzlaff die Frage, „wie die Welt unter zunehmenden Verweltlichungs-, Vergesellschaftungs- und Globalisierungsbedingungen überhaupt noch steuerbar ist". Es müsse festgestellt werden, daß die Steuerungskompetenzen der Staaten abnähmen, und insofern liege der Weltbankbericht „konträr zu dieser allgemeinen Problematik". Andererseits habe gerade das Beispiel Somalia gezeigt, wie unverzichtbar der Staat für Entwicklungsprozesse sei.
Entscheidender sei jedoch eine andere Schwäche des Weltbankberichtes. Zwar werde das Fernziel - ein entwickelter Staat mit Teilhabe am Weltmarkt - immer wieder von der Bank propagiert. Wie jedoch der Übergang dahin zu erreichen sei, werde wenig thematisiert. Über die Zielsetzung herrsche - auch mangels anderer Modelle - Einigkeit, doch die Zielkonflikte auf dem Weg dorthin müßten für jedes einzelne Land genauer beschrieben werden.
|
Unbearbeitete Zielkonflikte |
Tetzlaff zählte einen Komplex von Zielkonflikten auf, den er für die wirtschaftliche Entwicklung der Dritten Welt für entscheidend hält: Die Ernährungssicherung beeinträchtige die internationale Kreditwürdigkeit, ein Politikziel, daß zudem zum Raubbau an den natürlichen Ressourcen verleite. Außerdem konkurriere der Aufbau einer weltmarktfähigen Industrie mit den Notwendigkeiten der sozialen Grundversorgung um die knappen staatlichen Mittel. Der Weltentwicklungsbericht stelle die verschiedenen Ziele nur additiv nebeneinander, ein „Handlungskorridor" werde nicht hinreichend ausgelotet.
Darüber hinaus mache die Weltbank den Eliten der Entwicklungsländer kein Angebot, das attraktiv sei. Die Konditionalisierung der Entwicklungshilfe reiche nicht aus, da die betreffenden Gruppen von „politischen Renten" lebten und nicht auf Transfers aus dem Norden angewiesen seien, ja diese oft gar nicht wünschten. Hier spiele sich eine „Entgrenzung" ab, eine Internationalisierung von Interessenlagen, die als Bestandteil der Globalisierung aufgefaßt werden müsse. Damit verliere das „eiserne Dreieck für Strukturreformen", nämlich lokaler Staat, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft, zwar nicht seine Gültigkeit, es treffe aber den Sachverhalt nicht mehr.
|
Welche Beziehungen bestehen zwischen Staat und informellem Sektor? |
Auch die Beziehungen zwischen dem Staat und dem informellen Sektor sah Tetzlaff im Weltentwicklungsbericht 1997 als nicht ausreichend durchgearbeitet an. Genau wie die Eliten auch, sei die informell wirtschaftende Bevölkerung einer Logik ausgesetzt, die mit dem herkömmlichen Nationalstaat nur mehr wenig zu tun habe. Wie zum Beispiel die Bewältigung der Sicherheit auf den großen Märkten in den Städten organisiert werde, zeige, daß hier „rechtsfreie Räume" entstünden, in denen der Staat keine Steuerungsfähigkeit mehr besitze. Tetzlaff schloß seinen Gedankengang zusammenfassend:
„Der politische Wille ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Aber wir müssen uns klar sein, der lokale Staat erreicht seine eigenen Bürger immer weniger. Wir müssen Verregelungen finden - über die nationalen Regierungen des Tages hinaus. Also muß auch über die Erfahrungen mit der politischen Konditionalität neu nachgedacht werden."
Das Statement von Prof. Dr. Hans-Gert Braun (Chefökonom der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) umfaßte eine ganze Reihe gedanklicher Skizzen, von denen hier nur einige herausgegriffen werden können.
Eine zentrale Rolle spielte in Brauns Überlegungen der Begriff der „Sozialen Demokratie". Nur sie garantiere die Durchsetzung der „konstituierenden Elemen
[Seite der Druckausg.: 31 ]
te einer sozialen Marktwirtschaft", mittels der auch die Armut erfolgreich bekämpft werden könne. Als solche nannte Braun:
- Geldwertstabilität,
- die Neutralisierung wirtschaftlicher Macht mittels Wettbewerb, aber auch durch die Organisation von Gegenmacht (Gewerkschaften),
- Preisfreiheit bei ungehindertem Marktzugang
- und die „tatsächliche Möglichkeit", Eigentumsrechte auszuüben - vor allem das auf Grund und Boden.
|
Ohne Eigentumsrechte keine soziale Marktwirtschaft |
Ahnungslosigkeit warf Braun den Bankern bei ihrer Empfehlung vor, insbesondere den Armen im informellen Sektor Eigentumstitel auf Grund und Boden zu gewähren. Von der Brisanz dieses Themas sei im Bericht nichts mehr zu spüren. Denn bei Landbesitz handele es sich nicht nur um ein landwirtschaftliches Produktionsmittel, sondern vor allem um Vermögen. Für die Entwicklung eines kleinen landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betriebes sei aber der Vermögensaspekt des Landtitels - respektive Grundbucheintrags - das Entscheidende. „Empirische Erfahrung" habe gezeigt, daß der Landtitel den Wert eines Grundstückes schon am Tage seiner Ausstellung verdoppele und dieser sich in den nächsten zehn Jahren vervierfache.
|
Landtitel als Basis des wirtschaftlichen Wachstums und des Steuersystems |
Brauns Schlußfolgerung: „Das heißt, ein großer Teil der wirklich Armen könnte längst ein zwar kleines, aber dennoch existenzsicherndes Vermögen besitzen, wenn der Staat in den Ländern der Dritten Welt es nicht versäumt hätte, den Leuten im informellen Sektor zu vertretbaren Kosten Landtitel zu verschaffen." Hielten diese Bevölkerungskreise erst einmal Landtitel, werde es zudem viel schwieriger, sie von Infrastrukturdienstleistungen und sozialen Diensten auszuschließen. Der Eintrag in das Grundbuch könne außerdem als Grundlage einer Besteuerung herangezogen werden, was wiederum den Staat auf sicherere Füße stelle. Gerade in Japan, aber auch in Südkorea und Taiwan sei „der take-off vom Grundbuch" ausgegangen.
|
Bedeutung der Konversion nicht verkennen |
Einen weiteren Akzent setzte Braun, als er die Vernachlässigung des Themas Konversion im Weltbankbericht beklagte. Zwar schrumpften die Militärausgaben der NATO- und Warschauer-Pakt-Staaten, doch nicht ihre Rüstungsindustrien. Zu oft würde vergessen, daß der Marshall-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur ein Wiederaufbauprogramm für das kriegszerstörte Europa beinhaltet habe, sondern auch ein Konversionsprogramm für die ÜS-Rüstungsindustrie. Braun spitzte seine Kritik folgendermaßen zu:
„Wenn aufgrund unzureichender Konversionsprogramme in den Ländern mit vormals großer Rüstungsindustrie deren fortlaufende Produktion - deren Waffen - nun in die Dritte Welt kanalisiert werden, so kann von ‚Friedensdividende' noch keine Rede sein".
Stephen Pursey (Chefökonom des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften) unterteilte seine Stellungnahme in zwei Abschnitte. Der erste widmete sich grundsätzlichen künftigen Herausforderung an die Staaten, der zweite befaßte sich mit der Rolle der Gewerkschaften im Weltentwicklungsbericht und Fragen einer globalen Finanzordnungspolitik.
|
Privatisierung staatlicher Leistungen problematisch |
Eingangs kritisierte Pursey, daß viele Staaten „die kurzfristige Einsparung öffentlicher Ausgaben" und nicht längerfristige Überlegungen zur Grundlage ihrer Deregulierungs- und Privatisierungsentscheidungen machten. Das Bildungs- und das Gesundheitswesen zum Beispiel könnten nur mit Hilfe eines
[Seite der Druckausg.: 32 ]
starken öffentlichen Sektors weltweit angeglichen werden. Allerdings müßten Kostenkontrolle und Qualitätssicherung noch verbessert werden, damit die Wähler die zur Finanzierung der öffentlichen Hand nötige Steuerpolitik auch mittrügen.
|
Schwieriges koloniales Erbe |
Pursey warnte davor, das Erbe des Kolonialismus und der Einparteienherrschaften in den Entwicklungsländern zu unterschätzen. Das Modell des liberalen Staates mit der klassischen Gewaltenteilung entspreche derzeit einfach nicht der Realität in der Dritten Welt. Koloniale Privilegien seien vielfach noch in der Gesetzgebung festgeschrieben, was die Gewerkschaften besonders zu spüren bekämen, sobald sie sich politisch betätigten. Immer wieder habe der IBFG ministerielles „Gutdünken" bei der Registrierung von Gewerkschaften feststellen müssen. Dieses Problem tauche immer öfter auch in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) auf. Ein liberaler Staat, wie er der Bank bei ihrer Beratungstätigkeit vorschwebe, stehe „bestenfalls auf tönernen Füßen". Der Weltbankbericht mache deutlich, „daß diesen Themen fürderhin viel mehr Bedeutung zukommen wird".
|
Gewerkschaften nicht außer acht lassen |
„Der Weltbankbericht sagt nicht viel über die Rolle der Gewerkschaften in der Gesellschaft und wie sie mit der Regierung und dem Staat in Beziehung treten", stellte Pursey fest. Im wesentlichen würden sie den NRO gleichgestellt. Dabei hätten gerade die Gewerkschaften reichliche Erfahrungen vorzuweisen, wenn es zum Beispiel um die Motivation und um Effizienzsteigerungen bei den öffentlichen Diensten gehe. Speziell die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) verfüge über vielfältige Erfahrungen in der Beratung von Regierungen, der sich die Weltbank bedienen solle.
Regierungen, die die Versammlungsfreiheit mißachteten, „beseitigen" nach Purseys Auffassung „damit einen wesentlichen Steuerungsmechanismus im wirtschaftlichen Gefüge der Nation". Dies verzerre „das Entwicklungsschema", denn:
„Die Machtbeziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern haben direkten Einfluß auf die wirtschaftliche Leistung und auf die Wahrnehmung des Einzelnen in bezug auf seine gerechte Behandlung durch das System".
Wenn man dem Gedanken des Weltbankberichtes folge, müsse eine offene und konstruktive Haltung der Gesetzgebung gegenüber der Beteiligung der Arbeitnehmer an der zivilen Gesellschaft gefordert werden. Dies aber versäume der Bericht. Pursey schloß diesen Teil seines Beitrags mit folgendem Hinweis:
„Wie ein Staat seine Gewerkschaften behandelt, ist ein Lackmus-Test, ob sie für ihn eher zur Kontrolle seiner Bürger und zu privater Begünstigung dienen, oder ob er gehalten ist, im öffentlichen Interesse seinen Bürgern zu gestatten, sich im Rahmen der Gesetze unabhängig zu organisieren."
|
Globale Regulierung unabdingbar |
Zum Abschluß seiner Stellungnahme betonte er noch einmal die Notwendigkeit für „globales kollektives Handeln". In der „verqueren" Logik des Standortwettbewerbs gefangen, neigten die Regierungen dazu, „die Nachfrage mehr als nötig zu drosseln", um der Inflation entgegenzuwirken. Die Weltbank sollte sich seiner Meinung nach „zumindest der Frage annehmen, wie die Koordinierung (zwischen den Staaten) verbessert werden kann und somit der Wirtschaft weltweit schnelleres Wachstum ermöglicht". Dazu gehöre auch, das Problem schädlichen Währungsschwankungen „mit Hilfe der Tobin-Steuer" anzugehen.
Die Replik der Banker wurde von Pradhan eröffnet. Er bestätigte indirekt die Auffassung von Pursey, daß die Bank die Gewerkschaften als NRO auffasse und betonte gleichzeitig, wie wichtig der Bank die Bildung starker NRO in den Entwicklungsländern sei.
[Seite der Druckausg.: 33 ]
|
Die richtige Ebene zur Lösung eines Problems herausfinden |
Zum zweiten ging er auf die Frage des Nationalstaates in einer globalisierten Ökonomie ein: Wichtig sei es, für jedes zu lösende Problem die richtige Ebene zu finden. Dafür müsse zunächst geklärt werden, wie es sich am effektivsten lösen lasse - lokal, bundesstaatlich, national, regional oder international. Auf diese Weise würden Probleme besser beherrschbar. Dabei müsse aber jeweils neu über Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer breiten Partizipation nachgedacht werden, da es Fragen gebe, in denen sich ein partizipativer Ansatz „als kontraproduktiv" erweisen könne. Die gelte beispielsweise für die Wirtschaftspolitik.
Insgesamt - so räumte Pradhan ein - hätte man im Bericht auf eine ganze Reihe von Themen näher eingehen können. Dies sei aber im Weltentwicklungsbericht nur begrenzt möglich. Wer an bestimmten Themen näher interessiert sei, solle auf spezielle Studien der Bank zurückgreifen, die diese gerne zur Verfügung stelle.
Prof. Harald Fuhr (Universität Potsdam, Mitglied des Teams Weltentwicklungsbericht 1997) ging auf eine Reihe von Kritikpunkten ein. Über direkte Konsequenzen, die der Bericht in der Politik der Bank zeitigen können, äußerte er sich aber zurückhaltend. Fuhr verwies auf die neuen regionalen Schwerpunkte Zentral- und Osteuropa, Afrika, Lateinamerika und Asien. Dort werde geprüft, was die neuen Erkenntnisse für die einzelnen Länder bedeuten könnten - ein Prozeß, der dann in die Länderdialoge Eingang finde.
Fuhr stimmte Tetzlaff in zwei wesentlichen Punkten zu: Einerseits bedürfe der informelle Sektor sicherlich staatlicher Eingriffe zu seinen Gunsten. Es müßte vor allem der Zugang zu Produktionsmitteln ermöglicht werden und, wo das nicht möglich sei, Produktionsmittel auch vom Staat zur Verfügung gestellt werden. Doch könnten auch Liberalisierungen Chancen für die Menschen im informellen Sektor bieten.
|
Hinweis Das Foto der Druckausgabe (Seite 33) kann leider in der Online-Version nicht wiedergegeben werden. |
|
Die Haltung des Staates gegenüber den Gewerkschaften ist ein Lackmus - Test |
Zum zweiten bestätigte Fuhr Tetzlaffs Einschätzung, daß die Eliten in den Entwicklungsländern oft gar kein Interesse an wirtschaftlicher Entwicklung hätten. Hier befinde sich die Weltbank in einem Dilemma, da sie einerseits „die Bank der Mitgliedsländer sei". Andererseits gebe es heute viele „Offensiven zur Vernetzung mit der Zivilgesellschaft", was manchmal auch zu Konflikten mit den Regierungen führe. Doch mittlerweile sei bei diesem Thema eine „kritische Masse" erreicht, die letztlich zu mehr Transparenz im „Regierungshandeln" führen werde.
In der offenen Diskussion beschäftigte sich eine ganze Reihe von Beiträgen mit der Grundlage des Weltentwicklungsberichtes, also mit seiner Datenbasis. Einerseits wurde bezweifelt, ob die Befragung von einigen tausend Unternehmern weltweit überhaupt statistische Schlüsse auf einzelne Länder zulasse.
|
Repräsentieren Befragungen von Unternehmern gesellschaftliche Problemlagen? |
Der zweite, wichtigere Einwand, den auch Uschi Eid in ihrer Stellungnahme ausdrücklich hervorhob, bezog sich auf den Umstand, daß die Weltbank für ihre Untersuchungen nur Unternehmer befragt hatte. „Für den deutschen Kontext", so die Überlegung von Michael Windfuhr „ist es sicherlich ein Unterschied, ob man Arbeitslose oder Unternehmer nach ihrer Meinung über staatliche Politikmaßnahmen befragt". Natürlich würden auch sozial schlecht gestellte Menschen ein
[Seite der Druckausg.: 34 ]
verläßliches Justizsystem, eine berechenbare Politik sowie eine niedrige Kriminalitätsrate für wichtig halten, doch gebe es sicherlich auch Unterschiede. Vor allem, wenn man bedenke, daß es Staaten mit hohem Wirtschaftswachstum gebe, in denen die Schere zwischen Arm und Reich ständig weiter auseinandergehe. In ihren Antworten wiesen sowohl Pradhan als auch Fuhr darauf hin, daß die Weltbank auch die Ergebnisse „intensiver und sehr breit angelegter Konsultationen" mit NRO in aller Welt zur Grundlage ihres 97er Berichtes gemacht habe. Ob die vorzugweise Befragung bei Unternehmern etwas mit dem Staatsbegriff der Banker zu tun haben könnte, darauf wurde nicht näher eingegangen. Allerdings kündigte Pradhan an, daß der 99er Weltentwicklungsbericht sich erneut mit Armut beschäftigen werde. Dort werde auf die Sichtweisen der Armen wieder ausführlicher eingegangen.
|
Spät - aber nicht zu spät: Die Entdeckung der Korruption |
Mehrmals war - sowohl aus dem Podium als auch von den Teilnehmern - Verwunderung darüber geäußert worden, daß die Weltbank sich der Korruption erst jetzt vordringlich widme. Rheinhold Thiel ging sogar so weit, zu behaupten, die Weltbank sei zur Beschäftigung mit diesem Thema gezwungen worden.
Fuhr gab in seiner Antwort zu, daß die Weltbank sich dieses Themas auch aufgrund äußeren Drucks angenommen habe, wies aber darauf hin, daß die Bank sich schon seit Anfang der 80er Jahre mit dem Problem beschäftige. Doch bedürfe es hier ebenfalls einer „kritischen Masse interner Diskussionen und Kurskorrekturen", bevor ein solches Thema als „geronnene Fakten" auch Eingang in einen Weltentwicklungsbericht finde. Es handele sich bei einem solchen Papier letztlich um einen Kompromiß, der das Gedankengut und die Diskussionen innerhalb der Bank widerspiegele.
Ein Themenkomplex der Diskussion beschäftigte sich mit der Frage nach der Macht im Zusammenhang mit der Ausgestaltung eines Staatwesens. Dr. Erfried Adam verwies auf „den häufigen Eindruck, als drehe sich alles nur um technokratisches Vorgehen". Tatsächlich aber gehe es im Grunde doch um tiefgreifende politische und gesellschaftliche Konflikte, bei denen das Resultat offen sei und bleibe.
Dr. Burkhard Könitzer warf den Bankern vor, ein statisches Staatsverständnis zu propagieren, wie es schon im 18. Jahrhundert üblich gewesen sei. Stichworte wie ‚Global Governance' - also eine internationale Zusammenarbeit der Staaten und die Bedeutung internationaler Organisationen wie der UN - fehlten völlig.
|
Hinweis Das Foto der Druckausgabe (Seite 34) kann leider in der Online-Version nicht wiedergegeben werden. |
In seiner Replik ging Fuhr vor allem auf dieses Stichwort ein: Der Begriff der ,Global Governance' sei schlichtweg noch zu jung, um ihn in ein Ergebnispapier wie den Weltentwicklungsbericht aufzunehmen. „Wir wissen", so Fuhr wörtlich, „daß der Nationalstaat in dieser Form bald nicht mehr existieren wird. Wir haben es dabei belassen, und wir sind uns des Defizits bewußt, die Debatte nicht noch weiter getrieben zu haben. Wenn man so einen Bericht zu Ende geschrieben hat, dann fangen die meisten neuen Ideen erst an."
|
Theorie und Praxis |
Mehrmals wurden die Aussagen des Weltentwicklungsberichtes mit der tatsächlichen Arbeitsweise der Bank verglichen und eine mangelnde Kohärenz angemahnt. So fragte Eid zum Beispiel, warum die Bank unter anderem nicht
[Seite der Druckausg.: 35 ]
darauf gedrängt habe, beim Flut-Aktionsplan in Bangla Desh eine demokratische Willensbildung zu unterstützen.
Tetzlaff machte einen ähnlichen Punkt, als er verlangte, daß über große Kreditabsprachen eine öffentliche Diskussion in den Nehmerländern geführt werden solle. Auch solche Prozesse könne und solle die Weltbank fördern.
Erwähnt werden muß am Endes dieses Kapitels, daß es immer wieder offene, teilweise auch indirekte Hinweise darauf gab - verbunden mit einer gewissen Zufriedenheit - daß gerade in der Bundesrepublik vieles von den „neuen" Erkenntnissen der Weltbank über die Bedeutung des Staates hierzulande zum politischen Alltag gehört. Es war ein breiter Konsens spürbar, der sich mit dem Wort ,soziale Marktwirtschaft' - oder etwas spitzer ,rheinischer Kapitalismus' - beschreiben ließe. Weder die Banker noch eine der anschließenden Diskussionsrunden stellte diesen Konsens ernsthaft in Frage, einen Konsens, der über weite Teile durch den Weltbankbericht zutreffend beschrieben ist. Von der Ansprache Sprangers über die Statements der deutschen Sozialpolitiker bis hin zu den Überlegungen der Osteuopa-Fachleute bezogen sich die Teilnehmer im Gegenteil immer wieder auf diesen Konsens. Die, die diese Erkenntnisse von der Notwendigkeit und Nützlichkeit eines effektiven Staatswesens nicht teilen, waren nach der Meinung der meisten Diskutanten wohl die Unternehmer und Bezieher hoher Einkommen. Ihre mangelnde Bereitschaft, Steuern zu zahlen, wurde jedenfalls wiederholt so interpretiert.
|
Alternativer Weltentwicklungsbericht? |
Bemerkenswert ist aus diesem Panel noch die Idee von Prof. Braun, einen alternativen Weltentwicklungsbericht zu verfassen. So, wie es einen Alternativen Nobelpreis mit relativ niedrig dotierten Preisen gebe, könne auch ein alternativer Weltentwicklungsbericht mit vergleichsweise geringen Aufwand geschrieben werden. Schließlich sei die thematische Ausrichtung der Berichte für die kommenden ein bis zwei Jahre bekannt.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Mai 2000