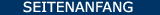![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

Russische Außenpolitik im Machtdreieck USA - Europa - Weltgemeinschaft / Peter W. Schulze - [Electronic ed.] - Bonn, 2003 - 19 S. = 72 KB, Text . - (Politikinformation Osteuropa ; 112) - ISBN 3-89892-190-5
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
© Friedrich-Ebert-Stiftung
[Seite der Druckausg.: 1-2 = Titelblatt]
[Seite der Druckausg.: 3]
Inhaltsverzeichnis
Russland nach dem 11. September – die Vollendung des Paradigmenwechsels zum Ende der 90er Jahre
Die Zwickmühle der russischen Diplomatie durch das transatlantische Zerwürfnis
Die russischen Interessen im Nahen Osten und der Welt
Hegemonie und Isolationismus- zwei Seiten des amerikanischen Traums
Die Sinn- und Führungskrise der Europäischen Union
Illusionen in der Außenpolitik: eine russische Mittlerrolle im transatlantischem Dialog?
Perspektivische Thesen für europäisch-russische Alternativen zum US-amerikanischen Unilateralismus
Russland nach dem 11. September –
die Vollendung des Paradigmenwechsels zum Ende der 90er Jahre
Die russische Politik hat die Chance genutzt, die sich ihr nach dem terroristischen Angriff auf das World Trade Center bot. Russland wurde zum Partner der westlichen Staaten- und Wertegemeinschaft und ist im Kampf gegen den internationalen Terrorismus zum Verbündeten geworden. Aufgrund der Septemberereignisse wurden auch in den Teilen der amerikanischen außen- und sicherheitspolitischen Elite vorhandene Restzweifel behoben, die Russland unterstellten, zwischen Europa und den USA einen Keil treiben zu wollen. Damit schien die Zeit der Unberechenbarkeit vorbei.
In der zurückliegenden Dekade agierte Russland weniger als Handlungssubjekt internationaler Politik. Es war Opfer sowohl der westlichen Unschlüssigkeit als auch der eigenen Unberechenbarkeit innenpolitischer Entwicklungen sowie der außenpolitischen Linie. Die Wirren der Jelzin-Ära spiegelten sich in der russischen Diplomatie wider. Bis zum Ende der Dekade wirkte eine Vielzahl von Institutionen und Akteuren im außenpolitischen Entscheidungsprozess. Eine klare Zuordnung der außenpolitischen Entscheidungskompetenz war nicht immer zu erkennen. Abgelöst von den realen wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten des Landes dominierten ideologisierte und widersprüchliche Wunschbilder über euroasiatische strategische Partnerschaften und russische Sonderwege. Das Land geriet in Gefahr, während der Konflikte auf dem Balkan und durch die Osterweiterung der NATO im internationalen Vergleich marginalisiert zu werden.
Im Gegenzug verrannte sich die Europäische Union oft in fruchtlosen Erörterungen darüber, ob Russland noch Teil Europas sei oder nicht. Von einer stringenten Russlandpolitik der EU, die über wohlmeinende Strategie- und Kooperationserklärungen hinausging, kann erst mit der Deklaration von Köln im Juni 1999 gesprochen werden. Dass aber die Zeit für reale Angebote und Projekte in den russisch- europäischen Beziehungen reif war, belegte die prompte russische Antwort. Die Helsinki- Erklärung des damals frisch ernannten russischen Premierministers W. Putin vom Oktober 1999 leitete einen leidlich gleichberechtigten und perspektivischen Dialog über konkrete Kooperationsprojekte ein und beflügelte die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Russland.
[Seite der Druckausg.: 4]
Indessen blieb bis zu den Septemberereignissen von New York die amerikanische Russlandpolitik schwankend. Die Zukunftsszenarien Washingtons gingen weit auseinander. Es war die Rede von der Instrumentalisierung als potentiellen Bundesgenossen gegen China oder dass auch eine Welt ohne Russland vorstellbar sei und dass das Land den Herausforderungen der Globalisierung ohnehin nicht gewachsen sei und in mehrere Teilrepubliken zerfallen werde (Zbigniew Brzezinski). Erst seit den Ereignissen des September 2001 und der beginnenden Irak-Kampagne bemühte sich die Bush-Administration um vertiefte partnerschaftliche Beziehungen zu Moskau.
Auf russischer Seite ist aber nicht vergessen, dass westliches Zaudern bereits einmal, Anfang der 1990er Jahre, zum Faktor politischer Frustration und anti-westlicher Sentiments unter russischen Intellektuellen wurde. Illusionen auf eine schnelle Aufnahme des Landes in Kernorganisationen der westlichen Gemeinschaft wurden arg enttäuscht. An Stelle dessen sah man sich ab 1994 mit Ausgrenzungsstrategien (Ost-Erweiterung der Nato) konfrontiert. Gegen Ende der 90er Jahre, noch während Konflikte und Kriege auf dem Balkan tobten, und trotz fortschreitender Ost-Erweiterung der NATO, bahnte sich schon in Teilen der außen-, sicherheits- und kommunikationspolitischen Elite des Landes ein Paradigmenwechsel an, der vollends in der Präsidentschaft Putins vollzogen wird.
Frühere Vorstellungen, wie sie besonders unter dem damaligen Außen- und späteren Premierminister Ewgenj Primakow florierten, verloren an Überzeugungskraft. Wenige sind heute der Meinung, Russland solle sich für eine multipolare Weltordnung aktiv einsetzen oder anstelle der Westintegration die Option eines russischen Sonderwegs verfolgen oder eine strategische, euro-asiatische Allianz mit China, Indien und anderen Staaten des pazifischen Raumes aufbauen. Zwar tauchen im Kontext der aktiven Reisediplomatie von Präsident Putin immer wieder Vorschläge einer geostrategischen Partnerschaft mit Indien, Pakistan und China auf. Solche Ideen verkennen aber die komplexen Beziehungen zwischen den potentiellen Partnern völlig. Unbestreitbar ist jedoch das Interesse Russlands an vertieften Handels- wie militärischen Beziehungen, denn nicht unbeträchtliche 60% der Arbeitsplätze im russischen Rüstungssektor hängen von Militärexporten in diese Regionen ab. Russlands Hinwendung gen Westen steht aber außer Frage.
Die Zwickmühle der russischen Diplomatie durch das transatlantische Zerwürfnis
Die große internationale Koalition des neuen Millenniums gegen den internationalen Terrorismus hat nun ihre Feuerprobe in Afghanistan bestanden und engagiert sich auch beim Wiederaufbau des Landes. In der triangulären Konzeption Europa – USA – Vereinte Nationen sah sich die russische Außenpolitik bis zum Kriegsbeginn gegen den Irak hinlänglich gut, weil allseitig vernetzt, aufgehoben. Erst in der Frage des adäquaten Vorgehens zur Entwaffnung des Irak und zur Vernichtung eventuell noch vorhandener Massenvernichtungsmittel zeichneten sich Zerwürfnisse im UN-Sicherheitsrat zwischen den USA und einigen ihrer europäischen Verbündeten ab.
Das völkerrechtswidrige militärische Vorgehen der "Koalitionäre" unter Führung der USA und Großbritanniens gefährdete nicht nur den Bestand der internationalen Koalition gegen den Terror, sondern manövrierte auch die russische Politik in eine schwierige Lage. Nicht nur partikular-wirtschaftliche, sondern als essentiell definierte nationale Interessen sind durch die amerikanische Offensive herausgefordert worden. Obendrein wurde die russische Politik mit dem Dilemma konfrontiert, das sie unter allen Umständen vermeiden
[Seite der Druckausg.: 5]
wollte: sich zwischen zwei unterschiedlichen Strategien oder Konzeptionen zur Neugestaltung und zur Abwehr von Gefahren für das internationale System entscheiden zu müssen.
Erschwert wird diese Entscheidung zum einen durch den Zustand der Europäischen Union. Deren innere Zerrissenheit, die eigenen Projekte der politischen Integration und der außen- wie sicherheitspolitischen Identitätsfindung voran zu bringen, haben in der Irak-Krise wieder einmal die außenpolitische Handlungsunfähigkeit Europas unter Beweis gestellt. Mehr noch; all diese Projekte sind in diesem Konflikt nachhaltig beschädigt worden. Zum anderen offeriert die zur Projektion militärischer Macht fähige Hegemonialpolitik der USA mit ihren unilateralen Grundtendenzen kaum Möglichkeiten der partnerschaftlichen Kooperation. Vorstellungen gar, eine strategische Partnerschaft mit den USA begründen zu können, wie sie ehedem trotz aller Konfrontation im bipolaren System existierte und die gemeinsame Verantwortung zur Abwehr der nuklearen Katastrophe erzwang, scheinen unter solchen Bedingungen gänzlich irreal.
Russland will und kann die neu gefundene Partnerschaft mit den USA nicht gefährden. Aber als kontinentaleuropäische Macht will und kann sich die russische Politik auch nicht den Argumenten der Kriegsgegner in der EU verschließen. Sie teilte die Sorgen europäischer Staaten, dass der vollzogene Paradigmenwechsel in der amerikanischen Politik zu einer nachhaltigen und fundamentalen Veränderung der Kräfteverhältnisse in der Weltpolitik führen und den Bestand internationaler Institutionen und völkerrechtlicher Bindungen aufweichen könnte. Um aus dieser vertrackten Zwickmühle herauszukommen, suchte die russische Politik
erstens, Zeit zu gewinnen,
zweitens, potentielle Alternativen durchzuspielen und auf ihre Vereinbarkeit mit eigenen Interessen zu untersuchen, und
drittens, die Ernsthaftigkeit und Standhaftigkeit potentieller Bündnispartner und Akteure zu prüfen.
Mehrere Ziele scheinen die russische Politik bis zum Kriegsausbruch bestimmt zu haben. Unter allen Umständen sollte erstens vermieden werden, sich allein und einseitig zu exponieren. Eine erneute Isolierung hätte nicht nur schwerwiegende Konsequenzen für das eigene Rollenverständnis in der internationalen Politik nach sich gezogen. Wesentlich gravierender und langfristiger wären die negativen Folgen für das Putinsche Modernisierungsprojekt, dessen innenpolitische und sozioökonomische Reformdimension auf eine feste Verankerung des Landes in Europa und in den transatlantischen Beziehungen fußt.
Zweitens musste dem Eindruck sowohl westlicher als auch eigener Einflussgruppen entschlossen begegnet werden, Russland nutze die Situation zu einer erneuten Auflage der altbekannten "Schaukelpolitik", diesmal aber im transatlantischem Gefüge und nicht als euroasiatischer Sonderweg. Die unter der Präsidentschaft Putin erstmals gewonnene politische Berechenbarkeit und internationale Kooperationsfähigkeit der russischen Politik standen auf dem Prüfstand und schränkten den politischen Handlungsspielraum ein.
Von der russischen Politik wurde demnach ein sehr komplizierter Balanceakt verlangt. Sie muss sich gegen hegemoniale Bestrebungen der Bush- Administration positionieren, durfte aber nicht in den Verdacht geraten, das transatlantische Bündnis zu beschädigen oder gar einen Keil zwischen Europa und den USA treiben zu wollen. Falls aber eine Entscheidung zwischen Europa und den USA unumgänglich wurde, musste die russische Politik darauf dringen, dieser den Stachel des Antiamerikanismus zu nehmen, weil Russland sich nicht der Gegnerschaft Washingtons aussetzen kann. Russische Politiker befürchteten, dass fehlende Kooperation oder gar ein Veto im Weltsicherheitsrat gegen unilaterale Militäraktionen der USA bestraft würde. Allein wenn sich die Bush-Administration gegen die weitere Integration Russlands in die Weltwirtschaft (WTO) entschiede, würde das einschneidende, wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Dieser schwierige Balanceakt zwischen Europa und den USA gelang der russischen Politik nur in Abstimmung und im Fahrwasser ihrer europäischen Verbündeten.
Daher wurde das russische Außenverhalten durch eine Phase des pragmatischen Zauderns und der Überprüfung der Motive ihrer potentiellen Bündnispartner charakterisiert. Diese Einstellung spiegelte sich bis kurz vor Kriegsausbruch noch in Äußerungen namhafter Repräsentanten des außen- und sicherheitspolitischen Establishments wider, die in gewohnt realpolitisch, zynischer Manier schon vom längst gemachten "Deal" zwischen Moskau und Washington schwatzten. Westliche Experten und Medien übernahmen nur zu gern diese Sichtweise, bot sich doch hier wieder eine Gelegenheit kritischer Berichterstattung, die seit den Stabilisierungserfolgen in der Innenpolitik und mit dem wirtschaftlichen Aufschwung seit 2000 außer Mode gekommen war.
Daher kritisieren außenpolitische Analysten wie Sergej Karaganow, Vorsitzender des russischen Council on Foreign and Defense Policy, auch den russischen Schlingerkurs im Irak-Konflikt, der gerade noch eben an einer Katastrophe vorbeigeschrammt sei. Noch größere konzeptionelle Unwägbarkeiten als in der außenpolitischen Linie zeigten sich bei der Verfolgung wirtschaftlicher Interessen. Das Ministerium für Wirtschaftsentwicklung und Handel erfüllte die ihm gestellten Aufgaben zu keiner Zeit. Vor allem bemängelt Karaganow, dass die russische Politik zu keiner Zeit in der Irak-Frage eine klare Konzeption hatte oder strategische Ziele verfolgte, noch gut koordiniert war. Letzteres bestätigt auch der Verteidigungsanalyst Pavel Felgenhauer, der aber im Unterschied zu Karaganow politisch anders verortet ist und eindeutig zur Fraktion der russischen "Atlantiker" gezählt werden kann. Die "atlantische Fraktion" hätte sich aber nicht gegen die "vereinten Kräfte der anti-amerikanischen Lobby" durchsetzen können, zu der Felgenhauer das Verteidigungs- und Außenministerium sowie die Nachrichtendienste zählt. Diese hätten faktisch "a virtual monopoly on providing Putin with vital decision-making briefing documents" (Pavel Felgenhauer in The Moscow Times, 24.4.2003). Beide Experten stimmen darin überein, dass der Kreml ebenso wie westliche Regierungen und Medien, die Stärke und Widerstandskraft der irakischen Armee völlig falsch eingeschätzt haben, gleichgültig ob die Eroberung Bagdads durch die US-Regierung erkauft wurde oder nicht.
Die russischen Interessen im Nahen Osten und der Welt
Im Irakkonflikt standen aber nicht nur Fragen der regionalen Neuordnung des gesamten Raumes vom Nahen Osten bis zum Golf oder die wirtschaftlichen Interessen amerikanischer Ölkonzerne auf dem Spiel. Das militärische und unilaterale Vorgehen der Bush-Administration stellte die internationale Nachkriegsordnung, die selbst die Krisen des Kalten Krieges und der Bipolarität überlebt hatte, infrage. Im Lichte dieser Herausforderung, die von den USA mit militärischem Druck auf die weltpolitische Agenda gesetzt wurde, sah die russische Politik, die anfangs noch als Anwalt eigener wirtschaftlicher Interessen im Irak auftrat und zwischen den europäischen und amerikanischen Positionen zu jonglieren suchte, existentielle Langzeitinteressen bedroht.
Insbesondere die wirtschaftlichen Interessen Russlands waren nicht unbeträchtlich. Darunter fielen Altschulden des Irak aus der Sowjetzeit in Höhe von ca. 9 Mrd. US Dollar und die lukrativen Gewinne aus dem Nahrungsmittel-für-Öl-Geschäft. Außerdem hatte der russische Öl-Gigant Lukoil Erschließungsverträge in Höhe von ca. 10 Mrd. US Dollar unterzeichnet. Mit dem Irak waren Gesamtaufträge an die russische Wirt-
[Seite der Druckausg.: 7]
schaft von schätzungsweise weiteren 30 Mrd. US Dollar vereinbart. Profitiert hätten besonders die technologisch rückständigen und wettbewerbsschwachen Industriekomplexe des russischen Automobilsektors.
Spätestens seit Ende Februar 2003 war klar, dass ein militärischer Alleingang der USA gegen den Irak nicht mehr abgewendet werden konnte. Russland hatte aber mit dem international geächteten Paria-Staat wirtschaftlich kooperiert und sich im Irak eine gute wirtschaftliche und politische Startposition aufgebaut. Derartige Anstrengungen wären durch einen amerikanischen Alleingang zunichte gemacht worden. Mehr noch, Russland wäre ökonomisch vollends auf der Verliererstraße, falls die irakischen Ölvorräte (nur ein Bruchteil der bekannten Ölquellen ist erschlossen) auf den Weltmarkt kämen und zum Verfall des Ölpreises beitrügen. Ein niedriger Ölpreis hätte einschneidende Folgen für die Höhe und langfristige Stabilität des russischen Staatshaushaltes. Vor diesem Hintergrund wäre also ein Eingehen auf die amerikanische Politik nicht nur verständlich, sondern auch vernünftig gewesen. Eine einseitig von den USA dem post-Saddam Irak oktroyierte Nachkriegsneuordnung, die weder von den Vereinten Nationen bestimmt noch von der Europäischen Union beeinflusst wäre, hätte auch die russischen Wirtschaftsinteressen im Nahen Osten bedroht.
Die Entscheidung Russlands für Europa und gegen die USA war aber nicht von ökonomischen Überlegungen dominiert. Im Gegenteil, folgt man der Argumentation Karaganows, handelte die russische Regierung gegen ihre eigenen Wirtschaftsinteressen im Irak. Nachträglich scheint es müßig, über die mangelnde Flexibilität und gleichsam fundamentalistische Festlegung der amerikanischen Politik zum Kriegskurs zu spekulieren. Weder eine gewisse Sympathie für die europäische Ablehnungsfront, noch gar das sentimentale Aufflackern einer deutsch-russischen Sonderbeziehung, können als Grund für eine solch risikoreiche Entscheidung angeführt werden. Ebenso wenig lag Russland das politische Schicksal des Irak, speziell die Beseitigung des Regimes Saddam Husseins, am Herzen. Die militärische Intervention der USA würde auch ohne Russland erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Allenfalls über den Zeitrahmen und die Kosten der Operation bestand Unklarheit.
Einzig die Intransigenz der Bush-Administration veränderte die Konfliktlage qualitativ. Aus der Kontroverse um das optimale Vorgehen gegen das Saddam-Regime drohte ein Konflikt um die Zukunft der UNO und der weltpolitischen Ordnung zu werden. Es ging also nicht mehr allein um das Für und Wider eines "Entwaffnungskrieges" oder um die Fortführung der Arbeit der UN-Inspektoren. Selbst die gewiss problematische Zielsetzung, mit militärischen Mitteln einen "Regimewechsel" in Bagdad herbeizuführen, hätte die russische Politik weder erschüttert, noch wäre ein solches Vorgehen aus prinzipiellen Erwägungen verworfen worden. Ein Indiz dafür scheint, dass am Vorabend und während der ersten Phase des Irak-Krieges in Kreisen des außen- und sicherheitspolitischen Establishments kursierte, die USA hätten als Hegemon der Weltpolitik die erforderliche Legitimation und Verantwortung, sogar "nukleare Entwaffnungskriege" zu führen. Das Vorgehen der Bush-Administration, so die Argumentation, sei nur der Auftakt zu einer Reihe von zukünftigen Entwaffnungskriegen gegen potentielle und tatsächliche Nuklearmächte, also gegen den Iran, gegen Nordkorea, und möglicherweise auch gegen Pakistan. Solche Kriege entbehrten nicht einer gewissen Legitimation, da die Alternative zum Nichtstun zu regionalen Nuklearkriegen führen würde. An diesem Punkt versteifte sich die russische Position. Existentielle Intereressen schienen bedroht.
Unbestritten hält sich trotz der offiziellen Regierungspolitik in Kreisen der außen- und sicherheitspolitischen Elite des Landes die Option der strategischen, wenn auch Juniorpartnerschaft mit den USA. Diese
[Seite der Druckausg.: 8]
Position ist nicht gegen Europa gerichtet. Aber sie bezweifelt, dass die europäische Politik sich jemals als Gestalter und Ordnungsfaktor in den internationalen Beziehungen durchsetzen könne.
Ähnlich wie in der amerikanischen Politik sieht man in Kreisen der russischen Diplomatie die Vereinten Nationen und völkerrechtliche Verpflichtungen als handlungsunfähig an. Nur tiefgreifende Reformen, so Karaganow, können die UNO retten. Sie sollten gemeinsam mit denjenigen Staaten durchgesetzt werden, die ähnlich wie Russland ein Interesse an den Vereinten Nationen bekunden. Aber Karaganow insistiert trotz aller Kritik, dass die Reform der UNO nur mit den USA erreicht werden könne. Für den Irak blieb trotz aller Szenarien für die offizielle Politik die Frage entscheidend, ob es für eventuelle Zwangsmaßnahmen ein völkerrechtlich legitimiertes Mandat der Vereinten Nationen geben würde.
Hinter diesem Beharren auf die Vereinten Nationen als einziger und höchst legitimierter Entscheidungsinstanz über Krieg und Frieden, verbirgt sich keine illusionäre Wertschätzung der UNO. Schlichtweg wird hier eine wohl begründete nationale Interessenlage zum Ausdruck gebracht, die sich aus den innenpolitischen und wirtschaftlichen Erfordernissen des dritten Modernisierungsprojektes ableitet. Die Modernisierung und Restrukturierung von Gesellschaft und Wirtschaft, die Instandsetzung und der Ausbau der Infrastruktur, die technologische Erneuerung der großen Industrie, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit russischer Technologien und Produkte sowie die verbesserte medizinische und soziale Versorgung der Bevölkerung erfordern verlässliche externe Rahmenbedingungen. Nur unter den Bedingungen eines internationalen Systems, das nicht durch Konflikte, Interventionen und Kriege zerrissen und nicht zum Spielball hegemonialer Machtpolitik wird, kann die Einbettung der russischen Politik in internationale Kooperationszusammenhänge weitergehen.
Nur so ist zu hoffen, dass der nachhaltige Wirtschaftsaufschwung in Russland sich verstetigt und der gigantische Kapitalzufluss, der für die Realisierung des Putinschen Modernisierungsprojektes erforderlich sein wird, auch erbracht wird. Die Wiederherstellung staatlicher Autorität, die Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und die Eingliederung Russlands in das internationale System als verantwortliche, berechenbare und gestaltende Großmacht sind in dieser Konzeption untrennbar verbunden. Zwar kann die These Karaganows über das Strategiedefizit der russischen Politik im allgemeinen und insbesondere in der Irak-Frage nicht völlig entkräftigt werden. Vor diesem Hintergrund, dem Wunsch Russlands nach einem stabilen Umfeld, wird klar, eine so begründete Politik entbehrt keinesfalls einer strategisch angeleiteten Rationale.
Akzeptiert man jedoch die Verschränkung von internen und externen Determinanten, so folgt, dass das Primat der innen- und wirtschaftspolitischen Modernisierung zur Triebfeder der Außenpolitik wird. Neben dem Gebot nach stabilen externen Rahmenbedingungen, die allerdings auch im Fahrwasser der Pax Americana erreicht werden könnten, erscheint die Frage nach verlässlichen internationalen Partnern, die ein langfristiges Interesse an der russischen Entwicklung haben, als zweite Bedingung des Modernisierungskonzeptes. In diesem Zusammenhang erweist sich die Entscheidung Russlands für ein Zusammengehen mit den europäischen Kernländern nur als konsequent, denn sie gründet sich auf langjährige multilaterale wie bilaterale Beziehungen, die durch Projekte des Energie- und Transportverbundes und der technologischen Kooperation (Rüstungsbereich eingeschlossen) eine neue Qualität anstreben.
Auf Basis erreichter internationaler Integration, wirtschaftlicher Stärke und politischer Stabilität liegt es kaum im europäischen Interesse, Russland die Rolle einer Großmacht streitig zu machen. Dies gilt auch,
[Seite der Druckausg.: 9]
wenn Russland bis dato nicht über die materiellen Voraussetzungen verfügt, seiner Großmachtrolle gerecht zu werden. Es lebt von der Substanz. Einzig der Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sichert der ehemaligen Supermacht nicht nur den Status einer Großmacht, sondern ermöglicht auch das prinzipielle Mitgestalten globaler Ordnungsprozesse.
In einer unilateralen, dem Hegemon USA unterworfenen Welt, würde Russland allenfalls, trotz seiner Nuklearwaffen,aber, einen Platz unter den fünfzehn führenden Industrienationen der Welt besetzen. Die Stellung Russlands in der UNO, also die Konfiguration des internationalen Systems nach 1945, bildet den externen und determinierenden Faktor für das russische Außenverhalten. Nuklearwaffen spielen nur eine untergeordnete Rolle, schließlich verfügen Israel, Indien, China und Pakistan ebenso darüber. Je mehr folglich die Furcht vor einer Beschädigung der Vereinten Nationen durch das unilateralhegemoniale Verhalten der Bush-Administration zur Gewissheit wurde, umso mehr musste die russische Politik von ihrem anfänglich pragmatisch-vermittelnden Kurs abrücken und sich in der fragilen, anti-hegemonialen Allianz von "Gleichgesinnten" positionieren.
Hegemonie und Isolationismus- zwei Seiten des amerikanischen Traums
Es wäre eine fatale Fehleinschätzung, die augenblickliche Politik der Bush-Administration als konjunkturell begründeten faux pas im Nachklang der Septemberereignisse abzutun und im übrigen auf die Selbstheilungskräfte der großen amerikanischen Demokratie in den kommenden Präsidentschaftswahlen zu vertrauen. Solch eine Hoffnung ist aus europäischer Sicht verständlich, aber nicht verzeihlich.
Die Politik der jetzigen Bush-Administration steht in der Tradition eines Paradigmenwechsels in der amerikanischen Politik, der seit mehr als zwei Dekaden andauert. Dieser Paradigmenwechsel speist sich aus zwei anscheinend grundsätzlich verschiedenen Strömungen, die des Isolationismus und des Globalismus.
Die Grundtendenz zum isolationistischen Verhalten war schon immer in der amerikanischen Politik angelegt. Sie flackerte besonders hell in der Reagan-Administration, fand aber ihre Beschränkung durch die Struktur des bipolaren Systems. Als Reaktion auf den moderaten außenpolitischen Kurs der damaligen Carter-Administration formierte sich in der letzten Phase der 1970er Jahre eine schillernde Koalition aus fundamentalistischen, religiösen, traditionell republikanischen Gruppen zur "Neuen Rechten". Hinzu stießen intellektuelle – ehemals liberale – Strömungen des amerikanischen Neokonservatismus, die anti-(Wohlfahrt)staatliche Ideologien des Südwestens und Westens (sunbelt) aufgriffen und einen neuen Missionsgedanken einbrachten, der sukzessive traditionelle, isolationistische Ideologien umdeutete: die USA müssten aus einer Position der Stärke und Unverletzbarkeit fähig sein, hegemoniale Globalverantwortung zu übernehmen.
Zu diesen stark ideologisierten Gruppen stießen sukzessive Wirtschaftskreise, die früher eher eigene politische Optionen zu realisieren suchten, wie Konzerne aus dem Energiesektor und aus dem internationalen Anlagenbau. Der Formierungsprozess der Neuen Rechten überspannt mehr als zwei Dekaden. Er erreicht seinen ersten Durchbruch unter Reagan. Erst mit dem jungen Bush scheint die Synthese von Isolationismus und globalem Sendungsbewusstsein endgültig vollzogen.
[Seite der Druckausg.: 10]
Die Grundvorstellung hegemonialen Sendungsbewusstseins basiert auf der militärischen, wirtschaftlichen sowie politischen Fähigkeit zur Durchsetzung nationaler Interessen und Ziele. Diese globale und gleichsam isolationistische Vorstellung, die bereits unter Reagan im SDI-Projekt aufkam, wird zum Leitgedanken in der amerikanischen Sicherheitsdoktrin. Der noch während der Clinton-Administration unentschlossene Kurs zwischen kollektiver und unilateraler Sicherheitspolitik scheint nunmehr entschieden. Der Paradigmenwechsel zum Unilateralismus und zur Akzeptanz der Rolle als uneingeschränkte militärische und politische Führungsmacht im internationalen System ist gewiss durch die Ereignisse von New York forciert und beeinflusst worden.
Die in der Sicherheitsdoktrin verankerte Entschlossenheit auch präemptive Militärschläge gegen jeden Staat auf dieser Welt, insofern ihn die USA der Kooperation mit dem Terrorismus verdächtigen, zu führen, entspringt der militärisch begründeten unilateralen Logik und der absolut gesetzten Definitionsmacht des Hegemons. Als Machtfigur des internationalen Systems bestimmen die USA demgemäss die Wahl des Vorgehens, ob kollektiv oder unilateral, und entscheiden über die einzusetzenden Zwangsmittel. Der hegemonial begründete Unilateralismus legitimiert sich selbst. Daher rührt die Abwehr von Kontrolle und Überprüfung durch internationale Institutionen, völkerrechtliche Regelwerke oder Bündniskonstellationen.
Die Sinn- und Führungskrise der Europäischen Union
Die Europäische Union ist durch die Irak-Krise und durch den außenpolitischen Paradigmenwechsel der Bush- Administration, der letztlich auch den schleichenden, aber sichtbaren Bedeutungsverlust der NATO evident machte, in eine tiefe Sinnkrise gestürzt. Beide Faktoren waren aber eher Auslöser als Grund der Krise. Die Risse in der Europäischen Union wurden nur offen gelegt, nicht erst geschaffen.
Die großen europäischen Zukunftsprojekte, nämlich die politische Einheit und die Schaffung einer außen- und sicherheitspolitisch handlungsfähigen Union mit eigener Identität, stehen heute auf dem Prüfstand. Damit wird eine Dekade europäischer Integration und Identitätssuche, die mit dem Vertrag von Maastricht begann, hinterfragt. Mehr noch, Europa selbst präsentiert sich führungslos: Deutschland und Frankreich scheinen die Legitimation der Führung verloren zu haben. Sie laufen Gefahr, in die Minderheit zu geraten. Nicht anders ist das Entstehen der Gruppe der Acht – bestehend aus Mitgliedsländern und Beitrittskandidaten des "neuen Europa" – und deren Unterstützung für die Irak-Politik Washingtons zu interpretieren.
Die anstehende Ost-Erweiterung wird das Problem noch verschärfen, da die neuen Mitgliedsländer nicht an einer politischen Union interessiert sind. Sie sehen ihre Sicherheit besser durch die USA gewährleistet; entweder über die Schiene der NATO oder durch bilaterale Koalitionen unter amerikanischer Führung. Sie haben auch nicht den Anspruch, als Akteure im Rahmen einer noch nebulösen außen- und sicherheitspolitische Dimension der EU zu agieren, die zudem von den USA mit Argwohn bedacht wird. Für sie scheint mit dem Beitritt zur NATO und zur EU die Suche nach europäischer Identität abgeschlossen und ihre Sicherheit durch die Pax Americana garantiert. Eine von den amerikanischen Vorgaben abweichende Sonderrolle der Europäischen Union widerspricht dieser Grundauffassung. Nach wie vor gilt die alte NATO-Formel, dass europäische Sicherheit in den USA gemacht werde und zur Bedingung habe "to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down". Denkbar ist dagegen aber auch, dass der politische Paradigmenwechsel in den USA schlichtweg den Effekt hatte, europäische Bemühungen um die außen- und sicherheitspolitische Identität als Bluff und große Illusion zu entlarven.
[Seite der Druckausg.: 11]
In diesem Kontext ist auch nicht verwunderlich, dass bei kleinen Mitgliedsländern wie Beitrittskandidaten erneut alte Ängste angesichts des Zusammenrückens von Berlin, Paris und Moskau auftauchten. Ähnlich misstrauisch werden die Bemühungen von Berlin, Brüssel, Luxemburg und Paris interpretiert, den Prozess zur Gestaltung der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Außenpolitik zu forcieren. Das beherrschende Motiv der ost- und mitteleuropäischen Länder für den Beitritt zur NATO war das Versprechen des Schutzes der Souveränität. Sie drängten darauf, aus dem "Niemandsland" zwischen Ost und West und aus der Nähe eines unberechenbaren Russlands zu entkommen. Dieses Ziel, mehr ein Sicherheitsreflex, aus der traumatischen Erfahrung des Kalten Krieges und der Unterwerfung unter die Blockhegemonie der Sowjetunion entsprungen, hat seine Priorität nicht verloren. Im Unterschied dazu war der Beitrittswunsch zur Europäischen Union, die wesentlich als Wirtschaftsgemeinschaft angesehen wird, eher sekundär.
Entsprechend dieser Auffassung, die mit ähnlichen Beweggründen von Ländern der alten EU geteilt wird, verbürgt die USA als europäische Ordnungs- und Schutzmacht zwei Grunderfordernisse. Erstens, die Präsenz des amerikanischen Sicherheitsschirms schützt gegen eventuelle Gefahren der Renationalisierung und verhindert, dass kleine Länder wieder zum Spielball europäischer Machtpolitik werden. Zweitens gewährt sie Schutz gegen eventuelle Unberechenbarkeiten des russischen Entwicklungsweges. Paradoxerweise hat gerade die erfolgreiche russische Europapolitik diesen Reflex verstärkt. Gleichzeitig gefährdet die amerikanische Sicherheitsdoktrin nicht nur die Existenz der Vereinten Nationen. Falls erforderlich, setzt sie nationale Interessen, auch gegen den Willen und ohne die Mitwirkung von Bündnispartnern oder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, mit militärischen Mitteln durch.
Dieser fundamentale Wandel wirft für die Europäische Union und für die NATO die existenzielle Frage auf, was denn der Sinn, die Raison d’être, einer europäischen außen- und sicherheitspolitischen Identität und Politik sei, wenn Europa auf dem Kontinent nicht mehr bedroht ist und auf internationalem Terrain nicht gebraucht werde? Die Verweigerung dieser Frage berührt also direkt die Existenz des transatlantischen Bündnissystems. Denn aus der Logik der amerikanischen Sicherheitsdoktrin folgt, dass dem Hegemon internationale Rechtsnormen und Bündnisverpflichtungen nur hinderlich sind, es sei denn, sie gruppieren sich um die einzige Weltmacht.
Mit dieser neuen Realität werden sich auch die "atlantisch" gesinnten Staaten und innerstaatlichen Gruppen in Europa auseinandersetzen müssen. Die EU wird sich der Wahl zwischen der weltpolitischen Hegemonie unter Führung der USA oder der Stärkung multipolarer Strukturen nicht entziehen können. Letzteres bedeutet, das Völkerrecht und die Reform der Vereinten Nationen voranzubringen. Dabei werden Ansätze zur Schaffung europäischer Strukturen der Verteidigung und der gemeinsamen Außenpolitik eine wichtige, und nicht nur regionale Rolle spielen.
Informelle Allianzen Gleichgesinnter –
ein zukünftiges Strukturprinzip der internationalen Staatengemeinschaft?
Angesichts des schleichenden Abrückens der amerikanischen Politik von europäischen Bündnispartnern und des fundamentalen Wandels im Sicherheitsdenken hat Jim Hoagland in The Moscow Times (31.1.2003) die Frage aufgeworfen, ob von den USA neue Trennlinien definiert würden, die nicht mehr geographischer Natur sind, wie noch zu Zeiten des Kalten Krieges. An die Stelle der alten Konfliktlinien seien normative, poli-
[Seite der Druckausg.: 12]
tisch-kulturelle oder religiös-ethnische Trennlinien getreten, die mit Bedrohungsszenarien verknüpft werden. Ihrer Natur nach entziehen sich diese Konflikte der klaren institutionellen und damit auch überprüfbaren Zuordnung. Es komme daher auf den politischen Willen, auf die Gemeinsamkeiten bei der Bedrohungseinschätzung an und erfordere eben jene "Führungsvision" "to counter the spread of atomic, biological and chemical weapons and missile systems to irresponsible regimes and terrorist networks". Das Verhalten der Bush-Administration im Irak-Konflikt, die sich gegen jedwede rationale Argumentation und Fakten verschloss, illustriert diese These in bestürzender Weise.
Im Lichte solcher Überlegungen stellt sich dann auch die Frage, ob die Bush-Administration nicht absichtlich polarisierende Strategien für einen Show down mit dem alten Europa gewählt hat. Damit bezweckten die Amerikaner zweierlei, einerseits die Schwäche der EU aufzudecken und andererseits die zukünftigen Mitgliedsländer fest auf die amerikanische Politik einzustimmen. Aussagen, die diese Annahme nahe legen, sind von Mitgliedern der amerikanischen Regierung, insbesondere von Verteidigungsminister Rumsfeld, gezielt zur Diskriminierung von Mitgliedsländern der EU eingesetzt worden.
Akzeptiert man die Grundprämissen des normativen und sicherheitsdoktrinären Paradigmenwechsels hin zur Militarisierung des politischen Denkens, dann kann den USA an Alternativvorstellungen internationaler Politik, die zudem noch von einem unabhängigen und demokratischen Europa vertreten werden, wenig gelegen sein. Jedwede eigenständige Friedenspolitik eines demokratischen Europa, legitimiert durch die Vereinten Nationen, war und wird die hegemoniale Politik der Bush-Administration herausfordern und gefährden. Es handelt sich also um eine Neuauflage der Systemkonkurrenz zwischen zwei normativen Gestaltungsprinzipien der internationalen Politik. Hier tritt wohl ein Grund zu Tage, warum die Bush- Administration im Irak-Konflikt nicht das Risiko eingehen konnte, den europäischen Alternativvorschlägen für eine friedliche Entwaffnung mehr Zeit und Raum zu bewilligen. Es bestand die Gefahr, dass die amerikanische Argumentation zusammenbräche und sich die europäische zivile Konfliktbewältigung als erfolgreich herausstellte. Ein solcher Ausgang der Krise hätte schwerwiegende innenpolitische Folgen in den USA ausgelöst und die Bush-Administration samt ihres hegemonialen Politikansatzes infrage gestellt.
Gemäß der Logik des amerikanischen Sicherheitsdenkens sind temporäre Bündnisse und ad hoc Koalitionen mit lokalen und regionalen Kräften ein erheblich adäquateres Instrument, um gegen globale terroristische Gefahren und "Schurkenstaaten" vorzugehen. Mit dieser Betrachtung, die auf die neuen terroristischen Herausforderungen in erster Linie abstellt und feste regionale oder internationale Allianzen ebenso wenig benötigt wie Institutionen kollektiver Sicherheit, glaubt sich die Bush-Administration nicht allein. "The United States, Israel, India and Russia fall on the same side of that line. They all pursue missile defense programs that could eventually reinforce each other’s security". So erklärte der amerikanische Vizepräsident Dick Cheney lakonisch in einem Pressegespräch in NBC, dass die Institutionen und Allianzen des zwanzigsten Jahrhunderts, heute nicht mehr über adäquate Strategien verfügten, um mit den gegenwärtigen Bedrohungen fertig zu werden. Diese Grundeinstellung durchzieht nahezu auch alle offiziellen Verlautbarungen des amerikanischen Präsidenten.
Ähnliche Gedanken werden von neokonservativen Haudegen aus der Reagan-Ära, wie William Kristol, Richard Perle u.a., die heute wichtige Beraterfunktionen im Umkreis der Bush-Administration innehaben, geäußert. Beispielsweise will Kristol an die Stelle der alten Bündnisstrukturen, ohne sie aber völlig aufzugeben, "informelle Allianzen von Demokratien" setzen, die sich im wesentlichen auf normative Überzeu-
[Seite der Druckausg.: 13]
gungen und den politischen Willen Gleichgesinnter stützen. In einem so international umgestalteten Bündnissystem wäre sogar Platz für die Vereinten Nationen, wenn sie sich an die gewandelten Machtverhältnisse und an die neue Realität in den internationalen Beziehungen anpassten und Hilfsfunktionen übernähmen. Die von der Bush-Administration angestrebte Nachkriegsordnung im Irak weist in diese Richtung.
Die US-Sicherheitsdoktrin und die unnachgiebige Politik der Bush-Regierung in der Irak-Frage haben das Dilemma der Europäer, aber auch der russischen Politik unverkennbar gemacht. Spätestens seit dem Paradigmenwechsel in der russischen Europapolitik und beschleunigt durch den Beitritt zur globalen antiterroristischen Koalition, ist das Land aus der sowohl bedrohlichen als auch komfortablen Marginalisierung am Rande Europas herausgetreten und zum Akteur im internationalen System geworden. Russland ist in die europäische Politik integriert worden, aber als Teil der europäischen Politik sind die Probleme Europas nun auch die Probleme Russlands.
Obwohl die europäische Kritik am Vorgehen Washingtons wie eine späte Rechtfertigung für eigene Beurteilungen amerikanischer Intransigenz aus den 1990er Jahren klingt, ist die russische Politik nicht frei von Illusionen über mögliche Sonderwege und Sonderbeziehungen. Dass solche Vorstellungen in Kreisen der außen- und sicherheitspolitischen Elite des Landes kursieren, ist offenkundig und unterminiert die mühsam erworbene Berechenbarkeit der letzten Jahre. Trotz der Bekundungen, sich nicht in die Zwickmühle zu begeben, zwischen Europa und der geostrategischen Partnerschaft mit den USA wählen zu müssen, bleibt ein Element der russischen Außenpolitik die Schaukelpolitik. Gemeinsam mit den Europäern werden die unilateralen Aktionen und die Machtarroganz der amerikanischen Außenpolitik kritisiert. Mit den USA wiederum einen der gemeinsame Kampf gegen den internationalen Terrorismus und die Abwehr europäischer Vorhaltungen im Tschetschenienkonflikt.
Illusionen in der Außenpolitik:
eine russische Mittlerrolle im transatlantischem Dialog?
Trotz aller Kritik am Vorgehen der Bush-Administration und obwohl ein tiefer Riss durch Europa geht, stellt die europäische Opposition nicht das transatlantische Bündnis infrage. Für die russische Politik wäre es daher fatal, die gegenwärtigen Spannungen zwischen einigen europäischen Mitgliedsländern und den USA zu überzeichnen, um daraus etwa einen russischen Sonderweg (Georgien, Pankisi, Tschetschenien, Abchasien) – möglicherweise mit Billigung Washingtons – oder als dessen Juniorpartner abzuleiten.
An dieser Stelle erscheint eine gewisse Ungereimtheit in der russischen Außenpolitik, die sich wie ein roter Faden auch durch die unterschiedlichen Positionen der ideologischen Schulen zieht. Gemeint ist einerseits das legitime Interesse, die Beziehungen zu den USA und zu Europa vorteilhaft zu entwickeln. Das beinhaltet, die Isolierung des Landes durch eine unberechenbare Schaukelpolitik zu vermeiden und eine gestaltende Funktion sowohl im atlantischen Dialog als auch in Fragen europäischer und internationaler Sicherheit im Einklang mit den geopolitischen Besonderheiten des Landes zu übernehmen. Die aus diesen Zielen abgeleitete Politik kann aber andererseits nicht umhin, auch die Frage nach der Qualität und Wertigkeit von Beziehungen zu stellen. Grundlegend stellt sich die Frage, ob das neue Russland als föderative, demokratische Ordnung die gleichberechtigte Sicherheitspartnerschaft und Zusammenarbeit mit Europa sucht oder ob es vorzieht, die hegemoniale Neuordnung der Welt gemeinsam mit den USA zu betreiben und sich mit der Rolle des Juniorpartners zu begnügen.
[Seite der Druckausg.: 14]
Unterstellt man der USA den Alleinanspruch auf Hegemonie und erwägt die Konsequenzen der Sicherheitsdoktrin für die amerikanische Bündnispolitik weltweit, dann kann es auch mit Russland nur temporäre Zweckbündnisse, aber keine strategische Partnerschaft geben. Es sei denn, die russische Politik akzeptiert vollends die Rolle des Juniorpartners und versucht also, an die Stelle des alten Europa zu treten, das diese Funktion während der Ära des Kalten Krieges bis zum Ende des Millenniums ausfüllte.
Wie schon angedeutet, haben neue Strömungen die alten Lager der Jelzin-Ära in der Außen- und Sicherheitspolitik aufgelöst, bzw. überlagert. Die frühere Polarität zwischen Eurasiern und Westlern gehört schon seit geraumer Zeit der Vergangenheit an. Sie war ohnehin nie ausschließlich. Gemäß dieser Denkschule gab es reale Chancen für einen isolationistischen Sonderweg, falls die strategische Partnerschaft mit asiatischen Mächten gelingen würde und Russland so der (technologischen) Westorientierung etwas entgegenstellen könnte. Der Einfluss euroasiatischen Denkens, in der Primakowschen Konzeption der Multipolarität angesprochen, entbehrte jedoch immer einer realen Grundlage. Nicht, dass solche Ideen nicht mehr bestünden. Sie haben allerdings angesichts der nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung des Landes, der Integration wichtiger russischer Industriekomplexe in den Weltmarkt, der fortschreitenden Kooperation und Fusion von russischen, europäischen und amerikanischen Kapitalgruppen sowie der Transformation russischer Holdings zu transnationalen Konzernen weder gegenwärtig noch zukünftig eine wirtschaftliche oder gesellschaftliche Basis.
In der Präsidentschaft Putins verlief die Differenzierung der außen- und sicherheitspolitischen Denkschulen entlang der vorgegebenen wirtschaftlichen Achse. Insofern unterscheidet sich dieser Vorgang von den ideologischen Postulaten der frühen 90er Jahre, die jedweder wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlage entbehrten.
Die Differenzierung erfolgte also innerhalb der Gruppe, die sich für die Annäherung oder sogar Einbettung des Landes in westliche Wert- und Gesellschaftsvorstellungen aussprach. Im Großen und Ganzen und mit vielerlei Überschneidungen kristallisierten sich in den letzten drei Jahren zwei Hauptgruppen außen- und sicherheitspolitischen Denkens heraus: die "Atlantiker" und die "Triangulären". Die euroasiatischen Gruppierungen bestehen weiter, haben aber weiter an Einfluss verloren. Wohlgemerkt erfolgte diese Differenzierung auf der Basis vollzogener Westorientierung. Sie ähnelt in gewisser Weise den Auseinandersetzungen in der Europäischen Union zwischen den transatlantischen Anhängern europäischer Sicherheit und den Befürwortern eines stärkeren und eigenständigen europäischen Pfeilers.
Zwar sind die Motive unterschiedlich, doch auch Russland hat "atlantische" Denktraditionen, die noch stark von der vormaligen imperialen Vergangenheit geprägt sind. Die russische Fraktion der "Atlantiker" knüpft an diese Tradition an und stellt geostrategische Ziele in den Vordergrund. Fernziel ist die nahezu mythisch beschworene "strategische Partnerschaft" mit den USA, die selbst unter den Bedingungen der Juniorpartnerschaft angestrebt wird. In der hochstilisierten "strategischen" Orientierung gehen post-imperiale, autoritär-zentralistische und isolationistische Strömungen eine merkwürdige Synthese ein, die kaum reale Ziele benennen kann und losgelöst von der sozioökonomischen Realität des Landes scheint. Vorsichtige Unterstützung findet diese Denkschule bei Kapitalgruppen des Rohstoff- und Energiebereichs, in erster Linie einiger Ölkonzerne wie Jukos und Sibneft, die im April 2003 fusionierten und den viertgrößten Ölkonzern der Welt schufen.
[Seite der Druckausg.: 15]
Die "Atlantiker-Fraktion" unter der russischen außen- und sicherheitspolitischen Elite spiegelt in gewisser Weise die Innenarchitektur der russischen Politik wider. Gemäß ihrer extrem realpolitischen Grundhaltung suchen sie hierarchisch-zentralistische Machtverhältnisse der Innenpolitik als Strukturprinzip des internationalen Systems auszumachen. Auf eine Kurzformel gebracht heißt das, die Loyalität zum Präsidenten findet ihr Pendant in der Loyalität zur USA in einer hegemonial strukturierten Staatengemeinschaft.
Daneben stehen demokratische Traditionen, wie sie etwa von Jabloko und der Union der Rechten Kräfte repräsentiert werden. Diese politischen Gruppierungen haben sich immer durch eine pro-amerikanische Politik ausgezeichnet, nicht zuletzt, weil sie von dort Unterstützung erfuhren.
Die Irak-Krise machte die Differenzierung in der russischen außen- und sicherheitspolitischen Elite offensichtlich. Die atlantische Fraktion stand offen auf der Seite der USA und warnte davor, sich einseitig im transatlantischen Konflikt auf die Seite der europäischen Kritiker zu schlagen oder gar eine Mittlerstellung zwischen der EU und den USA anzustreben.
Die Auseinandersetzung ist, ähnlich wie in Europa, nicht mit dem Irak-Krieg beendet worden. Über die Grundfrage, welche Rolle Russland in der internationalen Politik spielen und mit welchen Partnern es stärker zusammenarbeiten solle, ist eine heftige Auseinandersetzung entbrannt. So warnen die Atlantiker Andrej Piontkovskij und Pavel Felgenhauer, dass sich Russland ungezwungen in "schlechte Gesellschaft", nämlich in die Frankreichs und Deutschlands, begeben und damit leichtfertig und ohne Not nationale Interessen aufs Spiel gesetzt habe. Pavel Felgenhauer argumentiert, dass eine neue "Bush-Brezhnev-Doktrin limitierter Souveränität" auf dem Weg sei, die Grundlage des Völkerrechts zu bilden. In einem Seitenhieb auf die französische und deutsche Politik schiebt er den beiden Mächten und Russland den Schwarzen Peter an der Blockierung des Sicherheitsrates zu und charakterisiert die französische Drohung mit dem Veto als Irrsinn, die letztlich nur eines erreicht habe, "to seriously undermine the authority of the UN and cripple existing international law" [1] .
Wie auch andere plädieren beide offen für die strategische Partnerschaft mit den USA und gegen Europa. Letztlich hätten die USA durch ihr entschlossenes Vorgehen in Afghanistan die russische Südflanke gegen islamistische Terroraktionen gesichert. Die amerikanische Präsenz in Zentralasien wirke für Russland schon jetzt wie ein Schutzschild. Piontkovsky geht noch einen Schritt weiter und greift den russischen Außenminister direkt an. Dieser habe eine abstrakte, mythische Vorstellung von einem Europa, die nichts mit der Realität gemein habe und auch nicht die spezifischen Realinteressen Frankreichs oder Deutschlands berücksichtige. Unterstellt wird, dass beide Länder den Konflikt mit den USA nur aus innen- und Europa-politischen Motiven schürten.
Neben der "atlantischen Fraktion" gediehen auch andere Hoffnungen und Träume namhafter russischer Politiker, die eher zur zweiten großen Strömung in der Außen- und Sicherheitspolitik, zur "triangulären Fraktion", gezählt werden können. Zu dieser Gruppe können vielleicht all jene Experten und Politiker gezählt werden, die sich von post- imperialen Phantasien befreit haben und sich für eine aktive, seinen Möglichkeiten entsprechende, verantwortungsvolle Rolle des neuen Russland in der internationalen Politik einsetzen. Basis dieser Politik ist eine enge Verbindung mit der Europäischen Union und intensive Beziehungen zu
[Seite der Druckausg.: 16]
ihren wichtigsten Mitgliedsstaaten. Die trianguläre Orientierung hängt also stärker der multipolaren Konzeption als Strukturprinzip der internationalen Beziehungen an. Im Unterschied zum früheren Modell Primakows, sucht sie die Gefahren einer Schaukelpolitik oder eines Sonderweges zu umgehen. Daraus resultierte besonders im Irak-Konflikt, der Versuch, sich nicht in das Dilemma einer alternativen Festlegung für Europa oder für die USA zu begeben. Die Differenzen zwischen den USA und seinen europäischen Verbündeten wurden als temporäre eingeschätzt. Daher träumte die trianguläre Strömung von einer vermittelnden Rolle Russlands in den transatlantischen Konflikten und Beziehungen.
Die bedingungslose Unterstützung der amerikanischen Irakpolitik durch den britischen Premierminister Tony Blair beflügelte derlei Hoffnungen. So argumentierten denn auch Nikolas Gvosdev und Ray Takeyh, die russische Politik habe eine historische Chance, eine gewaltige geostrategische Umwälzung auszulösen und England aus der Position des transatlantischen Mediators zu verdrängen, um sich selbst als Retter der transatlantischen Einheit zu präsentieren. "President Putin has sensed in the current trans-Atlantic crisis an opportunity to displace Britain as the mediating power within the West. In turn, Washington is increasingly viewing Moscow – not London – as its principal liaison to France and Germany as a vote in the Security Council draws near." [2] Die überraschende Wertschätzung der atlantischen Gemeinschaft durch den russischen Außenminister Igor Ivanow weist in die gleiche Richtung. "The preservation of a unified Euro-Atlantic community, with Russia now part of it, is of immense importance." Ziel der russischen Politik sei, so Igor Ivanow, eine konstruktive Partnerschaft, "between my country, Europe and the United States" zu entwickeln [3]
Diese triangulären Gedanken spiegeln die offizielle Politik wider. Angesichts des Paradigmenwechsels in der amerikanischen Politik sind sie nicht so abwegig und illusionär. Russland kann beide Seiten als glaubwürdiger Partner bedienen: Es kann den anti-terroristischen Kampf der USA unterstützen und sich den Europäern als Bündnispartner in der Abwehr unilateraler Militäraktionen der USA andienen.
An zwei wesentliche Voraussetzungen ist der Erfolg eines solchen perspektivischen Vorhabens aber gebunden: Erstens, dass beide Seiten Russland als zuverlässigen und berechenbaren Partner anerkennen. Zweitens, und diese Voraussetzung ist mit der ersten untrennbar verknüpft, die erfolgreiche Fortführung des Projektes der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Modernisierung sowie der fortschreitenden Demokratisierung des Landes.
Die trianguläre Politik ist somit, wenn ihre Prämissen aufgehen, die außenpolitische Entsprechung des innenpolitischen Modernisierungskurses, an dessen Ende die Rekonstitution Russlands als Großmacht im Konzert der europäischen Demokratien und als Bündnispartner im internationalen Kampf gegen den Terrorismus steht. Dieses Ziel ist aber nicht gegen den Widerstand der EU oder der USA zu erreichen, und erfordert zudem die feste Einbindung des Landes in westliche Normen und Institutionen. Für die russische Europapolitik impliziert das die Teilhabe am gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum, wenn nicht gar an der politischen und sicherheitspolitischen Dimension des europäischen Integrationsprozesses.
Nur auf dieser Basis, integriert in die kollektive Verantwortung für Europa und für internationale Probleme, ist auch das Funktionieren der "Juniorrolle" für den Welthegemon denkbar. Die russische Außenpolitik ist daher an externe Bedingungen gebunden, die zwar in ähnlicher Weise für Europa, nicht aber für die USA in
[Seite der Druckausg.: 17]
der gegenwärtigen Zeit gelten. Ihr Handlungsspielraum gegenüber den USA oder gegenüber der Europäischen Union, aber auch innerhalb der informellen Allianz, die sich im Gefolge des Irak-Konfliktes herauskristallisiert hat und die allem Anschein nach, auch dessen Ende überdauern wird, ist von der Qualität der jeweiligen anderen Beziehung abhängig. Konkret, die russische Politik hat in der Juniorrolle des Welthegemons eine größere Handlungsfreiheit, wenn ihre Beziehungen zur Europäischen Union sich partnerschaftlich vorteilhaft entwickeln und intensiviert werden. Umgekehrt gilt, dass die partnerschaftliche Kooperation mit der EU die russische Position in der Beziehung zu den USA stärken.
In gewisser Weise, so paradox es klingen mag, knüpfen die "triangulären" Vorstellungen, ohne dass darauf rekurriert wird, an die erste Phase der russischen Außenpolitik in der post-kommunistischen Ära an, die später als "romantische Westorientierung", als Verirrung, diskreditiert wurde. Aber die neue "West- oder trianguläre" Orientierung der russischen Außenpolitik steht innenpolitisch auf anderen, auf gesellschaftlich differenzierten, wirtschaftlichen gesunden und institutionell gefestigten Beinen. Außenpolitisch ist das Land aus der Isolierungsfalle der 90er Jahre herausgekommen. Die Thesen der russischen "Atlantiker", dass Länder wie Frankreich und Deutschland für die russische Politik an Bedeutung im Vergleich zu den USA verlieren, sind daher nicht nur fragwürdig, sie bergen auch die tendenzielle Gefahr einer erneuten Isolierung.
Nur eingebettet in die europäische Politik, so kann postuliert werden, wird sich die Transformation Russlands zur verantwortungsvollen, verlässlichen und demokratischen Prinzipien verpflichteten Großmacht vollziehen. Eingebettet in diesen Kontext konterkariert sie auch nicht amerikanische Hegemonialinteressen. Im Gegenteil, die Dreieckspolitik des russischen Präsidenten offeriert der Bush Administration eine ausgezeichnete Gelegenheit, die transatlantischen Beziehungen im 21. Jahrhundert neu zu gestalten. Das berührt auch europäische Interessen, vor allem angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, mit der sich die Existenzfrage der NATO erneut stellen wird. Es scheint schwer vorstellbar, dass die alte Organisation die Vielzahl der neuen Mitglieder problemlos absorbieren kann. Zudem muss eine neue Sicherheitsagenda her, die berücksichtigt, dass die Gefahr des Kalten Krieges vorüber und Russland ein wichtiger Bündnispartner der USA im anti-terroristischen Kampf geworden ist, von dem für Europa keine Gefahr mehr ausgeht. Dieser Logik zufolge wird sich der Abstand Russlands zur NATO verringern. Als militärische Kraft in Europa kann Russland zum komplementären Bindeglied für sicherheitspolitische Bemühungen der Europäischen Union werden.
Welche arbeitsteiligen Rollen dabei einzelne Ländern erhalten, ist noch nicht abzusehen. Wladimir Frolov, Berater des Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses der Duma, argumentiert, dass die russische Politik erstmals seit 1945 in der Lage sei, die USA daran zu hindern, eine destabilisierende Politik durchzusetzen. Dennoch bleiben die Beschränkungen für die russische Außenpolitik. Sie muss aus eigenen Interessen den schwierigen Drahtseilakt zwischen Europa und den USA meistern. "A strong and trusting relationship with the United States is important to enhance Russia’s influence in the world. But a constructive constraint on Washington’s unilateralist behavior, exercised in concert with other U.S. allies, is equally important for creating a predictable international environment for Russia’s rebuilding" (The Moscow Times, 5.3.2003). Aber, ob als Vermittler im transatlantischem Dialog oder als Mitglied einer transatlantischen Bündniskonstellation, selbst im ureigenen militärischen Feld wird und kann Russland dem Vereinigten Königreich die Rolle des militärischen Haudegens nie streitig machen. Das kann auch nicht im russischem Interesse liegen.
[Seite der Druckausg.: 18]
Perspektivische Thesen
für europäisch-russische Alternativen zum US-amerikanischen Unilateralismus
1. Selbst unter der recht unwahrscheinlichen Annahme, dass es in absehbarer Zeit zur Ausformulierung und Schaffung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) kommen sollte, kann weder die russische Politik allein, noch gemeinsam mit der Europäischen Union, die USA daran hindern, unilaterale Politik zu betreiben. Sie kann allenfalls, wie die Erfahrungen in der Irak-Krise zeigen, die Legitimität und Legalität amerikanischen Vorgehens öffentlich hinterfragen und gegen den völkerrechtswidrigen Einsatz militärischer Zwangsmittel eigene Alternativen vortragen.
2. Die Europäische Union sollte zusammen mit Russland jeden Versuch zur Beeinträchtigung der Rolle und Zuständigkeit der Vereinten Nationen entschieden zurückweisen.
3. Gemäß der Annahme, dass die unilaterale Politik des Hegemons nicht von außen korrigiert, höchstens eingezäunt werden kann, haben Europa und auch die Russische Föderation ein essentielles Interesse an der politischen Beilegung von Konflikten. Konfliktlösungen müssen international und offen diskutiert werden. Die Tabuisierung oder die Ausgrenzung Europas sowie Russlands muss entschlossen und einvernehmlich abgewiesen werden.
4. Der Zusammenhang zwischen Fragen der internationalen wie regionalen Sicherheit und den neuen Gefahren des internationalen Terrorismus, der oft aus ungelösten und verschleppten Konfliktlagen herrührt und soziale, wirtschaftliche Notlagen zum Ausdruck bringt, muss thematisiert werden.
5. Gerade die Erfahrungen einiger europäischer Länder zeigen, dass der Kampf gegen den Terrorismus nicht ausschließlich militärisch geführt und gewonnen werden kann. Eine Kombination aus Dialogbereitschaft, Entwicklungsanstrengungen zur Behebung sozioökonomischer Ungerechtigkeit, die Wiederherstellung menschlicher Würde sowie die Einhaltung von Minderheitsrechten sind wesentliche Faktoren in diesem Kampf.
6. Dem Definitionsmonopol unilateraler und hegemonialer Politik kann nur durch plausible und konkrete Gegenentwürfe begegnet werden. Die europäische Politik kann auf eine Fülle von Erfahrungen im Umgang mit terroristischen Bewegungen verweisen, die aber allesamt den normativen Rahmen von Verfassungsgeboten respektierten und der "wehrhaften" Demokratie Grenzlinien markierten.
7. Unter der Annahme, dass Russland integraler Bestandteil der westlichen und europäischen Wertegemeinschaft geworden ist und sowohl durch bilaterale Beziehungen zu den USA, aber auch durch Teilhabe am integrativen Prozess in Europa auf und in den transatlantischen Beziehungen wirkt, kann der russischen Politik das Schicksal der Europäischen Union nicht gleichgültig sein. Umgekehrt gilt, dass die Europäische Union an der demokratischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung Russlands ein essentielles Interesse haben muss.
[Seite der Druckausg.: 19]
8. Das beiderseitige Interesse an der optimalen Entfaltung politischer, wirtschaftlicher, aber auch sicherheits- und internationaler Interessen muss Belastungen aushalten und kann nicht von der jeweiligen Innenarchitektur abstrahieren.
9. Die Voraussetzung für eine aktive Rolle Russlands in Europa ist an den Erfolg der eingeleiteten Modernisierungsstrategien gebunden. Die fortschreitende Entwicklung partizipatorischer Elemente in der russischen Demokratie wird letztlich dazu beitragen,
- politische und gesellschaftliche Konfliktpotentiale im eigenem Land zu entspannen,
- soziale und wirtschaftliche Diskrepanzen, die sich im Transformationsprozess noch verschärft haben, zu reduzieren,
- politische Stabilität konsensual und pluralistisch zu begründen und damit die Legitimationsbasis der Machteliten zu vergrößern,
- Berechenbarkeit und Verantwortlichkeit des russischen Außenverhaltens in Europa aufzuwerten und somit die "Fluchtreflexe" ehemaliger Satellitenstaaten zu überwinden,
- stabile Rahmenbedingungen für die Fortentwicklung der sicherheits- und außenpolitischen Dimension des europäischen Integrationsprozesses zu gewähren und das komplementäre Zusammenwirken von NATO, ESVP um die russische Komponente zu erweitern.
10. Die institutionalisierte Kooperation europäischer und russischer Sicherheitsinstitutionen sind ein wesentlicher Faktor zur Erhöhung der Akzeptanz russischer Mitwirkung an Sicherheitsfragen in Europa und in internationalen Konfliktlagen. Dies gilt nicht nur auf dem Gebiet der inneren Sicherheit, militärisch als auch analytischem in der Einschätzung von Bedrohungen, sondern auch für die Erprobung und Steigerung der Effektivität multilateral geführter Militärverbände.
[Fußnoten]
Fn_1: Andrej Piontkovsky, "President in Bad Company", in: The Moscow Times, 18.03.2003, S. 12, and Pavel Felgenhauer, "Bush’s Brezhnev Doctrine", in: The Moscow Times, 20.03.2003, S. 9.
Fn_2: Nikolas Gvosdev/Ray Takeyk, "Trans-Atlantic Putin", in: The Moscow Times, 03.03.2003, S. 10.
Fn_3: Ebenda; siehe auch den Beitrag des russischen Außenministers Igor Ivanow, in: Financial Times, 14.02.2003.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | August 2003