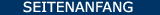![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
-
Franz Josef Krafeld
- Von der Aufklärungsarbeit zur akzeptierenden Arbeit
- Erste Grundlage: Das Angebot sozialer Räume
- Zweite Grundlage: Beziehungsarbeit statt Aktivitätenpädagogik
- Dritte Grundlage: Die Akzeptanz bestehender Cliquen
- Vierte Grundlage: Entwicklung einer lebensweltorientierten infrastrukturellen Arbeit
- Literaturhinweise:
Sozialpädagogische Arbeit mit "rechtsextremen" Jugendlichen
[Seite der Druckausg.: 61]
Franz Josef Krafeld
Sozialpädagogische Arbeit mit "rechtsextremen" Jugendlichen
Ich setze den Begriff "rechtsextrem" im Titel meines Vortrages ausdrücklich in Anführungszeichen. Denn dieser Begriff stammt aus dem Verfassungsrecht und bezeichnet Feinde, die es zu bekämpfen oder gar auszugrenzen gilt. Feinderklärungen sind aber schlechterdings unvereinbar mit pädagogischen Absichten. Ich greife diese ungeeignete Formulierung hier auf, weil sie weithin gängig ist und gleichzeitig exemplarisch deutlich macht, wie sich gerade im Feld von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt immer wieder pädagogische Absichten schon in den Startlöchern selbst blockieren.
Ich möchte hier stattdessen sprechen von Jugendlichen, die durch rechtsextremistische Orientierungen und hohe Gewaltbereitschaften besonders auffallen. Diese Gruppe Jugendlicher ist erst in allerletzter Zeit in das Blickfeld von sozialer Arbeit gerückt. Wir haben im September 1992 in Bremen eine erste bundesweite Fachtagung von Praktikerinnen und Praktikern in diesem neuen Handlungsfeld veranstaltet und sind in dem Zusammenhang – abgesehen von den Fußball-Fan-Projekten – auf maximal 20 Projekte in den alten Bundesländern und West-Berlin und weiteren maximal 30 Projekten in den neuen Bundesländern gestoßen, die sich speziell an diese Gruppierungen wenden. Und die meisten dieser Projekte stehen noch in den Anfängen.
Wohl einmalig ist dagegen der Arbeitszusammenhang, aus dem ich Ihnen hier Erfahrungen und konzeptionelle Schlußfolgerungen in der Arbeit mit rechten Jugendcliquen vorstellen möchte: In insgesamt vier verschiedenen Stadtteilen Bremens haben wir seit Ende 1988 eine Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen aufgebaut. Der Ausgangspunkt waren immer massive Konflikte mit solchen Cliquen und Szenen und deren parallele Versuche, irgendwo eigene Treffpunkte zu finden. So wurde in einem Fall mit einer größeren Clique ein eigenständiger Jugendclub aufgebaut, den die Jugendlichen schon lange weitgehend selbst organisieren, des weiteren wurde eine Clique im Jugendraum eines erwachsenenzentrierten Bürgerhauses betreut – das einzige inzwischen beendete Projekt –,
[Seite der Druckausg.: 62]
schließlich wurde die Arbeit mit einer dritten Clique aufgenommen, die sich im Umfeld eines Jugendfreizeitheims trifft. Und im letzten Jahr dann wurde in einem vierten Stadtteil mit einem Projekt aufsuchender Arbeit begonnen.
Alle vier Projekte waren aus einem studienbegleitenden Projekt im Rahmen der Sozialarbeiterinnen-Ausbildung entstanden, das sich ursprünglich ganz unverhofft mit dieser sogenannten "Problem"-Gruppe konfrontiert gesehen hatte. Aus der Praxis heraus haben wir dann versucht, systematisch unsere Erfahrungen aufzuarbeiten und uns konzeptionelle Grundlagen für dieses Handlungsfeld zu erarbeiten. Wir haben diesen Ansatz bewußt pointiert als "Akzeptierende Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen" bezeichnet. Und dieser Begriff hat sich inzwischen – über unsere Publikationen zu dem Projekt – auch weitgehend durchgesetzt.
Ich möchte mich im folgenden darauf konzentrieren, diese konzeptionellen Grundlagen und einige zentrale praktische Handlungsansätze zu skizzieren.
Von der Aufklärungsarbeit zur akzeptierenden Arbeit
Am Anfang unserer Arbeit stand der Versuch, die Jugendlichen aufzuklären und zu informieren, ihren Auffassungen und Sprüchen etwas entgegenzusetzen. Wir erlebten aber sehr bald, daß damit nichts zu erreichen war. Denn solche Situationen eskalierten immer sehr schnell zum undurchschaubaren Knäuel von Auffassungen, Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen, unentwirrbar verquickt mit Provokationen, Sticheleien und Austestversuchen. Bewegen, gar Infragestellen ließ sich darüber allerdings nichts! Vielmehr schlugen solche Situationen immer wieder um in "powerige" und "actionbetonte", oft auch aggressionsbetonte Selbstinszenierungen.
Mit dem Begriff "akzeptierende Arbeit" betonen wir dann später den Abschied von der – ja weithin verbreiteten – Illusion, mit Aufklärung oder Bekämpfung rechtsextremistische Orientierungen die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen zurückdrängen zu können. Fortan, so unsere zentrale Schlußfolgerung, sehen wir die einzige Chance darin, in den Mittelpunkt diejenigen Probleme zu stellen, die Jugendliche haben, nicht die Probleme, die sie machen. Nur wenn es letztlich um die Jugendlichen geht, um die Probleme, die sie haben, dann werden sie
[Seite der Druckausg.: 63]
auch offen werden für neue Auseinandersetzungen mit der Frage, welche Probleme sie anderen machen. Für uns heißt das vor allem: Wir suchen die Jugendlichen darin zu unterstützen, mit ihrem Leben, mit ihrer Lebensbewältigung besser zurechtzukommen. Dabei gehen wir von der Hypothese aus, daß gelingendere und befriedigendere Wege der Lebensbewältigung in aller Regel letztlich auch sozial verträglichere Wege sind.
Hinter diesem konzeptionellen Grundgedanken steht das Verständnis, daß Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt letztlich keine Jugendprobleme sind, sondern gesellschaftliche Probleme, die allenfalls jugendtypische Ausdrucksformen erfahren. Rechtsextremismus und Rassismus mit all den Vorstellungen von Ungleichwertigkeit von Menschen je nach Herkunft und Aussehen sind bis weit in die Mitte unserer Gesellschaft hinein verbreitet. Sie werden nicht durch "jugendliche Gewalttäter", sondern weit eher durch erwachsene Biedermänner und "Nadelstreifenrassisten" verbreitet und hoffähig gemacht, die längst bis in alle etablierten Parteien hinein großen Einfluß haben.
Und Gewalt ist etwas, was Kinder und Jugendliche in dieser Gesellschaft ganz überwiegend als Opfer erleben – vielleicht auch oder gerade diejenigen Jugendlichen, die heute Gewalt-Täter sind. Im Übrigen sind extreme Auffassungen, Provokationen und Gewalt Jugendlicher ganz oft ein wesentliches Mittel, auch dort wahrgenommen und für wichtig genommen zu werden, wo sie es eigentlich nicht (oder nicht mehr) erwarten.
Allerdings, so eine unserer zentralen handlungsleitenden Hypothesen, kann Gewalt zwar sehr viel an Aufmerksamkeit und Beachtung verschaffen, letztlich aber kaum gesellschaftliche Integration bewirken. Das hat zur Konsequenz: Eröffnen sich Chancen, aus dem eigenen Leben was zu machen, so wächst auch die Bereitschaft, sich mit anderen zu arrangieren und auch anderen Entfaltungschancen zuzugestehen. Diese Hypothese haben wir in unserer Arbeit immer wieder bestätigt gefunden – nicht selten auf völlig verblüffende Weise. Wenn etwa "unsere" Jugendlichen mit türkischen Jugendlichen in ihren Jugendclub feierten, während draußen fast eine Hundertschaft Polizei ein Ausländerfest zu schützen suchte. Oder wenn plötzlich türkische Jugendliche den Musikübungsraum mitnutzen durften.
[Seite der Druckausg.: 64]
Dieses konzeptionelle Grundverständnis einer "Akzeptierenden Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen" läßt sich in folgenden vier zentralen Grundlagen unserer Arbeit konkretisieren: dem Angebot sozialer Räume, der Entwicklung einer Beziehungsarbeit statt einer Aktivitätenpädagogik, der Akzeptanz bestehender Cliquen und der Entwicklung einer lebensweltorientierten infrastrukturellen Arbeit.
Erste Grundlage: Das Angebot sozialer Räume
Entgegen der weitverbreiteten Sichtweise sind es nicht Aktivitätenangebote und sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten, die diesen Jugendlichen so sehr fehlen. Was sie weit mehr brauchen, was sie weit mehr vermissen, das ist zunächst einmal Raum, Platz, wo sie nach ihren Vorstellungen und Ideen, nach ihrer Lust und Laune unter sich sein können, ohne gleich zu stören. Wir haben – jedenfalls in Westdeutschland – in den letzten Jahrzehnten erlebt, wie alle Territorien funktionalisiert worden sind und möglichst immer nur noch einen einzigen Sinn haben sollen: als Verkehrsfläche, als Abstandsgrün, als Garagenplatz, als Müllcontainerplatz oder als ökologische Schutzzone. Kinder und Jugendliche kommen bei dieser Verregelung der Umwelt fast nicht vor. Folglich stören sie fast überall, wo mehr als drei oder vier von ihnen zusammen sind. Und umgekehrt ist es ihnen ungemein wichtig, endlich mal irgendwo einen Ort, einen Platz zu haben, wo sie ungestört unter sich sein können. Indem wir die Jugendlichen bei diesem Interesse unterstützt haben, waren sie sehr schnell bereit und interessiert, mit uns Kontakt aufzubauen – etwas, was sonst oft ungemein langwierig und schwierig ist. Diese Erfahrung haben wir parallel auch gemacht, nämlich in unserem Projekt aufsuchender Arbeit.
Freilich waren die Mitarbeiterinnen zunächst vorwiegend dazu gefragt, die Raumnutzung und -gestaltung zu organisieren und dessen Existenz nach außen hin abzusichern. Sie waren – wie Becker u.a. vor etlichen Jahren formulierten – vor allem erst einmal Raumwärterinnen. Sie mußten damit umgehen lernen, daß die Jugendlichen zunächst ungemein empfindsam darauf aufpaßten, daß dieser neugewonnene Freiraum nicht gleich wieder pädagogisch vereinnahmt wird. Für die psychische Belastbarkeit der Mitarbeiterinnen war es geradezu ein Härtetest, ob sie es aushallen und durchhalten könnten, einfach da zu sein und Kontakt anzubieten, ohne sich aufzudrängen und irgendetwas "pädagogisch Sinnvolles"
[Seite der Druckausg.: 65]
zu inszenieren. Ein Mitarbeiter brachte es mal auf die Formel: "Zuhören war anfangs für mich das wichtigste!" – zuhören selbst dann, wenn manche Aussagen noch so haarsträubend oder erschreckend sein mögen.
Zweite Grundlage: Beziehungsarbeit statt Aktivitätenpädagogik
Dieses Zuhörenkönnen und dieses für die Mitarbeiterinnen oft so ungemein schwer auszuhaltende "einfach und selbstverständlich da sein" macht den Kern dessen aus, was wir als zweite zentrale Grundlage unserer Arbeit ansehen: die Beziehungsarbeit. Gefordert ist eine Beziehungsarbeit, die soziale Beziehungen nicht – wie in der Pädagogik sonst leider so ungemein verbreitet – als Einbahnstraße versteht, nach dem Muster: "Du mußt mich selbstverständlich akzeptieren, wie ich bin. Aber genauso selbstverständlich ist ja wohl, daß ich dich überhaupt nicht so akzeptieren kann, wie du bist!" Hier geht es um eine Beziehungsarbeit, die auf gegenseitige Akzeptanz und gegenseitiges Interesse aneinander setzt – trotz oder (mit der Zeit sogar mehr und mehr) gerade wegen der großen Unterschiedlichkeiten voneinander. "Du bist ein Linker, aber mit dir kann man reden!" war der meistzitierte Satz der Praktikerinnen und Praktiker auf der anfangs erwähnten Fachkräftetagung.
In dieser Beziehungsarbeit werden den Jugendlichen mit der Zeit Einzelgespräche immer wichtiger. In unseren Projekten war es nach der Überwindung der Anfangsphase bald üblich, daß sich pro Abend, an dem die Mitarbeiterinnen bei der jeweiligen Clique waren, mindestens zwei solcher intensiveren Einzelgespräche ergaben, die sich dann über mehr als eine halbe Stunde hinzogen. Und für sehr viele jener Jugendlichen ist es etwas bis dahin nie Erlebtes, daß ihnen mal jemand über längere Zeit zuhört – zuhört selbst dann noch, wenn ihnen etliches durcheinandergeht, sie sich wiederholen oder sie so unter Alkohol stehen, daß das klare Sprechen immer schwerer fällt. Aber selbst heute, nach mehreren Jahren, achten diese Jugendlichen immer noch darauf, daß die Initiative zu solchen Gesprächen von ihnen selbst ausgeht und sie es in der Hand haben, worauf sie sich einlassen, was sie wollen und was nicht.
Wichtig ist allerdings, an dieser Stelle zu betonen: Akzeptieren heißt nicht: sich abfinden, fatalistisch hinnehmen oder gar gutheißen. Es heißt vielmehr: Den
[Seite der Druckausg.: 66]
anderen ernst und wichtig nehmen, gerade auch in und mit seinem Anderssein. Wie schwer das auch denen fällt, die sich solchen Jugendlichen oft intellektuell sehr überlegen vorkommen, will ich an einem Detail erläutern: Auch in meinem Umfeld ist es weithin üblich, daß eine gute Diskussion nur die ist, bei der man den anderen überzeugt oder zumindest totgeredet hat, ihm die Gegenargumente ausgegangen sind. Die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, suchen dagegen immer häufiger personengerichtete Gesprächssituationen, in denen sie gerade unsere unterschiedlichen Meinungen und Erfahrungen erkunden wollen. Sie wollen uns in und mit unserem Anderssein kennenlernen und gleichzeitig daraus Anregungen und Anstöße für sich ziehen. Und wenn mich der Austausch mit dieser oder jener Person angeregt hat, etwas weiter zu durchdenken und Neues erfahren zu haben, dann war es ein interessanter Austausch.
Dritte Grundlage: Die Akzeptanz bestehender Cliquen
Die gegenseitige Akzeptanz, die nach unseren Erfahrungen so zentral ist, hat noch eine andere Dimension als die Akzeptanz der Individuen. Gerade im Umgang mit Jugendszenen wie der hier angesprochenen ist über die individuelle Ebene hinaus die Akzeptanz ihrer selbstgeschaffenen sozialen Bezugsysteme ungemein wichtig. Und damit komme ich zur dritten zentralen Grundlage unserer Arbeit: Die Jugendforschung ist sich darin einig, daß Gleichaltrigengruppen von Jugendlichen für diese längst vielfach zu ganz zentralen Sozialisationsinstanzen, zum oft einzigen Ort intensiverer sozialer Einbindungen geworden sind. Der Grund dafür sind die wachsende Individualisierung, der Bedeutungsverlust sozialer Milieus, das Brüchigwerden gesellschaftlich propagierter Integrationskonzepte und die Entstrukturierung der Lebensphase Jugend. Wenn also Cliquen so zentral für Jugendliche geworden sind, dann darf man sie ihnen nicht nehmen wollen, wie es traditionelle Pädagogik bei auffälligen Cliquen immer wieder versucht hat. Dann muß man die Cliquen – wie allgemeiner die Jugendszenen und Jugendkulturen – begreifen als sehr subjektgeleitete Versuche, sich in einer oft höchst unübersichtlich und verworren erscheinenden Welt Wirklichkeit handelnd anzueignen. Und diese Prozesse gilt es zu fördern und zu unterstützen.
[Seite der Druckausg.: 67]
Vierte Grundlage: Entwicklung einer lebensweltorientierten infrastrukturellen Arbeit
Oben habe ich als ein zentrales Grundverständnis formuliert, daß es letztlich um die Probleme gehen muß, die diese Jugendlichen haben, nicht um die Probleme, die sie machen. Und die Probleme, die sie haben, sind nur zum geringsten Teil Probleme, die sich mit pädagogischen Angeboten beheben ließen und im frei gestaltbaren Freizeitbereich angesiedelt sind. Vornehmlich geht es hier immer wieder um Probleme ihrer Lebensentfaltung und Lebensverwirklichung insgesamt, um Probleme des Wohnens, der materiellen Existenzsicherung, des anerkannten Tätig-Seins; ich setze das bewußt nicht gleich mit Beruf, mit Beruf um jeden Preis beispielsweise. Es geht um Probleme damit, überhaupt Raum und Zeit zu haben zur Entwicklung und Erprobung sozialer Kontakte und Beziehungen, es geht um Ansätze zur Bewältigung von lebensgeschichtlich gewachsenen Konfrontationen mit Gewalt (z.B. Gewalt gegen Kinder), Problemen mit Sucht (in den Familien oder mit eigener Sucht), Erfahrungen mit Verelendung, mit Kriminalisierung usw. Sozialarbeit, die soziale Auffälligkeiten abbauen will, muß sich mühen, auch solche Ursachen anzugehen. Sie muß sich einmischen in die infrastrukturellen Lebensbedingungen, die die Problemlagen der Jugendlichen produzieren.
Wir werden z.B. immer mehr damit konfrontiert, daß Jugendliche keinen Wohnraum haben und auch keine Chance für sich sehen, Wohnraum zu finden. Uns wundert die aggressive ausländerfeindliche Stimmung unter diesen Jugendlichen nicht, wenn z.B. eine Mitarbeiterin miterlebt, wie selbst in ihrer Anwesenheit einem Jugendlichen bei einer Wohnungsgesellschaft hämisch geantwortet wird: "Wir haben eine lange Warteliste. Denn erst mal kommen die Aussiedler dran. Aber ich kann dich ja auf den Warteplatz 17.286 setzen." Oder wenn ihr letzter Treffpunkt im Stadtteil mit Fertigbauwohnungen für Aussiedler vollgebaut wird, sie selbst aber nur ausgelacht werden, als sie anfragen, ob sie vielleicht dort auch eine Wohnung erhalten könnten. Ich könnte diese Aufzählung fortsetzen mit Erlebnissen beim Arbeitsamt, beim Sozialamt, beim Wohnungsamt, im Einkaufszentrum, mit der Polizei, im Gefängnis usw. In den Strukturen des Alltags, in ihrer Lebensumwelt stoßen diese Jugendlichen immer wieder auf immense Barrieren und Hindernisse, ihr Leben ein Stück mehr, ein Stück besser in den Griff zu bekommen – es jedenfalls überhaupt mal zu versuchen. Und in diesen Prozeß, in diesen Alltag hat sich Sozialarbeit einzumischen,
[Seite der Druckausg.: 68]
will sie tatsächlich etwas bewirken. Das gilt gerade heute angesichts einer geradezu eruptiven Entfaltung einer gewaltbereiten Szene, die sicherlich mit pädagogischen Angeboten nicht von der Straße zu holen ist.
Literaturhinweise:
Krafeld, F. J. (1991): Eskalation der Gewalt gegen Ausländer – und was tun? deutsche Jugend, Heft 11
Krafeld, F. J. (Hrsg.) (1992): Akzeptierende Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen, Bremen
Krafeld, F. J. (1992): Cliquenorientierte Jugendarbeit. Grundlagen und Handlungsansätze, Weinheim
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Dezember 2001