

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
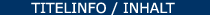
TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 19 ]
3. Wie wird Fremdenfeindlichkeit festgestellt?
Fremdenfeindlichkeit und die verwandten Konzepte wie Ethnozentrismus und Rassismus stellen in der sozialwissenschaftlichen Terminologie latente Konstrukte dar. Damit sind ganz allgemein Merkmale oder Eigenschaftsdimensionen von Personen oder Objekten gemeint, die nicht direkt beobachtbar und meßbar sind und für die deshalb Indikatoren gefunden werden müssen, mit deren Hilfe die gemeinten Sachverhalte indirekt festgestellt werden können. Tatsächlich verfügen alle, die von Fremdenfeindlichkeit sprechen, mehr oder weniger bewußt über eine Reihe von solchen Indikatoren, aufgrund derer sie zum Beispiel eine bestimmte Person als „fremdenfeindlich" einstufen. In der Regel handelt es sich dabei um bestimmte Äußerungen oder um beobachtete Verhaltensweisen und Handlungen, die als indirekte Hinweise auf eine fremdenfeindliche Tendenz aufgefaßt werden. Die sozialwissenschaftliche Forschung geht im Prinzip genauso vor. Auch sie bezieht sich immer auf mehr oder weniger klare, oft nicht näher überprüfte Indikatoren. Zumindest in Teilen der Forschung wird aber darüber hinaus die Notwendigkeit gesehen, Indikatoren und Verfahren zu entwickeln, die es erlauben, möglichst zuverlässige, nachvollziehbare, überprüfbare und generalisierbare Aussagen über Ausmaß und Entwicklung fremdenfeindlicher Tendenzen zu treffen. Ein Großteil der vorliegenden empirischen Untersuchungen zum Thema beruht auf solchen Indikatoren und Verfahren, die allerdings nicht immer transparent gemacht werden, obwohl die Qualität und Aussagekraft der verfügbaren Daten von ihnen maßgeblich abhängen.
Die wichtigsten Indikatoren und Verfahren werden im Folgenden vorgestellt. Vor allem zwei Leitfragen stehen dabei im Mittelpunkt: (1) Wie wird eigentlich Fremdenfeindlichkeit gemessen? (2) Wie zuverlässig sind die verfügbaren Daten?
3.1. Wie wird eigentlich Fremdenfeindlichkeit gemessen?
In Übereinstimmung mit den zuvor vorgeschlagenen begrifflichen Abgrenzungen muß auch bei der Messung von Fremdenfeindlichkeit zwischen den verschiedenen Dimensionen des Phänomens unterschieden werden. Stereotype, Vorurteile und Diskriminierungen werden über verschiedene Indikatoren und Verfahren gemessen. Die Untersuchung von Stereotypen und Vorurteilen beruht in der Regel vor allem auf Befragungen, teilweise aber auch auf Laborexperimenten und auf Inhaltsanalysen etwa von Texten, Rundfunk- und Fernsehsendungen oder Filmen. Bei der Untersuchung diskriminierender Handlungen und Verhaltensweisen wird zumeist auf berichtetes Verhalten, auf Beobachtungen sowie auf eine Reihe indirekter Indikatoren zurückgegriffen. Vom Zuschnitt und der Qualität dieser Verfahren wird der Stand der Erkenntnisse und Erkenntnismöglichkeiten über aktuelle Entwicklungen und Ursachen fremdenfeindlicher Tendenzen zu einem großen Teil bestimmt. Nichtsdestotrotz ist über die jeweiligen Vorzüge und Nachteile dieser Methoden der Informationsgewinnung und der darauf gestützten Datenquellen oft nur wenig bekannt. Deshalb sollen hier wenigstens die wichtigsten Möglichkeiten zur Lösung der eher „technischen" Probleme der empirischen Feststellung bzw. Messung von Fremdenfeindlichkeit kurz erläutert werden.
[Seite der Druckausg.: 20 ]
3.1.1. Das „Standardinstrument": Befragungen
Befragungen, „das Standardinstrument empirischer Sozialforschung bei der Ermittlung von Fakten, Wissen, Meinungen, Einstellungen oder Bewertungen" (Schnell/Hill/Esser 1992: 328), spielen auch bei der empirischen Feststellung fremdenfeindlicher Tendenzen eine herausragende Rolle. Insbesondere Untersuchungen über Stereotype, Vorurteile und die allgemeine Neigung zur Diskriminierung von „Fremden" beruhen auf unterschiedlichen Varianten von Befragungen, die jeweils auf die entsprechenden Dimensionen von Fremdenfeindlichkeit zugeschnitten sind.
Eine der ältesten und zugleich am häufigsten verwendeten Methoden der Messung von Stereotypen ist das sogenannte Eigenschaftslisten-Verfahren, mit dem versucht wird, den spezifischen Inhalt ethnischer Stereotype und die Übereinstimmung innerhalb einer Gruppe über diesen Inhalt des Stereotyps zu erfassen (vgl. zum Folgenden: Brigham 1971; Schäfer/Six 1978; Stroebe/Insko 1989). Zu diesem Zweck wird mehr oder weniger zufällig ausgewählten Personen eine Liste von Adjektiven vorgelegt, aus denen diese zunächst eine beliebige Anzahl von Merkmalen auswählen, die sie als charakteristisch für eine bestimmte Personengruppe einschätzen. In einem zweiten Schritt müssen sie dann ihre Antworten erneut durchsehen und eine kleine Auswahl von Merkmalen angeben, die ihnen als besonders typisch erscheinen. Aus den Angaben aller Befragten wird schließlich nach der Häufigkeit der Nennungen eine Rangliste erstellt, die als Stereotyp der betreffenden Gruppe verstanden werden kann. Dieses recht einfache Verfahren ist inzwischen mehrfach verändert und ergänzt worden, um zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Interpretation der Ergebnisse und Mängel bei der Erfassung stärker differenzierter Meinungen zu verringern. Bei allen Unterschieden in den Details handelt es sich aber bei den an diesen Verfahren orientierten Untersuchungen stets um Erhebungen von Meinungen - also um Befragungen - auf der Grundlage einheitlicher Antwortvorgaben, die Rückschlüsse auf die Verteilung von Überzeugungen über die Eigenschaften bestimmter Personengruppen ermöglichen sollen.
Bei der Messung von Vorurteilen wird in den meisten Fällen ähnlich vorgegangen. Auch dazu werden in der Regel in direkten mündlichen oder schriftlichen Befragungen vereinheitlichte Einstellungs- und Ratingskalen vorgelegt, die im wesentlichen aus vorformulierten Antwortvorgaben bestehen. Grundlage solcher Befragungen ist üblicherweise jeweils ein standardisierter Fragebogen, in dem für alle Befragten die gleichen Aussagen oder Fragen (Items) in gleicher Formulierung und Reihenfolge vorliegen. Zum Beispiel enthielt der Fragebogen der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) über mehrere Jahre hinweg unter anderem folgende, immer gleichlautende Formulierungen:
-
1. Gastarbeiter sollten ihren Lebensstil ein bißchen besser an den der Deutschen anpassen,
-
2. Wenn Arbeitsplätze knapp sind, sollte man die Gastarbeiter wieder in ihre Heimat schicken,
-
3. Man sollte Gastarbeitern jede politische Betätigung in Deutschland untersagen,
-
4. Gastarbeiter sollten sich ihre Ehepartner unter ihren eigenen Landsleuten auswählen.
Auf der Grundlage der zustimmenden oder ablehnenden Antworten auf diese vier vorgegebenen Fragen (auf einer siebenstufigen Antwortskala) können dann Indikatoren negativer Einstellungen und der Tendenz zur Diskriminierung gegenüber „Gastarbeitern" gewonnen werden, mit deren Hilfe eine Einschätzung des Ausmaßes und der Entwicklung der Fremdenfeindlichkeit seitens der deutschen Bevölkerung er-
[Seite der Druckausg.: 21 ]
möglicht wird. Anderen Umfragen liegen meistens ähnliche Item-Formulierungen zugrunde. Im Unterschied zu Befragungen ohne vorgegebene Item-Formulierungen und –Reihenfolge, wie sie zum Beispiel in Ad-hoc-Umfragen von Journalisten oder in „Expertengesprächen" gängig sind, wird damit der Spielraum möglicher Einstellungsäußerungen stark eingeschränkt. Doch letztlich sind nur auf der Basis einheitlicher Item-Formulierungen und standardisierter Interviews generalisierbare Aussagen über größere Bevölkerungsgruppen möglich. Andernfalls können sich zum Beispiel allein schon durch unterschiedliche Frageformulierungen zu viele Verzerrungen ergeben, als daß noch von einem einheitlichen Indikator gesprochen werden könnte. Der Verzicht auf eine größere Vielfalt möglicher Einstellungsäußerungen ist der Preis für eine größere Verallgemeinerbarkeit der Befunde.
Auf mündlichen oder schriftlichen Befragungen im Rahmen standardisierter Interviews beruhen zahlreiche Erhebungen über fremdenfeindliche Einstellungen, die einigermaßen regelmäßig für eine repräsentative Auswahl der deutschen Bevölkerung durchgeführt werden. Dazu zählen vor allem:
• die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS), eine von Bund und Ländern finanzierte bundesweite Umfrage, die vor allem vom Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) in Mannheim konzipiert wird; die Umfragen werden seit 1980 im Zweijahresrhythmus durchgeführt und beinhalten jeweils neben einem konstanten Fragenprogramm einen besonderen Themenschwerpunkt, der sich im Jahr 1996 auf „Einstellungen zu ethnischen Gruppen in Deutschland und zur Immigration" konzentrierte (vgl. dazu Wasmer/Koch/Harkness/Gabler 1996);
• das Eurobarometer, eine im Auftrag der Kommission der Europäischen Gemeinschaft bzw. Europäischen Union in den Mitgliedsstaaten durchgeführte Befragung, die ebenfalls ein weitgehend konstantes Fragenprogramm und wechselnde Themenschwerpunkte umfaßt, wozu auch eine europaweite Sonderumfrage zum Thema „Rassismus und Ausländerfeindlichkeit" aus dem Jahr 1988 zählt (vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1989);
• die Erhebungen des Mannheimer Instituts für praxisorientierte Sozialforschung (IPOS), einem Schwesterinstitut der Forschungsgruppe Wahlen, die in der Reihe „Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik in Deutschland" veröffentlicht werden und regelmäßig auch Einstellungen gegenüber Ausländern erfassen;
• Umfragen der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (BfLR), die in den vom Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) organisierten „Sozialwissenschaften-Bus" eingeschaltet werden und seit 1987 regelmäßig Fragen zu Einstellungen gegenüber Ausländern, insbesondere zur bevorzugten Form des Zusammenlebens, umfassen (vgl. Böltken 1994b).
Diese Untersuchungen sind aus mehreren Gründen aus der Menge der in Deutschland durchgeführten Erhebungen über Meinungen und Einstellungen gegenüber Ausländern bzw. „Fremden" hervorzuheben (vgl. Hill 1993; Jäger 1995: Kap. 4): Sie beruhen, erstens, auf einer Zufallsauswahl von zwischen 1.000 und 3.000 Personen deutscher Staatsangehörigkeit, mit der weitestgehend gewährleistet ist, daß sie die Grundgesamtheit der deutschen Bevölkerung (mit lediglich kleinen Verzerrungen) zuverlässig repräsentiert. Die Einzelheiten der Vorgehensweise bei der Datenerhebung sind, zweitens, ausführlich dokumentiert und können somit von Interessierten nachgeprüft werden. Die Daten werden, drittens, über das Zentralarchiv für empirische Sozialforschung in Köln (zum Teil nach einer kurzen Sperrfrist) öffentlich zugänglich gemacht und stehen für weitere Analysen zur Verfügung. Und nicht zuletzt weisen sie, viertens, den großen Vorzug auf, daß zu mehreren Zeitpunkten dieselben Einstellungsfragen erhoben wur-
[Seite der Druckausg.: 22 ]
den, wodurch erst zuverlässige Aussagen über langfristige Trends in der Entwicklung fremdenfeindlicher Tendenzen möglich werden.
Neben den genannten Untersuchungen gibt es eine Reihe weiterer Erhebungen, die von Meinungsforschungsinstituten wie EMNID, infas, infratest, GFM/GETAS oder dem Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von Ministerien, Parteien und anderen Institutionen veranstaltet werden. Diese eignen sich aber kaum für die Analyse langfristiger Trends, weil die Fragenformulierungen - vor allem unter dem Einfluß aktueller Diskussionen - immer wieder verändert wurden, so daß die Vergleichbarkeit der Ergebnisse für unterschiedliche Zeitpunkte stark eingeschränkt ist. Häufig werden zudem nur einzelne Befunde aus den Befragungen berichtet, während wichtige technische Einzelheiten der Erhebung - auch auf Nachfrage - nicht angegeben werden und deshalb nicht überprüft werden können (Jäger 1995: Kap. 4). Die erstellten Datensätze sind teilweise überhaupt nicht oder nur unter großem Aufwand zugänglich und bleiben somit von weiteren Analysen und Überprüfungen in der Regel ausgeschlossen.
Des weiteren liegen unzählige Spezialerhebungen vor, die sich entweder auf einzelne Gemeinden, Städte und Regionen oder auf bestimmte Bevölkerungsgruppen beschränken. Diese Untersuchungen werden meistens nur sporadisch durchgeführt und beruhen vielfach auf relativ kurzfristigen Forschungsprojekten und kommunalpolitischen Initiativen. Eine Ausnahme davon stellen allerdings die zahlreichen Befragungen von Jugendlichen und Ostdeutschen, vor allem aber von ostdeutschen Jugendlichen dar, die bereits seit mehreren Jahren mit großer Regelmäßigkeit veranstaltet werden, was wohl maßgeblich auf die häufig festgestellte starke Zunahme fremdenfeindlicher Tendenzen unter diesen Bevölkerungsgruppen zurückgeführt werden kann (vgl. z.B. Bundesministerium für Familie 1995; Deutsches Jugendinstitut 1995; Förster 1992; Friedrich-Ebert-Stiftung (Büro Leipzig) 1993). Im allgemeinen eignen sich solche Spezialerhebungen hauptsächlich zur genaueren Überprüfung spezifischer Erklärungsansätzen, zur Fundierung kommunalpolitischer Programme oder zur Analyse der Hintergründe der Einstellungs- und Verhaltenstrends bei besonderen „Problemgruppen". Sie sind aber allenfalls mit großen Einschränkungen dazu geeignet, Entwicklungstendenzen der Fremdenfeindlichkeit für die Gesamtheit der deutschen Bevölkerung festzustellen.
Ähnliches gilt überdies für die ebenfalls zahlreichen experimentellen Untersuchungen, die vorzugsweise von Psychologen und Sozialpsychologen vorgenommen werden. Auch sie bedienen sich häufig bei der Analyse von Stereotypen und Vorurteilen mehr oder weniger standardisierter Befragungstechniken. Im Unterschied zu den bereits genannten Erhebungen versuchen sie aber durch eine Kontrolle der Rahmenbedingungen mögliche Störfaktoren der Befragung zu verringern oder durch gezielte Manipulationen den Einfluß bestimmter Informationen oder Ereignisse auf das Antwortverhalten zu überprüfen. Der Preis für die durch die Laborsituation ermöglichten Erkenntnisse über Einzelheiten und Hintergründe des Antwortverhaltens, die in „normalen" Befragungen ausgeblendet bleiben, ist die mitunter drastisch eingeschränkte Aussagekraft der Ergebnisse. Abgesehen davon, daß die Auswahl der Befragten nie repräsentativ und häufig sehr einseitig - vorzugsweise auf Studierende - ausgerichtet ist, erzeugt schon die Laborsituation selbst in der Regel unerwünschte Störeffekte, die die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse auf gewöhnliche Alltagssituationen in Frage stellen (vgl. Schnell/Hill/Esser 1992: Kap. 5). Deshalb eignen sich solche Untersuchungen am ehesten für die Analyse klar eingegrenzter Zusammenhänge und Abläufe, nicht aber für die Analyse von allgemeinen Tendenzen der Fremdenfeindlichkeit und deren Ursachen.
[Seite der Druckausg.: 23 ]
Während Befragungen zwangsläufig immer auf die Antwortbereitschaft der befragten Personen angewiesen sind, die wissen, daß sie Untersuchungsobjekt sind, zielen Inhalts- oder Bedeutungsanalysen gewissermaßen auf indirekt zu erschließende, „geronnene" Äußerungen. Vor allem Zeitungen, Bücher, Fernsehsendungen, Filme oder schriftlich dokumentierte Ansprachen von Politikern bilden das Material von Inhaltsanalysen, die auch ohne Wissen und Zutun der Produzenten und Konsumenten vorgenommen werden können. Im Hinblick auf die Untersuchung fremdenfeindlicher Tendenzen wird dieses Material dazu genutzt, um aus der Analyse des Inhalts und der Form von Äußerungen über „Fremde" oder „Ausländer" auf entsprechende Merkmale der Produzenten und der Konsumenten zu schließen (vgl. Jäger 1995: 63-82). Teilweise beschränken sich solche Analysen auf eine mehr oder weniger theoriegeleitete, hauptsächlich auf Plausibilitätsüberlegungen gestützte Darstellung und Interpretation von Argumentations- und Bedeutungszusammenhängen. Typische Beispiele dafür sind jene zahlreichen Beiträge, in denen bereits die Analyse ausgewählter Texte und Äußerungen (vermeintlich) einflußreicher Personen als „Belege" für die Deutung fremdenfeindlicher Tendenzen ausgegeben werden.
Inhaltsanalysen im engeren Sinn, wie sie etwa in der Medienforschung üblich sind, beruhen indessen auf vergleichsweise ausgefeilten Techniken der Datenanalyse. Mit Hilfe dieser - vermehrt computergestützten - Techniken werden zum Beispiel auf der Grundlage eines zuvor entwickelten Kategorienschemas die Häufigkeit des Vorkommens bestimmter Textelemente, die damit verbundenen Bewertungen und typische Zusammenhänge zwischen verschiedenen sprachlichen Elementen bzw. Begriffen aus Zeitungsartikeln oder Fernsehsendungen herausgearbeitet. Auf der Basis solcher, meistens sehr aufwendiger Untersuchungen wird dann unter anderem versucht, festzustellen, wie „Fremde" dargestellt und beurteilt werden und inwiefern dabei typische Stereotype, Vorurteile und Verhaltensvorgaben reproduziert oder auch erst produziert werden.
Insbesondere im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Medienberichterstattung und Fremdenfeindlichkeit sind Verfahren der Inhaltsanalyse in jüngster Zeit verstärkt auf Interesse gestoßen. Anlaß dafür war wohl nicht zuletzt der vor allem nach den fremdenfeindlichen Attacken in Hoyerswerda häufig geäußerte Vorwurf, die Berichterstattung über „Ausländerprobleme" und die mediale Aufbereitung der Krawalle hätten die nachfolgende Eskalation der Gewalttaten mit verursacht. Eine Reihe neuer Zeitschriftenbeiträge und Sammelbände zum Thema sind ein deutlicher Indikator für die erhöhte Bedeutung, die diesem Zusammenhang zugemessen wird (vgl. Funk/Weiß 1995; Jung/Wengeler/Böke 1997; Ohlemacher 1994; Ruhrmann 1997; Zentrum für Türkeistudien 1995). Dabei werden nicht nur ganz unterschiedliche Ausgangsmaterialien und Analysetechniken verwendet; auch die Grundannahmen darüber, welchen Einfluß die Medien überhaupt auf die Konsumentinnen und Konsumenten ausüben, unterscheiden sich sehr deutlich.
Weitestgehend unstrittig ist allerdings, daß Zeitungen, Fernsehsendungen, Filme und nicht zuletzt auch Kinder- und Schulbücher immer wieder Stereotype und Vorurteile gegenüber „Fremden" beinhalten, die aus alltäglichen Meinungs- und Einstellungsäußerungen ebenfalls bekannt sind. Mit Hilfe inhaltsanalytischer Verfahren können diese aufgedeckt und ausführlich untersucht werden, wobei die Ergebnisse weitaus eher von Interessierten nachvollzogen und systematisch überprüft werden können, als die Befunde derjenigen Beiträge, die sich ausschließlich auf die Interpretation „wichtiger" Texte, Dokumente und Aussagen beziehen. Dennoch sind auch sie letztlich nicht geeignet, einigermaßen zuverlässige Erkenntnisse über Ausrichtung, Ausmaß und Ursachen fremdenfeindlicher Tendenzen innerhalb der deutschen Bevölkerung zu eröffnen, zumal die
[Seite der Druckausg.: 24 ]
Auswahl der Untersuchungseinheiten (z.B. die Auswahl bestimmter Zeitungen) und der Analyseeinheiten (z.B. die Auswahl von Artikeln zu einem bestimmten Thema) oft recht willkürlich erscheint. Generell kann zwar davon ausgegangen werden, daß „die Eliten" und „die Medien" einerseits gesellschaftlich verbreitete Meinungs- und Einstellungsmuster gegenüber „Fremden" aufgreifen und reproduzieren, andererseits diese aber auch mit beeinflussen und verändern können. Ein einfaches Entsprechungsverhältnis etwa zwischen der Medienberichterstattung und Einstellungs- und Verhaltenstendenzen der Bevölkerung kann daraus allerdings nicht abgeleitet werden.
3.1.3. Verhaltensindikatoren
Alle bisher angeführten Verfahren und Datenquellen erlauben, streng genommen, nur Aussagen über Stereotype, Vorurteile und allgemeine Diskriminierungsbereitschaften. Über das tatsächliche Verhalten von Deutschen gegenüber „Fremden" lassen sich daraus noch keine zuverlässigen Schlüsse ziehen. Die bereits erwähnte Tatsache des keineswegs zwangsläufigen Zusammenhangs zwischen Einstellungen und Verhalten ist dafür der maßgebliche Grund. Wäre eine stark fremdenfeindliche Einstellung die einzige Bedingung oder Ursache diskriminierenden Verhaltens, würde es ausreichen, jene Einstellungen bzw. Vorurteile in Befragungen festzustellen. Aber davon kann offensichtlich nicht ausgegangen werden. Deshalb ist es nötig, Indikatoren und Verfahren zu entwickeln, mit denen das tatsächliche Verhalten und Handeln erfaßt werden kann, um dann zum Beispiel die Stärke des Einflusses von Stereotypen und Vorurteilen und anderen Bedingungsfaktoren untersuchen zu können.
Eine naheliegende Möglichkeit der Erfassung des tatsächlichen Verhaltens besteht in der direkten oder indirekten Beobachtung. Der größte Teil der verfügbaren Informationen über Ausmaß und Entwicklung fremdenfeindlicher Handlungen geht im Prinzip auf indirekte Beobachtungen zurück, nämlich auf polizeiliche Ermittlungen nach fremdenfeindlichen Gewalt- und Straftaten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden von den Landeskriminalämtern, vom Bundeskriminalamt (BKA) und vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) gesammelt und veröffentlicht. Abgesehen von den gelegentlichen Pressemitteilungen dieser Behörden ist die wohl wichtigste Datenquelle auf dieser Grundlage der jährliche Verfassungsschutzbericht, der vom Bundesministerium des Inneren herausgegeben wird. Darin werden die jeweils im Vorjahr ermittelten Gewalttaten (Tötungsdelikte, Tötungsversuche, Sprengstoff- und Brandanschläge, Körperverletzungen usw.) und andere Straftaten mit fremdenfeindlichem Hintergrund (Nötigungen, Bedrohungen usw.) zusammengefaßt. Genauere Angaben sind von diesen Behörden jedoch gar nicht oder nur unter großem Aufwand zu erhalten (Ohlemacher 1994). Aus Anlaß einer regelmäßigen Kleinen Anfrage der Bundestagsabgeordneten Jelpke (PDS) werden jedoch seit einiger Zeit regelmäßig detaillierte Auskünfte erteilt, die als Bundestags-Drucksache veröffentlicht werden.
Auf indirekten Beobachtungen beruhen des weiteren auch die gelegentlich von den Medien und Menschenrechtsorganisationen veröffentlichten Berichte über fremdenfeindliche Diskriminierungen und Gewalttaten. Vor allem Human Rights Watch (z.B. Fullerton 1995) und amnesty international berichten immer wieder darüber und befassen sich teilweise besonders mit Diskriminierungen und Mißhandlungen seitens staatlicher Behörden gegenüber Ausländern. Alle genannten Datenquellen konzentrieren sich indes auf extreme Formen der Fremdenfeindlichkeit. Weniger offensichtliche Formen der Diskriminierung und Abgrenzung wie Kontaktvermeidung, subtile Bedrohungen und Benachteiligungen werden darin nicht erfaßt. Um solche Verhaltensweisen aufzu-
[Seite der Druckausg.: 25 ]
decken, wäre es naheliegend, auf Techniken der direkten Beobachtung zurückzugreifen und - offen oder verdeckt - Handlungen und Verhaltensmuster zwischen „Einheimischen" und „Fremden" zu analysieren. Solche Verfahren weisen jedoch eine Reihe von Schwierigkeiten auf, die vermutlich dazu geführt haben, daß direkten Beobachtungen - zumindest im engeren Bereich der empirischen Sozialforschung - selten sind (vgl. dazu z.B. Diekmann 1995: Kap. 11 und 13; Schnell/Hill/ Esser 1992: Kap. 7).
Eine interessante Alternative - oder besser: Ergänzung - zu diesen Informationsquellen stellen Strukturdaten über die Lebenslage und sozialstrukturelle Positionierung von „Ausländern" in Deutschland sowie über die Entwicklung interethnischer Heiraten und Nachbarschaftsbeziehungen dar. Entsprechende Daten und Statistiken, die teils fortlaufend, teils in größeren Zeitabständen erhoben werden, finden sich in mehreren veröffentlichten Untersuchungen (vgl. dazu auch Jäger 1995). Nennenswert sind vor allem:
• das Sozioökonomische Panel (SOEP), das seit 1984 vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) organisiert wird und die derzeit größte Wiederholungsbefragung von Ausländern beinhaltet (vgl. Seifert 1995);
• die Repräsentativuntersuchungen zur Situation der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland, die 1980, 1985 und 1995 im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung vom Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführt wurden (vgl. Mehrländer/ Ascheberg/Ueltzhöffer 1996);
• die sogenannten „Ausländerstudien" von MARPLAN, in deren Rahmen seit 1970 regelmäßig Mehrthemenumfragen unter Griechen, Italienern, Türken, Spaniern und Zuwanderern aus dem ehemaligen Jugoslawen durchgeführt werden (vgl. Mohr 1989).
Diese Datensammlungen enthalten unter anderem Angaben zur ökonomischen Lage, zur Wohnsituation, zur aktuellen Berufstätigkeit, zur schulischen und beruflichen Ausbildung sowie zur Nationalität des Ehepartners von Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Daraus können indirekte Hinweise über Diskriminierungen und Diskriminierungsfolgen gewonnen werden, indem zum Beispiel berufliche Positionen oder Wohnverhältnisse von Deutschen und Ausländern mit möglichst ähnlichen Fähigkeiten und finanziellen Ressourcen verglichen werden. In der Forschungspraxis ergeben sich dabei allerdings sehr schnell Interpretations- und Erklärungsprobleme, weil die Vergleichbarkeit der jeweiligen Fälle und die Kontrolle möglicherweise relevanter Hintergrundfaktoren allenfalls mit großen Anstrengungen sichergestellt werden kann. Die aufwendigen empirischen Analysen zur Diskriminierung am Arbeitsmarkt und die Diskussion um die Verfahren des „Auditing for Discrimination" in den USA (vgl. Fix/Struyk 1993) zeigen das deutlich. Als kaum weniger schwierig erweist sich bei eingehender Analyse die Interpretation und Erklärung von Veränderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung bestimmter Stadtgebiete. Die Vermutung liegt zwar nahe, daß die Segregation und Konzentration ethnischer Minderheiten in bestimmten Stadtvierteln einerseits eine Reaktion der Minderheitsangehörigen auf negative Erfahrungen und andererseits ein Ergebnis der Kontaktvermeidung seitens der „Einheimischen" darstellen. Doch ein überzeugender Nachweis der vermuteten Zusammenhänge ist komplizierter, als häufig angenommen wird.
Diese Schwierigkeiten stellen den Wert von Strukturdaten als Indikatoren für fremdenfeindliche Diskriminierungen und deren Folgen keineswegs grundsätzlich in Frage. Solche Daten geben wichtige Hinweise auf zentrale strukturelle Probleme, bei deren Entstehung fremdenfeindliche Tendenzen seitens der deutschen Bevölkerung sicherlich eine Rolle gespielt haben. Gleichwohl entziehen sie sich einer einfachen, unmittelbaren In-
[Seite der Druckausg.: 26 ]
terpretation. Es reicht eben nicht aus, allgemeine „objektive" Unterschiede der sozialstrukturellen Positionierung von Deutschen und „Ausländern" zu betrachten, um stichhaltige Aussagen über diskriminierendes Verhalten der Einheimischen treffen zu können. Dazu bedarf es der genaueren Klärung der relevanten Hintergrundfaktoren und Wirkungsmechanismen, die zu diesen feststellbaren Unterschieden geführt haben. Strukturdaten sind insofern hauptsächlich als indirekte Indikatoren zu verstehen.
Eine Ausnahme davon bilden am ehesten die in den Datenquellen wiedergegebenen Informationen über Heiraten zwischen Deutschen und Ausländern, die zu Recht als ein wichtiger Indikator für Abgrenzungstendenzen zwischen den jeweiligen Gruppen gelten. In etwas eingeschränkter Weise gilt dies auch für Informationen über die Anzahl und Häufigkeit der Kontakte und Freundschaften zwischen Deutschen und Ausländern sowie für Auskünfte von Ausländern über ihre Erfahrungen im alltäglichen Umgang mit den „Einheimischen". Solche Informationsquellen beruhen im Kern auf in Befragungen berichtetem Verhalten, das mehr oder weniger stark von aktuellen Wahrnehmungen und Erfahrungen geprägt ist und deshalb gewisse Verzerrungen aufweisen kann. Dennoch sind auch daraus aufschlußreiche Hinweise über die Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschen und Ausländern und deren Belastung durch fremdenfeindliche Tendenzen zu gewinnen, wobei in der sozialwissenschaftlichen Forschung gerade die Erfahrungsberichte von Ausländern nur selten zur Kenntnis genommen werden.
3.2. Wie zuverlässig sind die verfügbaren Daten?
Die Übersicht sollte deutlich gemacht haben, daß die sozialwissenschaftliche Forschung über eine ganze Reihe von Indikatoren, Verfahren und darauf gestützte Datenquellen verfügt, auf deren Grundlage überprüfbare und quantifizierbare Aussagen über Ausmaß und Entwicklung fremdenfeindlicher Tendenzen getroffen werden können. Diese Informationsquellen werden allerdings nicht nur in der öffentlichen Diskussion, sondern selbst in der sozialwissenschaftlichen Forschung erstaunlich selten ausgeschöpft. Häufig wird offenbar schon die subjektive, im Rahmen eines mehr oder weniger klaren Deutungsmusters verortete Wahrnehmung und Erfahrung als hinreichende Basis der Trend- und Ursachenanalyse aufgefaßt. Ergebnisse aus den gelegentlichen, hauptsächlich von Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehsendern in Auftrag gegebenen Umfragen dienen vorzugsweise zur Verdeutlichung oder Untermauerung der Argumentation. Für die Aussagekraft der Analysen und die Tragfähigkeit der eventuell daran anknüpfenden Handlungsprogramme erweist sich dies als klarer Nachteil.
Auf Plausibilitätsargumente oder allgemeine theoretische Entwürfe gestützte Analysen laufen allzu leicht Gefahr, vermeintliche Gewißheiten über Ursachen und Wirkungszusammenhänge zu wiederholen, die im Grunde nur deshalb als gewiß erscheinen, weil sie einstweilen jeglichen Überprüfungsversuchen entgangen sind. Die immer wieder wiederholte - und inzwischen weitgehend widerlegte - Behauptung eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen dem Ausmaß der Fremdenfeindlichkeit und dem Anteil von Ausländern im Wohnumfeld ist dafür nur ein Beispiel. Die Überprüfung vermeintlich „plausibler" oder „offensichtlicher" Annahmen und Hypothesen mit Hilfe empirischer Daten ist in diesem Zusammenhang eine wichtige Korrekturmöglichkeit.
Allerdings eignen sich dafür gerade die viel zitierten Umfragedaten aus Zeitungen und Nachrichtenmagazinen nur bedingt. Sie beruhen in der Regel auf Befragungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Ereignissen durchgeführt werden. Aus der Perspektive der Auftraggeber ist dies sicherlich naheliegend. Erfaßt werden dadurch aber oft nur spontane Meinungsäußerungen, die - in Abhängigkeit von
[Seite der Druckausg.: 27 ]
den jeweils aktuellen Diskussionen und Ereignissen - starke Schwankungen aufweisen. Wie noch ausführlicher gezeigt werden wird, stehen die entsprechenden Befunde teilweise in deutlichem Kontrast zu Erkenntnissen, die aus längeren Zeitreihen, etwa dem bereits erwähnten ALLBUS, zu ziehen sind (vgl. Abschnitt 4).
Anlaß zur Skepsis gegenüber den in solchen Meinungsumfragen erhobenen Daten geben außerdem methodische Unklarheiten. Insbesondere bei den in den Medien veröffentlichten Befragungen ist meistens nicht erkennbar, wie die Fragen und Skalen formuliert wurden und welche Tests sie vor ihrem Einsatz durchlaufen haben. In der empirischen Sozialforschung ist indes bekannt, daß von der Gestaltung und Überprüfung der Fragebögen die Aussagekraft der Ergebnisse stark abhängig ist. Deshalb werden zum Beispiel im Rahmen des ALLBUS und anderer sozialwissenschaftlicher Erhebungen sorgfältige Voruntersuchungen durchgeführt, in denen kontrolliert wird, ob die Frageformulierungen und Einstellungsskalen zuverlässige Indikatoren der interessierenden Phänomene sind. Außerdem wird großer Wert darauf gelegt, mehrere Indikatoren zu verwenden, weil aus mehreren Äußerungen ableitbare Meinungs- und Einstellungsmuster in aller Regel aussagekräftiger sind als einzelne Äußerungen, die unter Umständen durch eher zufällige Faktoren beeinflußt sein können. Inwieweit solche im Detail ziemlich knifflige methodische Probleme bei den in Zeitungen und Nachrichtenmagazinen zitierten - oft kurzfristig in Auftrag gegebenen - Untersuchungen berücksichtigt worden sind, bleibt zumeist unklar. Insofern gibt es aus sozialwissenschaftlicher Perspektive gute Gründe, die entsprechenden Daten mit einigen Vorbehalten zu interpretieren.
Selbst bei Befragungen, die, wie zum Beispiel der ALLBUS oder das Eurobarometer, auf eingehenden Vorstudien und Überprüfungen beruhen, ist allerdings mit einer weiteren grundlegenden Schwierigkeit zu rechnen, die in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Daten von Bedeutung ist. Jede Befragung ist letztlich darauf angewiesen, daß die befragten Personen möglichst wahrheitsgemäß über ihre Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen informieren. Gerade im Hinblick auf eher heikle Fragen nach Einstellungs- und Verhaltensmustern gegenüber Ausländern kann es jedoch Bestrebungen geben, die Angaben bewußt zu verzerren. Möglicherweise vertuschen manche Befragte in der Interviewsituation starke Vorbehalte und Diskriminierungsbereitschaften gegenüber Ausländern, um keine negativen Reaktionen seitens des Interviewers hervorzurufen. In manchen Fällen kann es zur expliziten Verweigerung einer Antwort oder zur Abgabe einer „Weiß-nicht-Antwort" kommen, obwohl sich die Befragten durchaus über ihre Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen im Klaren sind, während in anderen Fällen vielleicht Antworten gegeben werden, ohne daß sich die Befragten darüber Gedanken gemacht haben (vgl. Schnell/Hill/Esser 1992: Kap. 7).
Solche sogenannten response errors („Antwortverzerrungen") sind in Bezug auf fremdenfeindliche Tendenzen und rassistische Einstellungen in einer Reihe von experimentellen Untersuchungen aufgedeckt worden. So wurde zum Beispiel gezeigt, daß die geäußerten Meinungen und Einstellungen gegenüber Ausländern deutlich negativer ausfallen, wenn sich die Befragten mit einem vorgeblichen Lügendetektor konfrontiert sehen, als wenn sie sich in einer gewöhnlichen Befragungssituation befinden (Sigall/Page 1971; Mummendey/Bolten/Isermann-Gerke 1982). Andere Studien auf der Grundlage möglichst subtiler und unauffälliger Meßverfahren weisen in eine ähnliche Richtung (z.B. Dovidio/Fazio 1992; vgl. auch Ganter 1997b). Solche Untersuchungen sind bislang fast ausschließlich in Laborexperimenten durchgeführt worden; inwieweit die dort angewandten Verfahren zum Zweck der Verringerung von Antwortverzerrungen auch außerhalb des Labors Verwendung finden können, ist noch weitgehend ungeklärt. Ihre Ergebnisse werfen aber zumindest den begründeten Verdacht auf, daß auf
[Seite der Druckausg.: 28 ]
der Basis von Umfragedaten das tatsächliche Ausmaß fremdenfeindlicher Tendenzen wohl beträchtlich unterschätzt wird.
Diese Erkenntnisse über die mit Befragungen verbundenen Schwierigkeiten müssen bei der Interpretation entsprechender Daten im Auge behalten werden. Das ist aber kein triftiger Grund dafür, Befragungen grundsätzlich nicht ernst zu nehmen. Sie sind immer noch eine der wichtigsten Informationsquellen für die Einschätzung des Ausmaßes und der Entwicklungstendenzen fremdenfeindlicher Meinungs- und Einstellungsmuster, weil sie mit vergleichsweise einfachen und prinzipiell beliebig oft wiederholbaren Verfahren quantitativ faßbare Daten über größere Bevölkerungsgruppen bereit stellen, die gerade auch für die Ursachenforschung unverzichtbar sind. Deren Qualität wird allerdings immer maßgeblich davon abhängen, wie sorgfältig die Meßinstrumente, vor allem die einzelnen Fragen und Skalen, entwickelt und geprüft worden sind; die stärkere Berücksichtigung der bereits vorliegenden Vorschläge zur Verringerung der erwähnten Antwortverzerrungen könnte ebenfalls zu einer Verbesserung der Datenqualität beitragen.
In Bezug auf die verfügbaren Daten über diskriminierendes Handeln wurde bereits auf einige Schwierigkeiten bei der Erhebung und Interpretation von direkten und indirekten Verhaltensindikatoren hingewiesen, die deren Zuverlässigkeit beeinflussen können. Die Angaben der Kriminalämter und des Bundesamtes für Verfassungsschutz über fremdenfeindliche Gewalttaten gelten dabei häufig als besonders zuverlässig und aussagekräftig. Doch auch sie weisen beachtliche Nachteile auf. Abgesehen davon, daß sie lediglich über extreme Formen der Fremdenfeindlichkeit informieren und folglich wenig über deren eher subtilen Ausprägungen aussagen, vermitteln sie kein eindeutiges Bild der fremdenfeindlichen Gewalt. Erfaßt sind darin nur polizeilich gemeldete Fälle. Zahlreiche fremdenfeindliche Gewalttaten, Drohungen und Nötigungen werden aber vermutlich gar nicht gemeldet, weil die Betroffenen Vergeltungsmaßnahmen seitens der Täter befürchten, unangenehme Erfahrungen mit staatlichen Behörden gemacht haben oder von polizeilichen Ermittlungen von vornherein keine Konsequenzen erwarten. Über die Dunkelziffer fremdenfeindlicher Gewalt- und Straftaten kann nur spekuliert werden, aber es ist zumindest davon auszugehen, daß sie deutlich über den offiziell berichteten Zahlen liegt (vgl. auch Willems et al. 1993: Kap.5).
Insgesamt läßt sich feststellen, daß es zahlreiche Gründe dafür gibt, die verfügbaren Informationen über das Ausmaß und die Entwicklung fremdenfeindlicher Tendenzen nicht einfach zum Nennwert zu nehmen. Alle Daten sind anfällig für unerwünschte Verzerrungen, die deren Aussagekraft mindern. Dennoch weisen sie gegenüber dem bloßen Augenschein und Vor-Urteil klare Vorzüge auf. Empirisch fundierte Erkenntnisse über die Entstehungsbedingungen und Ursachen von Fremdenfeindlichkeit sind ohne sie schlechterdings nicht möglich.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Oktober 1999