

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
1. Das makroökonomische Problem
Die jüngste wirtschaftliche Schreckensnachricht (im März 1999) war die Bekanntgabe der Wachstumsrate im vierten Quartal 1998 (gegenüber dem 3. Quartal): minus 0,8 Prozent. Auf Jahresbasis hochgerechnet wären dies -3,5 Prozent. Der positiv bewertete Trend rückläufiger Wachstumsrückgänge im ersten bis dritten Quartal 1998 hatte sich damit wieder umgekehrt. Auf das Jahr 1998 bezogen liegt das Wachstum bei -2,8 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die staatlichen Ausgaben (vor dem Hintergrund einer Konjunkturspritze von 16 Billionen Yen) 1998 um etwa 10 Prozent gestiegen sind. 1999 soll die staatliche Konjunkturspritze 24 Billionen Yen betragen (ca. 200 Mrd. Dollar - hinzuzurechnen wären die staatlichen Hilfen für die Banken), und die optimistischen Beobachter gehen davon aus, daß diese neue Konjunkturspritze - aber nur so lange sie wirkt - eine positive Wachstumsrate hervorbringen wird.
Wachstumsraten (3. Quartal 97 - 4. Quartal 98)
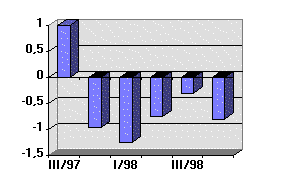
Die Ursache der Wachtumsverluste ist vor allem der Rückgang des privaten Konsums, weniger der privaten Investition, die selbst in der Krise noch 14 Prozent des Sozialprodukts ausmacht - gegenüber 9 Prozent in den USA auf dem Höhepunkt des Konjunkturzyklus. Im Februar 1999 ist der private Verbrauch gegenüber den Vorjahr um 3,4 Prozent gesunken, und der Anteil der Konsums an den Einkommen der privaten Haushalte ging von 70,9 auf 67,8 Prozent zurück - der niedrigste Anteil seit entsprechende Daten erhoben werden.
Im Zentrum der Japankrise steht der Sachverhalt, daß die Ersparnisse der japanischen Haushalte die als profitabel erachteten Investitionen übersteigen. Die Krise Japans ist die Krise einer wohlhabenden Gesellschaft mit einer vergleichsweise egalitären Einkommensverteilung: Der Economic Planning Agency zufolge sind 37 Prozent der durchschnittlichen Ausgaben der Haushalte „nicht essentiell" in dem Sinne, daß sie ohne schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensqualität verschoben werden können (1980 lag dieser Anteil bei 20 Prozent). Wenn sich mehrere Millionen Haushalte entscheiden, den Kauf eines neuen Autos um ein Jahr zu verschieben, bedeutet dies einen massiven Rückschlag für die Autoindustrie, ohne daß sich der Lebensstandard dieser Haushalte drastisch verschlechtert hätte.
Für die hohe und in der Krise steigende Sparrate der Haushalte gibt es mehrere Erklärungen. Erstens zwingen die hohen Kosten der als notwendig angesehenen „Investitionen" der Haushalte - die Ausbildung der Kinder und der Erwerb von Wohneigentum - generell zu im internationalen Vergleich hoher Ersparnisbildung. Diese wird dadurch erleichtert, daß ein hoher Anteil (bis zu 40 Prozent) der Löhne und Gehälter zweimal jährlich in der Form von Bonussen ausgezahlt wird, die in der Regel gespart werden. Nur ein geringer Teil der häuslichen Ersparnisse ist ertragbringend angelegt, so daß das in den USA zu beobachtende Phänomen, daß anstelle der Haushalte deren Wertpapierdepots "sparen", in Japan nicht anzutreffenh ist.
Zweitens wird ein im internationalen Vergleich hoher Anteil der sozialen Vorsorge privat getragen, sei es durch implizite Sozialleistungen der Unternehmen, die auch in Krisen keine Entlassungen vornehmen, sei es durch die Arbeitnehmer selbst, die gegen Arbeitslosigkeit, Einkommenslosigkeit im Alter und Krankheit angesichts schwacher öffentlicher Sicherungssysteme durch private Ersparnisbildung vorsorgen müssen.
Drittens - und dies ist der entscheidende Punkt - haben die Unternehmen ihren Anteil an der sozialen Vorsorge implizit aufgekündigt. Die sogenannte lebenslange Beschäftigung und die Lohnzahlung nach dem Senioritätsprinzip, auf deren Grundlage die Arbeitnehmerhaushalte traditionell ihre „Investitionen" und alltäglichen Ausgaben planten, können nicht mehr als gegeben vorausgesetzt werden. Sie waren weder gesetzlich noch durch Verträge, sondern nur durch Konventionen geschützt, und sie wurden weder formell, noch praktisch durch Massenentlassungen aufgehoben. Durch die intensive öffentliche Relativierung des japanischen Beschäftigungssystems, symbolische Konventionsbrüche und die Ankündigung größerer Restrukturierungen hat sich jedoch die Wahrnehmung der Beschäftigungssicherheit als Grundlage der Lebensplanung verflüchtigt. Dem japanischen Haushalten ist ein neues Lebensrisiko entstanden, gegen das sie nur privat vorsorgen können: die Arbeitslosigkeit der männlichen Haupterwerbstätigen.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Perspektive der Arbeitslosigkeit in Japan eine höhere Abschreckungswirkung enthält als in den westlichen Industrieländern. Nicht nur ist die staatliche Arbeitslosenversicherung schwach: Arbeitslosengeld wird für maximal 300 Tage gezahlt, und in diesen Genuß kommen nur Arbeitnehmer mit mindestens 15 Dienstjahren. Im Durchschnitt trägt die Arbeitslosenversicherung Leistungen für 60 Tage. Eine zweite Auffanglinie gibt es nicht: Sozialhilfe (public assistance) wird in der Regel nicht an Arbeitsfähige ausgezahlt. Darüber hinaus hat die betriebszentrierte Ausbildung zur Folge, daß ein Arbeitnehmer mit seinem Job auch seine Qualifikation verliert; er verfügt über kein Zertifikat, das eine bestimmte Qualifikation nachweist, die auch ein anderer Arbeitgeber akzeptieren würde; der Verlust des Jobs ist daher gleichbedeutend mit einem Abstieg in das Segment der Nicht-Qualifizierten. Drittens schließlich ist Arbeitslosigkeit eine Belastung, für die die japanischen Familien nicht gerüstet sind. Die äußerst rigide Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern - die familiäre Ergänzung der lebenslangen Beschäftigungsverhältnisse - hat zur Folge, daß die Dauerpräsenz des Familienvaters in der (ohnehin zu kleinen) Wohnung einer familiären Katastrophe gleichkommt.
Zum neuen Lebensrisiko der Arbeitslosigkeit kommt das als bedrohlich wahrgenommene Risiko der Einkommenslosigkeit im Alter. Die Firmen als generöse Arbeitgeber, die ihren ehemaligen Mitarbeitern auch im Alter ein Zusatzeinkommen verschaffen, entfallen in der Tendenz. Ebenso verschwinden die mit dem System der lebenslangen Beschäftigung verbundenen hohen Abfindungszahlungen, die oft in Form einer Zusatzrente ausgezahlt werden. Die betriebliche Alterssicherung gilt angesichts der Krise der großen Lebensversicherungen als wenig sicher. Und auch die Leistungen des staatlichen Rentensystem werden als nicht ausreichend wahrgenommen, um den Lebensstandard älterer Arbeitnehmer zu sichern. Diese Unsicherheit wird genährt von einer öffentlichen Diskussion, die die demographische Alterung des Gesellschaft zu einer nationalen Zukunftskatastrophe macht. Die stereotype öffentliche Betonung der Belastung der Gesellschaft durch ihre älteren Mitbürger unterminiert ganz offensichtlich die Sicherheit, diese Gesellschaft werde den mit der Rentenversicherung geschlossenen Generationenvertrag auch einlösen - was wiederum die private Ersparnis als einzige Vorsorge gegen Altersarmut übrig läßt. (In gewisser Hinsicht folgt die heutige japanische Gesellschaft trotz ihrer gerontokratischen Züge in Politik und Management weniger den konfuzianischen Werten der Verehrung des Alters als dem shintoistischen Brauch des obasuyama - der Aussetzung "nutzloser" älterer Menschen in der Wildnis).
Das individuell rationale Verhalten der Haushalte - die Steigerung der Ersparnis in der Krise zur Absicherung gegen künftige soziale Risiken - führt die Gesamtwirtschaft in eine Depression. Die konventionellen Auswege sind versperrt, weil Japan in eine „Liquiditätsfalle" geraten ist. Unter normalen Umständen ließe sich Überersparnis durch die Expansion der Geldmenge korrigieren; Folge wäre ein sinkender Zinssatz, der wiederum zu höheren Investitionen und Ausgaben führen würde. In Japan liegt der Zinssatz aber bereits bei Null und kann nicht weiter gesenkt werden. Wenn die Haushalte auch bei einem Zinssatz von Null ihre Ersparnis steigern, hat die konventionelle Geldpolitik als Instrument der wirtschaftlichen Belebung ausgedient.
In dieser Situation gibt es zwei mögliche Auswege. Der erste wurde am ausführlichsten von Adam Posen vom Institute for International Economics dargelegt: Da die Geldpolitik in der Liquiditätsfalle nicht greift, lastet die Aufgabe der wirtschaftlichen Wiederbelebung ausschließlich auf der Fiskalpolitik. Die Regierung muß künstlich zusätzliche Nachfrage schaffen, die für die Haushalte zusätzliches verfügbares Einkommen wäre; höhere Einkommen wiederum würden die Konsumnachfrage steigern. Das stärkste Gegenargument gegen diese Strategie ist, daß die japanischen Regierungen in den letzten Jahren ebendies taten und die Wirtschaft mit immer größeren Konjunkturpaketen zu stimulieren versuchten. Hierauf läßt sich jedoch mit Posen entgegnen, daß die astronomischen Summen der Konjunkturpakete irreführen. Nur ein Teil dieser Pakete schuf genuin neue Nachfrage. Insgesamt haben die japanischen Regierungen zwischen 1992 und dem Frühjahr 1998 Konjunkturpakete im Umfang von 23 Billionen Yen oder 4,5 Prozent des BSP eines Jahres verabschiedet. Der Wachstumsverlust - d.h. die Differenz zwischen der potentiellen und der wirklichen Wachstumsrate - betrug im selben Zeitraum 9 Prozent des BSP. Die Konjunkturpakete waren m.a.W. nicht ausreichend. Eine Ausnahme war das Jahr 1995, als eine vergleichsweise "starke" Konjunkturspritze für das Folgejahr wirklich eine Wachstumsrate von 3,6 Prozent möglich machte. Dieser Erfolg wurde allerdings durch die austeritäre Haushaltspolitik der Regierung Hashimoto im Folgejahr wieder zunichte gemacht.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Fiskalpolitik in Japan höhere Summen einsetzen muß als in anderen Ländern, weil die "automatischen Stabilisatoren" der staatlichen Sozialleistungen schwächer wirken. In den westlichen Industrieländern führt ein Rückgang von Wachstum und Beschäftigung automatisch zu einer kompensierenden Steigerung der Sozialausgaben. Da der größte Teil der Kosten des Wachstumsrückgangs, insbesondere der Kosten der Arbeitslosigkeit, in Japan privat getragen wird (s.o.), entfällt dieser Korrekturmechanismus, so daß die gesamte Last des Ausgleichs auf die Staatsausgaben entfällt.
Der zweite Ausweg wurde von Paul Krugman dargelegt. Krugman zufolge bedeutet Überersparnis, daß der Preis heute zu erwerbender im Vergleich zum Preis künftig zu erwerbender Güter bzw. die Menge künftig zu konsumierender Güter, die man aufgeben muß, um heute eine Gütereinheit zu konsumieren, als zu hoch angesehen wird. Die Spanne zwischen aktuellen und künftigen (erwarteten) Preisen (eine Spanne, die sich auch im Zinssatz ausdrückt) ist zu gering, um eine Konsumentscheidung (oder eine Investition) zu motivieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Spanne auszuweiten. Eine wäre die Inflation (die Steigerung der erwarteten künftigen Preise); die zweite wäre die Deflation: Das Sinken der gegenwärtigen Preise. Krugman zufolge "will" die japanische Wirtschaft Inflation, produziert aber gerade deshalb Deflation. Die große Gefahr liegt darin, daß sich Deflationserwartungen festsetzen und in eine nach unten offene Spirale sinkender Preise, Gewinne und Löhne münden. Der Ausweg aus diesem Dilemma liegt Krugman zufolge darin, daß man der Wirtschaft verschafft, was sie "will": Inflation. Die Zentralbank müßte Geld drucken. Sie müßte glaubhaft machen, daß das künftige Preisniveau im Vergleich zum gegenwärtigen dauerhaft hoch genug sein wird, um Kauf- und Investitionsentscheidungen zu motivieren. Entweder gibt man der Volkswirtschaft die Inflationserwartungen, die sie "braucht", oder sie schafft diese Erwartungen selbst - durch Deflation.
Die Regierung Obuchi verfolgt den ersten Weg einer expansiven Fiskalpolitik. Sie wird die Konjunktur 1999 mit einem Ausgabenprogramm von 24 Billionen Yen ankurbeln. Dies sind 50 Prozent mehr als im einzig erfolgreichen Konjunkturprogramm von 1995. Hinzuzurechnen wären die 7,5 Billionen Yen, die den Banken zur Verfügung gestellt werden. Allerdings ist auch dieses Mal nicht zu erkennen, wie hoch der Anteil genuin neuer Nachfrage an diesem Programm sein wird. Durch den Einsatz dieser gewaltigen Mittel wird es gelingen, die Wachstumsrate 1999 bzw. im Fiskaljahr 1999/2000 positiv zu halten. Es ist aber möglich, daß die Wirkung dieses Programms in dem Augenblick verpufft, in dem es ausläuft. In diesem Fall wäre die Fiskalpolitik nicht die Initialzündung, die die autonomen Nachfragefaktoren privater Verbrauch und private Investition in Bewegung setzt, sondern hätte einen Einmaleffekt; weitere Ausgabenprogramme in den Folgejahren würden notwendig werden.
Zur Verfolgung zweiten Weges - der Inflationierung der Wirtschaft - wird die Regierung, auch wenn sie ihn nicht gehen will, gezwungen werden. Das staatliche Defizit wird sich 1999 und 2000 nicht mehr durch die Emission von Staatsanleihen finanzieren lassen, da der freie Markt Emissionen im absehbaren Volumen nicht mehr aufnehmen wird, ohne daß der Zinssatz in die Höhe stiege. Diese Situation ist bereits 1998/99 eingetreten: Als das Trust Funds Bureau des Finanzministeriums (das u.a. die Mittel der staatlichen Postsparkasse verwaltet und traditionell ein wichtiger Käufer von Staatsanleihen ist) ankündigte, es werde keine Anleihen mehr erwerben, stieg der langfristige Zinssatz (und in der Folge der Wechselkurs) steil in die Höhe. Das Trust Funds Bureau hat seine Ankündigung befristet wieder zurückgenommen - bis zum 31. März 1999. Seit dem Frühjahr 1999 lautete damit wieder die Frage, ob der freie Markt Staatsanleihen im notwendigen Umfang ohne Zinssteigerungen absorbieren kann. Wenn dies nicht der Fall ist, wird es gar keine andere Möglichkeit geben, als daß die Zentralbank als Käufer auftritt und die staatlichen Schulden monetarisiert. Dies wäre gleichbedeutend mit dem Drucken von Geld. Man wird dann im Laufe des Jahres 1999 ein in seiner Dimension unbekanntes wirtschaftspolitisches Experiment mit ungewissem Ausgang verfolgen können: Es wäre das erste Mal, daß ein hochentwickeltes Industrieland seine Nachfrageprobleme mit Hilfe der Notenpresse zu bewältigen sucht.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | September 2000