

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
4. Konsequenzen für den Friedensprozeß
Daß beides – innerer und äußerer Frieden - eng zusammenhängt, ist eine viel zitierte Binsenweisheit, die durch Umfrageergebnisse bestätigt wird. Danach unterstützen 55,6 Prozent der säkularen Israelis die Oslo-Verträge, während 59,1 Prozent der Religiösen sie ablehnen. Und auch die Auswirkungen der sozialen Spaltung werden deutlich, wenn 47,6 Prozent der Säkularen, aber 60 Prozent der Religiösen der Meinung sind, daß der Friedensprozeß die Kluft zwischen arm und reich vertieft hat – eine Ansicht, die von den Fakten durchaus bestätigt wird. Wenn es also nicht gelingt, die immer offener zu Tage tretende Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, wird es für jede Regierung schwer sein, den Friedensprozeß zu einem erfolgreichen Abschluß zu bringen, zumal auch bei den Säkularen tiefsitzende (und wohlbegründete) Existenzängste jederzeit wieder in eine Abschottungshaltung umschlagen können.
Dabei geht es zwar zuerst, aber nicht nur, um die Umsetzung der Oslo-Verträge mit den Palästinensern. Ein Bild verdeutlicht den größeren Zusammenhang: Wenn jubelnde Palästinenser während der jüngsten Irak-Krise wieder einmal Saddam Hussein zum Abschuß von Scud-Raketen auf Israel auffordern, dann weckt dies nicht nur schlimme Erinnerungen an den Golf-Krieg, sondern auch Ängste vor einer allgegenwärtigen Bedrohung, die sich in der Debatte über diverse „Sicherheitslandkarten" niederschlagen. Denn das Gezerre um den überfälligen weiteren Rückzug der israelischen Armee in der Westbank hängt mit der Einschätzung der strategischen Großwetterlage im Nahen Osten zusammen. Und ähnlich wie im Inneren gibt es auch in der Außen- und Sicherheitspolitik zwei Schulen, die in noch stärkerem Maße die Zukunft Israels beeinflussen werden und die man analog mit den Etiketten „Traditionalisten" und „Modernisierer" kennzeichnen könnte:
- Die ersteren haben das Trauma von fünf Kriegen im Gedächtnis und verbinden damit ein geographisches Sicherheitskonzept: möglichst weite Räume und abgesicherte Grenzen, um genügend Zeit zu haben, einen konventionellen Vorstoß arabischer Armeen abzuwehren. Das erklärt das Gefeilsche um jeden Prozentpunkt beim Rückzug aus der Westbank, das Beharren auf der Außenkontrolle der palästinensischen Gebiete und die Beibehaltung der Golan-Höhen und der Sicherheitszone im Südlibanon. Hauptvertreter dieser Richtung ist der in jüngster Zeit wieder an Einfluß gewinnende Infrastrukturminister Ariel Sharon (Likud), der als Verteidigungsminister in den achtziger Jahren das Debakel im Libanon zu verantworten hatte.
- Die zweite Gruppe sieht die größte Gefahr nicht mehr in unsicheren Grenzen, sondern in Veränderungen des strategischen Gleichgewichts in der Region, vor allem und zunehmend bei nicht-konventionellen Waffen. Folgerichtig steht für sie die Aufrechterhaltung des engen Bündnisses mit den USA und das Schmieden neuer Allianzen im Nahen Osten im Vordergrund. Als ihr Kopf gilt Verteidigungsminister Mordechai (ebenfalls Likud), der als Ex-General und Sepharde eine aussichtsreiche Alternative zu Netanjahu darstellt.
Natürlich geht das Denken beider Schulen ineinander über, vermischen sich territoriale und strategische Überlegungen. Auch sind Vertreter beider Richtungen quer durch die Parteien zu finden, gehört zum Beispiel der Vorsitzende der eindeutig friedensorientierten Meretz, Sarid, zu den hartnäckigsten Verfechtern der Sicherheitszone im Südlibanon. Doch wird es für Israels Zukunft im Nahen Osten von entscheidender Bedeutung sein, welche der beiden Schulen – in welcher Gewichtung auch immer – die Oberhand gewinnen wird. Dies gilt für den Friedensprozeß mit den Palästinensern im engeren Sinne und darüber hinaus im Kontext des gesamten Nahen Ostens, für das Verhältnis zu einzelnen Staaten der Region ebenso wie für die Beziehungen zu den USA und Europa.
„Ein verlorenes Jahr für den Frieden"
Wenn man in der innenpolitischen Bilanz der Regierung Netanjahu schon mehr Schatten als Licht sehen kann, so läßt sich die friedenspolitische Bilanz getrost als katastrophal kennzeichnen. Der Eckpfeiler des von Rabin und Peres eingeleiteten Friedensprozesses – eine Übereinkunft mit den Palästinensern – scheint in seinen Grundfesten bedroht. Konnte das Hebron-Abkommen vom Januar letzten Jahres zunächst als erster Durchbruch der neuen, konservativen Regierung gedeutet werden, so machte der kurz danach gefaßte Beschluß zum Bau der neuen Siedlung Har Homa nahe Jerusalem auch diese aufkeimende Hoffnung zunichte. Die mörderischen Selbstmordanschläge in Jerusalem im Sommer mit 21 Toten ließen vollends die sich hinschleppenden und immer wieder vertagten Verhandlungen über Einzelheiten des Oslo-Abkommens, wie Flughafen und Hafen im Gazastreifen, freier Durchgang von Gaza zur Westbank, Export palästinensischer Güter ins Ausland und vieles andere mehr, zum schieren Ritual erstarren: auf der einen Seite die Palästinenserbehörde unter Arafat, die unermüdlich auf der buchstabengetreuen Einhaltung eines Abkommens beharrt, das der unterschiedlichsten Interpretation Tür und Tor öffnet, und auf der anderen Seite die Israelis, die gebetsmühlenhaft absolute Sicherheitsgarantien von ihren palästinensischen Partnern verlangen, wohl wissend, daß es so etwas auch unter der früher umfassenden israelischen Besatzung nicht gegeben hat.
„Ein verlorenes Jahr für den Frieden", so bilanzierte die amerikanische Außenministerin Albright das Jahr 1997, nachdem auch ihr erster Besuch im Nahen Osten im September und weitere Treffen mit Netanjahu und Arafat in Paris, London und Genf zu keinem Ergebnis geführt hatten. So scheint es in der Tat, zumal der im Oslo-Abkommen vorgesehene Zeitpunkt für eine endgültige Einigung zwischen den Konfliktparteien im Mai 1999 immer näher rückt. Aus dieser zeitlichen Not versucht Ministerpräsident Netanjahu eine Tugend zu machen: Seit Monaten predigt er die Einleitung der Endstatus-Verhandlungen, noch bevor die einzelnen Schritte des Oslo-Abkommens umgesetzt sind. Was auf den ersten Blick wie eine neue Finte des trickreichen Regierungschefs aussieht, um erneut Zeit zu gewinnen, ist beim näheren Hinsehen nicht ganz so unvernünftig. Denn das Oslo-Abkommen beruhte auf der Voraussetzung, daß im Laufe der Verhandlungen das Vertrauen zwischen den Parteien wachsen würde und auf dieser Grundlage eine vernünftige Regelung möglich sei. Aber das genaue Gegenteil ist seit Netanjahus Amtsantritt eingetreten, und wenn er auch selbst ein gerüttelt Maß Schuld daran trägt, so ändert dies doch nichts an der Tatsache, daß inzwischen jeder noch so kleine Schritt von der Aura des größtmöglichen Mißtrauens auf beiden Seiten begleitet wird. Unter diesen Umständen hängt jeder Fortschritt im Kleinen vom Wissen oder zumindest der Ahnung von den großen Umrissen einer umfassenden Regelung ab. Wenn Arafat für den Mai 1999 die einseitige Ausrufung eines souveränen Palästinenserstaates androht, dann trifft er den Kern dieses Problems; denn es geht in erster Linie darum, ob es einen Staat für die Palästinenser geben und welche Grenzen und Befugnisse dieser haben wird. Erst danach werden Fragen wie der Status von Jerusalem, die Flüchtlingsproblematik, die Zukunft der jüdischen Siedlungen und die Wasserverteilung zu regeln sein.
Und in dieser Hinsicht gibt es durchaus Bewegung auf verschiedenen Seiten, wobei die interessanteste von der politischen Rechten kommt, ohne die ein Friedensschluß kaum möglich sein wird. So sprachen sich der Likud-Fraktionsvorsitzende Sheetrit offen, Netanjahus ideologischer Chefberater Bar-Ilan verklausuliert im Grundsatz für einen palästinensischen Staat aus. Deutlicher werden dessen Umrisse in den „blue prints", die der Avoda-Vordenker und Chefarchitekt des Oslo-Abkommens, Yossi Beilin, mit dem führenden PLO-Politiker Abu Mazen einerseits, und dem Likud-Abgeordneten Eitan andererseits ausgearbeitet hat: an deren Faustformel, wonach ein Maximum der jüdischen Siedler bei Israel und desgleichen ein Maximum des Territoriums der Westbank beim zukünftigen palästinensischen Staat verbleiben soll, wird wohl keine zukünftige Friedensregelung vorbeikommen. Daran ändern auch nichts die von Sharon und Mordechai vorgelegten „Sicherheitslandkarten", die zwischen 50 und 70 Prozent der Westbank unter israelischer Kontrolle vorsehen und die wohl – zumindest bei Mordechai – nur als Eintrittskarte in die Verhandlungen zu verstehen sind.
Nicht hinwegtäuschen darf sich die internationale Öffentlichkeit über die Grenzen der Kompromißbereitschaft Israels. Diese hat der Avoda-Vorsitzende Barak in einem Interview im Dezember klar benannt: ein großes und vereinigtes Jerusalem, keine Rückkehr zu den Grenzen des Waffenstillstands von 1967, keine moderne Armee westlich des Jordan-Flusses und eine Mehrheit der jüdischen Siedler – nicht notwendigerweise der jüdischen Siedlungen – unter israelischer Souveränität. Dies ist – wohlverstanden – das Angebot der politischen Linken, das erst noch der Mehrheitsfähigkeit bedarf. Auf der anderen Seite ist auch klar, daß keine palästinensische Führung einen Staat in Form eines Flickenteppichs und mit nur minimalen Souveränitätsrechten akzeptieren kann. Dazu kommen die ökonomischen Restriktionen: Waren 1978 noch 38 Prozent der palästinensischen Arbeitskräfte in Israel beschäftigt, so waren es 1996 nur noch fünf Prozent. Die andauernde Abriegelung des Gazastreifens und der Westbank hat so zu einer Strangulierung der Wirtschaft in diesen Gebieten geführt: Das Pro-Kopf-Einkommen ist um 25 Prozent gesunken,19 Prozent der Einwohner leben heute unter der Armutsgrenze, in Gaza allein sind es über 36 Prozent. Unter solchen Bedingungen kann auch auf der anderen Seite keine Friedensbereitschaft wachsen, und die von israelischer Seite so vehement beklagte Radikalisierung im palästinensischen Lager kann man zum Gutteil als „self-fulfilling prophecy" bezeichnen.
Neue Gefahren, neue Allianzen
Der stockende Friedensprozeß mit den Palästinensern hat auch Israels Lage im Nahen Osten verschlechtert und die Beziehungen mit den USA schwer belastet. Das Verhältnis zu Ägypten, dem wichtigsten arabischen Staat, ist auf dem Gefrierpunkt angelangt, Jordanien hält dank der Geduld von König Hussein weiterhin geschäftsmäßige Beziehungen aufrecht. Dies sind die beiden Länder, mit denen Friedensabkommen und volle diplomatische Beziehungen bestehen – der Kern dessen, was Shimon Peres einst als neuen Nahen Osten aufbauen wollte. Die meisten anderen Staaten der Region halten sich mit offiziellen politischen Kontakten zurück, wie der Boykott der Wirtschaftskonferenz in Katar im November vergangenen Jahres beweist. Andererseits berichten israelische Geschäftsleute von einem großen Erfolg bei eben jener Konferenz, nämlich auf der Ebene der Geschäftskontakte mit vielen arabischen Ländern und der Geschäftsabschlüsse, vor allem mit ägyptischen, jordanischen und Partnern aus der Golfregion. Auch haben die anderen arabischen Staaten mit quasi-diplomatischen Beziehungen zu Israel (Marokko, Tunesien, Mauretanien, Oman, Katar) ihre Drohungen nicht wahrgemacht, diese Beziehungen abzubrechen oder zumindest einzufrieren.
Für die gemäßigten arabischen Länder gilt denn auch, daß es für sie keine Alternative zum Frieden mit Israel gibt, weil sie schon mit ihren inneren Problemen nicht fertig werden und weil das dringend benötigte ausländische Kapital nur dann in die Region kommt, wenn Stabilität zu erwarten ist. Ein palästinensischer Intellektueller drückte dies gegenüber einem israelischen Kollegen so aus: „Ohne Frieden mit Euch werden wir keine Demokratie haben, und wir werden weiterhin zwischen fanatischem Islam und Stammesmafia zerrieben. Ohne Demokratie können wir unsere Identität nicht wiederfinden, und wenn wir nicht Frieden mit uns selbst machen, wie können wir dann Frieden mit Euch machen ?".
Aus der Sicht der Friedensskeptiker in Israel läßt sich also mit der gegenwärtigen Situation gut leben, gab es schließlich doch wesentlich schlechtere Zeiten, als Israel im Nahen Osten (und darüber hinaus) ein Paria-Dasein fristen mußte. Gravierender ist da schon die erhebliche Verschlechterung des Verhältnisses zu den Vereinigten Staaten während der Amtszeit Netanjahus, was fast einem Kunststück gleichkommt, gilt doch die Clinton-Administration als die Israel-freundlichste in der wechselvollen Geschichte zwischen beiden Ländern. Gerade deswegen fühlen sich die Amerikaner von Netanjahu an der Nase herumgeführt, steht doch ihre Reputation als ehrlicher Makler zwischen den Konfliktparteien auf dem Spiel – eine Rolle, die ihnen viele arabische Staaten inzwischen absprechen, lautstark dabei unterstützt von Rußland und Frankreich, die ihre eigenen Interessen im Nahen Osten im Auge haben. So forderte die amerikanische Außenministerin Albright bei ihrem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Mitte November in London Fortschritte auf vier Gebieten: ein Einfrieren des Siedlungsausbaus in der Westbank, den weiteren Truppenrückzug, die Beschleunigung der Gespräche über ein Endstatus-Abkommen und eine intensivierte Zusammenarbeit in den vom Oslo-Akommen vorgesehenen Feldern. Da seither nichts davon umgesetzt wurde, kam es zu einer einmaligen Desavouierung eines israelischen Ministerpräsidenten: Netanjahu wurde während eines USA-Aufenthaltes im Herbst vom amerikanischen Präsidenten demonstrativ nicht empfangen. Und wie weit inzwischen die Abkühlung der beiderseitigen Beziehungen gediehen ist, wird daraus deutlich, daß Albright die Israelis nunmehr für alle Mißerfolge Washingtons in Nahost verantwortlich macht, vor allem für den Boykott der Katar-Konferenz und die Weigerung der Araber, die alte Allianz gegen Saddam Hussein in der jüngsten Irak-Krise wiederaufleben zu lassen. Für letzteres hatte der alte Realpolitiker Henry Kissinger in der „Los Angeles Times" nur einen gelassenen Kommentar übrig: „Ich kenne keinen Staat der früheren Golf-Koalition, der wegen der palästinensischen Sache die irakische Vorherrschaft im Golf ermutigen würde – vor allem, da die meisten die Palästinenser aus ihren Ländern ausgewiesen haben".
Tatsächlich zeichnet sich immer klarer eine zweigleisige Strategie der amerikanischen Regierung ab: auf der öffentlich-politischen Ebene verurteilt man die Blockadepolitik der Regierung Netanjahu, im engeren sicherheitspolitischen Bereich arbeitet man hingegen eng zusammen. Denn für die USA wie für Israel geht es längst nicht mehr nur um die Beendigung des Palästina-Konflikts sondern um ganz andere Dimensionen, die für die einen ihre globale Vormachtstellung, für die anderen ihre Existenz als Staat berühren. Und da beider Interessen in dieser Hinsicht übereinstimmen, kann alles Lamentieren von arabischer Seite nichts an dieser natürlichen Allianz ändern. Diese Interessen lassen sich wie folgt definieren:
- Eindämmung der aggressiven Staaten der Region (rogue states), die wie Iran, Syrien und Irak mit allen Mitteln und in jüngster Zeit mit russischer und chinesischer Hilfe ihre nicht-konventionelle (nukleare, chemische, biologische) Aufrüstung betreiben;
- Schutz der gemäßigten, pro-westlichen Regime vor allem in Ägypten und im Golf vor äußerer Aggression und islamistischer Unterminierung im Inneren;
- Zurückweisung des Versuchs anderer Großmächte, vor allem Rußlands, Chinas und Frankreichs (als Stellvertreter Europas), in der Region Fuß zu fassen, auch im angrenzenden Zentralasien, wo sich die weltweit größten Erdöl- und Gasvorkommen befinden.
Der Nahe Osten entwickelt sich wieder einmal zu einem bevorzugten Spannungsfeld von Großmachtinteressen, dem das benachbarte Zentralasien mit seinen ökonomischen und geostrategischen Potentialen zusätzliches Gewicht verleiht. Dies kommt im Rüstungswettlauf der wichtigsten Staaten der Region zum Ausdruck, wobei Israel als Rüstungsexporteur mittlerweile sogar Rußland überholt hat und jetzt den fünften Platz in dieser Rangliste einnimmt. Die militärischen Kräfteverhältnisse stellen sich wie folgt dar:
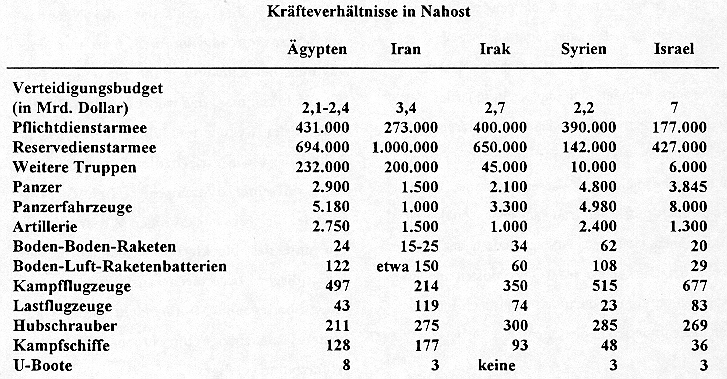
Im Iran müssen in der Pflichtdienstarmee noch weitere 110.000 Mann, Mitglieder der Revolutionswächter, hinzugezählt werden. In Israel muß man zu den Boden-Boden-Raketen noch eine unbekannte Zahl von Jericho-Raketen hinzuzählen.
Quelle: „Jediot Aharonot", zitiert nach „Pressespiegel der Deutschen Botschaft Tel Aviv", 17.10.1997
Diese Kräfteverhältnisse haben im letzten Jahr durch den Aufbau und die Festigung einer militärpolitischen Allianz zwischen Israel und der Türkei eine neue Dimension erhalten, die – unter dem amerikanischen Schirm – Israels strategische Position wesentlich verbessert. Israelische Rüstungsunternehmen haben große Aufträge zur Modernisierung der türkischen Luftwaffe erhalten, der Verkauf von unbemannten Aufklärungsflugzeugen steht an, israelische Piloten können im türkischen Luftraum Übungsflüge durchführen, ein erstes gemeinsames Seemanöver (unter Einschluß der Amerikaner) fand statt. Die gemeinsamen Interessen sind so stark, daß sie auch durch das Zwischenspiel der islamistischen Regierung Erbakan nicht beeinträchtigt werden konnten: Syrien, als letzter Feindstaat an den Grenzen Israels, hat territoriale Ansprüche an die Türkei und streitet sich überdies wegen der Wasserfrage mit dem türkischen Nachbarn; außerdem befindet sich das Hauptquartier der separatistischen PKK in Damaskus. Vom Irak gehen immer wieder Angriffe der PKK aus, und auch hier spielt die Wasserfrage eine Rolle. Schließlich gefährdet Iran mit seinen nuklearen Ambitionen nicht nur Israel, sondern auch die Rolle der Türkei als NATO-Vorposten in der Region und kommt dazu den türkischen Interessen in Zentralasien in die Quere.
Diese türkisch-israelische Allianz, vor allem vom israelischen Verteidigungsminister Mordechai geschmiedet, der zugleich in Washington – im Gegensatz zu Netanjahu – höchstes Ansehen und Vertrauen genießt, könnte langfristig über alle Querelen des gegenwärtigen Friedensprozesses hinweg die Position Israels im Nahen Osten bestimmen. Nimmt man hinzu, daß es für die gemäßigten arabischen Staaten keine Alternative zu einem halbwegs friedlichen Nebeneinander mit Israel gibt, weil sie selbst von den gleichen äußeren Feinden bedroht sind, die überdies ihre inneren Gegner unterstützen, dann wird klar, daß der Staat Israel sich bei aller inneren Zerrissenheit noch immer in einer nahezu unangefochtenen Lage befindet: mit einem Bruttosozialprodukt, das größer ist als das aller Nachbarstaaten zusammengenommen, trotz nur eines Zehntels der Einwohnerzahl; mit einem Pro-Kopf-Einkommen, das weit über dem Durchschnitt der Region und über dem von EU-Mitgliedern wie Griechenland und Spanien liegt; mit einer dynamischen High-Tech-Industrie, die trotz rückläufiger Wirtschaftsdaten und des blockierten Friedensprozesses ausländische Investoren anzieht; und mit einer überlegenen Militärmacht, die bis auf weiteres als einzige im Nahen Osten über Atomwaffen verfügt.
Angesichts dieser Bilanz darf vielleicht doch gefeiert werden, denn schließlich denkt niemand daran, das Licht am Ben-Gurion-Flughafen auszuknipsen. Ganz im Gegenteil: ein weiterer Streitpunkt in Israel ist die Erweiterung der Kapazitäten am Flughafen, der den ständig wachsenden Strom von Fluggästen nicht mehr bewältigen kann. Und auf der Tagesordnung steht auch die Beseitigung der größten Müllkippe des Landes, die in der Einflugschneise des Flughafens liegt und wegen der davon angezogenen Vogelschwärme den Flugbetrieb gefährdet. Ganz normale Probleme also für einen Staat, der auch im fünfzigsten Jahr seiner Existenz noch immer nicht zur Normalität gefunden hat.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Mai 1999