

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
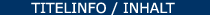
TEILDOKUMENT:
[Essentials]
- Die neue Koalition aus der religiösen Wohlfahrtspartei und der konservativen Partei des Rechten Weges ist ein Produkt des Machttriebs der jeweiligen Parteiführer Erbakan und Frau Çiller; die inhaltlich-politischen Gemeinsamkeiten sind minimal. Der Zusammenhalt der Regierung ist deshalb äußerst labil.
- In der Innenpolitik sind keine Anzeichen für eine entschiedene Demokratisierung zu erkennen. Auch unter Erbakan dominieren "law and order", umfassende Personalprotektion in den Ministerien sowie ein unkontrollierter und undemokratischer Sicherheitsapparat. Die fundamentalen Strukturprobleme in Staat und Gesellschaft werden ignoriert. Erbakan ist peinlich bemüht, islamistische Anklänge in der Regierungspolitik zu vermeiden. Vor allem achtet er darauf, die Militärführung nicht zu irritieren.
- Erbakans Versuch, in der Kurdenfrage zu einem planvollen, mehrdimensionalen Lösungsansatz unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen überzugehen, sind (bisher) am Widerstand des nationalistischen Establishments gescheitert.
- In der Wirtschaftspolitik vernachlässigt die Koalition die lange überfällige Sanierung des öffentlichen Bereiches zugunsten einer populistischen Ausgabenpolitik. Die Gratwanderung zwischen der kurzfristigen Befriedigung von Wählerwünschen und der Aufrechterhaltung des Vertrauens der internationalen Finanzmärkte birgt ein hohes Risiko.
- In der Außenpolitik akzeptiert Erbakan die Unumgänglichkeit der Fortsetzung einer Westorientierung, behält sich aber in Arbeitsteilung mit der Außenministerin jene Aktionen vor, die den Anschein einer (islamischen) Neuorientierung erwecken. Im Kern findet (wieder einmal) eine stärkere außen- und sicherheitspolitische Betonung der nationalen Interessen vor der Einbindung in westliche Bündnis- und Politikzusammenhänge statt.
- Die Beziehungen zur Europäischen Union haben sich trotz der Zollunion nicht verbessert. Mittelfristig droht eine weitere Entfremdung zwischen der EU und der Türkei. Der griechisch-türkische Konflikt, das Zypernproblem und der Ausschluß der Türkei von der umfassenden Erweiterungspolitik der EU sind die Haupttriebkräfte dieser Negativentwicklung.
Die "Refahyol"-Koalition: ein Zweckbündnis aus politischem Ehrgeiz
Als am 8. Juli 1996 die Ende Juni gebildete Koalitionsregierung aus der religiös orientierten Wohlfahrtspartei (Refah Partisi/RP) und der konservativen Partei des Rechten Weges (Dogru Yol Partisi/DYP) mit 278 gegen 265 Stimmen die Vertrauensabstimmung in der Großen Türkischen Nationalversammlung gewann, war der RP-Vorsitzende Necmettin Erbakan endgültig am Ziel seiner Wünsche angekommen: Er war Ministerpräsident, und erstmals in der Geschichte der Republik war eine nicht den Traditionen Atatürks verpflichtete Partei führende Regierungskraft. So vollzog sich eine Entwicklung, die sich bereits nach den Parlamentswahlen vom 24. Dezember 1995 angekündigt hatte. Damals war die RP erstmals in ihrer über dreißigjährigen Existenz die stärkste politische Gruppierung der Türkei geworden, wenngleich auch nur mit einem Stimmenanteil von 21,38 Prozent.
Der Machtbeteiligung wurde möglich, weil die Anfang März 1996 unter großen Mühen (und wohl nur mit einiger Nachhilfe des Militärs) zustandegekommene Koalition der beiden Mitte-Rechts-Parteien, DYP und ANAP (Mutterlandspartei), schon nach drei Monaten an der persönlichen Rivalität der Parteiführer, Tansu Çiller und Mesut Yilmaz, zerbrach. Mutterland-Chef Yilmaz hatte tatenlos zugesehen, wie Abgeordnete seiner Partei eine parlamentarische Untersuchung wegen schwerer Korruptionsvorwürfe gegen die DYP-Vorsitzende Çiller unterstützten, die Erbakan und die RP erhoben hatten. Als sie sich mit der Möglichkeit eines Verfahrens vor dem Staatsgerichtshof konfrontiert sah, zog Frau Çiller ihre Partei aus der Koalition zurück, und Ministerpräsident Yilmaz blieb nur der Rücktritt.
Daß die DYP-Vorsitzende dann aber ausgerechnet mit dem Mann, der sie politisch ruinieren wollte, eine Koalition einging, und Erbakan seinerseits keine Bedenken hatte, mit der von ihm öffentlich diskreditierten Tansu Çiller die Regierung zu bilden, zeigt nur, daß politischer Ehrgeiz und das Festklammern an bzw. das Erringen von Macht und Einflußspähren weitaus wichtiger sind als ideologische und politische Prinzipien. Die neue Regierung wird folglich auch nicht durch inhaltliche oder ideologische Gemeinsamkeiten zusammengehalten, sondern vor allem durch die wechselseitige "Geiselposition" der Führungspersonen, die ihrer Ämter nur sicher sein können, so lange die andere Seite mitspielt.
Da ist es nur konsequent, wenn zwischen den Parteien eine klare Aufteilung der Ämter mit jeweils praktisch uneingeschränkter Handlungsautonomie erfolgte. Die DYP bekam dabei die Schlüsselpositionen in der Wirtschafts-, Innen- und Sicherheitspolitik, während die RP sich den Zugriff auf für die Vergabe öffentlicher Aufträge wichtige Strukturministerien, das Justiz- und - als Zugeständnis im gesamtwirtschaftlichen Bereich - das Finanzministerium sicherte. Eine gegenseitige Abstimmung findet eher zufällig statt. Im Kabinett legt man sich gegenseitig nach Möglichkeit keine Steine in den Weg. Lediglich die gemeinsame Ernennung hoher Beamter bereitet wegen der damit verbundenen Einflußmöglichkeiten auf die verschiedenen Zweige des Staatsapparates gewisse Probleme. Da kann es schon zu einer anhaltenden wechselseitigen Blockade der jeweiligen Favoriten kommen, bis dann ein Kompromißkandidat gefunden ist. Kohärentes Regierungshandeln ist unter diesen Bedingungen eher Zufall.
Bei den westlichen Verbündeten der Türkei führte die Übernahme der Regierungsgewalt durch die Wohlfahrtspartei zu erheblichen Irritationen. Kommentare schwankten zwischen Befürchtungen, daß nunmehr die westliche Orientierung der türkischen Politik zu Ende gehen könnte, und Beschwichtigungen, daß einer islamistischen Wende in der Türkei deutliche Grenzen gezogen seien. Für beide Positionen gibt es genügend Anhaltspunkte.
So hatte Erbakan im letzten Wahlkampf immer wieder verkündet, die bisherige Politik der Westorientierung durch eine stärkere Hinwendung zur islamischen Welt ablösen zu wollen. Es war vom Austritt aus der NATO und der Aufkündigung der Zollunion mit der EU ebenso die Rede gewesen wie von der Schaffung eines gemeinsamen islamischen Marktes oder gar einer "islamischen UNO". Andererseits konnte man darauf verweisen, daß Erbakan für alle Maßnahmen auf die Zustimmung seiner Koalitionspartnerin, der eindeutig pro-westlichen früheren Ministerpräsidentin Çiller, angewiesen ist. Zu berücksichtigen ist auch, daß das türkische Militär eine Abschaffung der kemalistischen Grundlagen der türkischen Republik nicht hinnehmen würde. Mit Spannung wurden deshalb die ersten Ankündigungen und Maßnahmen der neuen Regierung erwartet.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | April 1999