

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
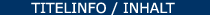
TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 1-2 = Titelblatt]
[Seite der Druckausg.: 3]
Für die Friedrich-Ebert-Stiftung mit einem Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ist die zukünftige Entwicklung der Bundesstadt Bonn als "Standort für Entwicklungspolitik, nationale, internationale und supranationale Einrichtungen" (Berlin/Bonn Gesetz, 1994) von unmittelbarer Bedeutung.
Sie hat darum Bitten befreundeter Organisationen entsprochen und sich bereits 1994 im Rahmen der Diskussion um "Bonn als Nord-Süd-Zentrum" als Plattform für Informations- und Abstimmungsgespräche zur Verfügung gestellt. Entsprechend wurden am 10. März und 31. Mai 1994 unter Beteiligung von Vertretern des Landes NRW, der Stadt Bonn, von BMZ und anderen Bundesministerien, Gewerkschaften und entwicklungspolitischen Organisationen Gesprächsforen durchgeführt. Als Folge dieser informellen Gesprächskreise erklärte sich die Friedrich-Ebert-Stiftung bereit, 1995 zu einem "Statusseminar" zur Diskussion von Fortschritten und Ergebnissen einzuladen und den Diskussionsprozeß fachlich zu begleiten.
In diesem Kontext wurden mit Winfried Böll, Dr. Dieter Danckwortt, Prof. Dr. Uwe Holtz und Dipl.-Kfm. Hans Pakleppa Persönlichkeiten für die Erarbeitung einer Studie gewonnen, die über langjährige und hervorragende Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit verfügen und in vielfältiger Weise in diesem Arbeitsfeld und in Bonn engagiert sind.
Die von ihnen vorgelegte Studie ist mehr als eine Bestandsaufnahme: Sie ist ein Beitrag zur Konzeption und Orientierung, der in den Mittelpunkt zunächst den Nutzen für die Entwicklungspolitik und danach für das Profil Bonns stellt.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung erhofft sich mit der Publikation dieser Studie und deren Diskussion einen Beitrag zur Realisierung und inhaltlichen Ausgestaltung des "Nord-Süd-Zentrums Bonn" zu leisten, der über die notwendige und grundlegende institutionelle Zusammenführung hinaus eine politische Kommunikation zwischen den beteiligten Organisationen fördert, die den Stellenwert der Entwicklungspolitik als globaler Struktur- und Friedenspolitik erweitert und mit dem Namen der Stadt Bonn verbindet.
Die von den Verfassern der Studie vertretenen Positionen und Vorschläge müssen sich nicht notwendigerweise und in allen Fällen mit denen der Friedrich-Ebert-Stiftung decken. Sie sind gedacht als Beitrag zu einem Diskussionsprozeß, der seit den Arbeitsgesprächen des Jahres 1994 erfreulich an Dynamik und Konkretion gewonnen hat.
Als Anlage angefügt ist ein Arbeitspapier von Dr. Wolfgang S. Heinz über die Möglichkeit zur Errichtung eines Menschenrechtsinstituts in Bonn, das auf Anregung von befreundeten Organisationen von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben worden ist.
Bonn, im August 1995 |
Dr. Erfried Adam
|
[Seite der Druckausg.: 4 = Leerseite]
Zusammenfassung
[Seite der Druckausg.: 5-6 = Inhaltsverz.]
Im Berlin/Bonn-Gesetz vom 26.4.94 und im Ausgleichsvertrag vom 29.6.94 sind Leitvorstellungen, Ziele und Ausgleichsmaßnahmen zum Erhalt und zur Förderung des Politikbereiches "Entwicklungspolitik, nationale, internationale und supranationale Einrichtungen" für Bonn vorgegeben und festgeschrieben worden.
Die kommenden Monate sind entscheidend dafür, ob Bonn als Zentrum für Nord-Süd-Zusammenarbeit und internationale Politik konsequent und ohne Verzögerung überzeugende Konturen gewinnt, oder trotz Zuzug einiger weiterer Institutionen letztlich mit mittelmäßigen Minimallösungen eine Ansammlung politischer Restposten wird, der dem hohen Anspruch der beschlossenen Formulierungen nicht gerecht wird und dem Ruf Bonns dann eher schadet als nützt.
Zweifellos ist überall guter Wille vorhanden beim Bund, beim Land und auch in der Stadt und der Vielzahl der staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen, die sich mit Nord-Süd-Aufgaben befassen.
Es fehlt aber noch eine Konzeption, die ahnen läßt, wie das Nord-Süd-Zentrum Bonn konkret arbeiten wird.
Es geht darum,
- nach innen und außen zu signalisieren, daß das vereinte Deutschland seiner gewachsenen internationalen Verantwortung durch ein verstärktes Engagement in der Entwicklungspolitik und in den Vereinten Nationen Rechnung trägt.
- Für Bonn ein neues attraktives Profil als Standort für Entwicklungspolitik, als UNO-Stadt und Internationales Konferenzzentrum auch schon jetzt vor dem Umzug von Bundestag und Regierung nach Berlin zu entwickeln.
Eine stärkere Vernetzung der in Bonn verbleibenden Politikbereiche Entwicklungszusammenarbeit, Umwelt, Forschung und Kultur, kann schon jetzt Gestalt gewinnen und in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer dynamischen Politik auf diesen Feldern für die Zukunftssicherung unter Beweis stellen. Es muß auch in diesem Jahr klar werden, wie das Nord-Süd-Zentrum Bonn aussehen wird und welche Leistungen man von ihm erwarten kann.
Eine von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegebene Studie mit dem Titel "Nord-Süd-Zentrum Bonn" trägt Bausteine zu einem Entwurf zusammen, der die bisherige, eher zögerliche Diskussion auf konkrete Vorstellungen und Forderungen lenkt.
Die Verfasser dieser Studie (Winfried Böll, Dr. Dieter Danckwortt, Prof. Dr. Uwe Holtz und Heinz Pakleppa) haben langjährige politische Erfahrungen im Bundestag, im Entwicklungsministerium, in nationalen und internationalen Entwicklungsinstitutionen.
Politischer Mittelpunkt des Nord-Süd-Zentrums bleibt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Von besonderer Bedeutung ist auch das Bundesumweltministerium.
Die Bundesregierung bzw. die betreffenden Ressorts sollten jene Abteilungen, Referate und Arbeitsbereiche aus dem Nord-Süd-Bereich anderer Ministerien – auch jener, die nach Berlin umziehen (wie das Auswärtige Amt, das Wirtschafts- oder das Innenministerium) – enger mit dem BMZ kooperieren lassen. So könnte eine kohärente Entwicklungspolitik, die z.B. Agrar-, Umwelt-, Wirtschafts-, Sicherheits- sowie Wirtschafts- und Forschungsfragen einschließt, betrieben werden. Eine bessere Bündelung und Vernetzung der Nord-Süd-Fragen innerhalb der Bundesregierung käme auch dem Anspruch des BMZ entgegen, zukünftige Beiträge zu einer globalen Strukturpolitik leisten zu wollen.
Die Bundesregierung sollte einen verbindlichen Zeitplan, verbunden mit einem attraktiven Unterbringungsangebot für die Übersiedlung nationaler Entwicklungsinstitutionen nach Bonn vorlegen (so für den Deutschen Entwicklungsdienst, das Deutsche Entwicklungsinstitut und die Deutsche Stiftung
[Seite der Druckausg.: 8]
für Internationale Entwicklung, die bisher langjährigen Sitz in Berlin haben).
Zusammen mit der Stadt Bonn sollte sie die Ansiedlung weiterer UN-Organisationen sowie europäischer und internationaler Einrichtungen aktiv betreiben (so die Ansiedlung des Sekretariats der UN-Wüstenkonvention und die Installierung eines zureichend ausgestatteten UN-Informationszentrums, die Ansiedlung des EU-Ausschusses der Regionen sowie die Übersiedlung des Instituts für europäisch-lateinamerikanische Beziehungen IRELA aus Madrid, der Society for International Development (SID) aus Rom und des Inter-Press-Service aus Amsterdam).
Je attraktiver die Bundesstadt als nationales und internationales Nord-Süd-Zentrum wird, desto größer wird die Sogwirkung auf andere Entwicklungsinstitutionen sich auf das entwicklungspolitische Kraftzentrum Bonn zu orientieren. Desto unwahrscheinlicher und unsinniger wird auch der "Rutschbahneffekt" von eigentlich in Bonn verbleibenden Ministerien nach Berlin – von der internationalen Unglaubwürdigkeit ganz zu schweigen, die beim Abdriften des BMZ und des Umweltministeriums nach Berlin zwangsläufig wäre, da man ja internationale Organisationen wie das UN-Freiwilligen-Programm und das Sekretariat der Klima-Rahmen-Konvention u.a. mit dem Hinweis nach Bonn eingeladen hat, daß in der Bundesstadt die Politikbereiche Entwicklung und Umwelt bleiben und gefördert werden sollen.
Im Bonner Raum und unter Einschluß Aachens und Kölns gibt es mehr als hundert staatliche und private nationale und internationale Institutionen und Einrichtungen, die sich mit Nord-Süd-Fragen befassen. Ihr Potential und das der noch in Bonn anzusiedelnden Institutionen gilt es, besser, wirksamer und kostengünstiger als bisher für die Lösung andauernder Probleme (Hunger, Armut und Bevölkerungsexplosion, Umwelt, Migration) sowie neuerer internationaler Herausforderungen zu nützen (die Konsequenzen der dramatischen Entwicklungen in Asien für Deutschland, Europa und die Welt, die Problematik der unmittelbaren Nachbarn der EU im Osten, Südosten und am südlichen Mittelmeerrand sowie die Institutionalisierung einer wirksamen weltweiten Katastrophenvorbeugung nach Auslaufen der spezifischen UN-Dekade auch in der Bundesrepublik). Der Verbund nicht-staatlicher Entwicklungsinstitutionen und -einrichtungen (zu den letzteren zählt insbesondere das kürzlich an der Bonner Universität gegründete Nord-Süd-Zentrum für Entwicklungsforschung) könnte unter Rückgriff auf bestehende Kompetenzen darüber hinaus
- die staatliche Entwicklungspolitik (auch der EU) kritisch begleiten (u. a. durch einen "Bonner Kommentar" zum entwicklungspolitischen Gesamtverhalten von Regierung und Parlament),
- die Aufmerksamkeit für Nord-Süd-Fragen und die Spezial- bzw. Sonderorganisationen der Vereinten Nationen stärken,
- die deutsch-französische Zusammenarbeit in der internationalen Politik, insbesondere der Nord-Süd-Politik fördern,
- das Dialog-, Bildungs- und Informationsangebot in Bonn verstärken.
Die Verfasser der Studie schlagen ein Modell für sechs möglichst weitgehend miteinander vernetzte und Synergieeffekte fördernde Säulen für das "Nord-Süd-Zentrum Bonn" vor:
- die Säule "staatliche Entwicklungspolitik" (mit dem BMZ als Kern). Internationale Konferenzen mit Südbezug sollten durch das Bonner Zentrum vorbereitet und ausgewertet werden. Der wissenschaftliche Beirat des BMZ sollte in die Programme einbezogen und jährlich ein "Bilanzgespräch" mit den Institutionen des Bonner Verbundes durch ihn angeregt werden. Im BMZ sollten verstärkt Praktika möglich sein und Veranstaltungen wie das "BMZ-Sommerseminar" wiederbelebt werden.
- Im Rahmen der staatlichen Entwicklungspolitik stellen sich auch Aufgaben für das Land Nordrhein-Westfalen, das ebenfalls jährlich einen "Bonner Konvent" mit allen Nord-Süd-Einrichtungen des Landes durchführen und zusätzliche Wissenschaftseinrichtungen wie ein Institut für Menschenrechte und vielleicht in Absprache mit Rheinland-Pfalz eine Zentralstelle der DSE für humanitäre Hilfe und Katastrophen-Vorbeugung schaffen sollte.
- Die Säule "nichtstaatliche Entwicklungszusammenarbeit" mit den drei Bereichen:
[Seite der Druckausg.: 9]
- Nicht-Regierungsorganisationen (von den kirchlichen Hilfswerken über kleinere und größere private NROs hin bis zu den privaten Stiftungen und den nicht-staatlichen Organisationen, die die Bundesrepublik für bestimmte entwicklungspolitische Zwecke geschaffen hat, wie den Deutschen Entwicklungsdienst, die Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung und das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik).
- Wissenschaft (mit dem Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn als Kernstück, aber auch außeruniversitäre Einrichtungen wie das Internationale Konversionszentrum in Bonn oder das bereits erwähnte neu zu gründende Bonner Menschenrechtsinstitut),
- Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (Die Umsetzung der lokalen Agenda 21 der UNCED-Konferenz in Rio 1992 könnte durch eine dementsprechende Clearingstelle für kommunale Entwicklungszusammenarbeit unterstützt werden; das Europäische Büro für kommunale Entwicklungszusammenarbeit der Stadt Mainz sollte nach Bonn geholt und vom BMZ finanziert werden, damit es seine Koordinierungsfunktion für die deutschen "Nord-Süd-Zentren" in den Kommunen ausbauen kann).
- Die Säule "europäische, internationale und UN-Einrichtungen" (u.a. die bereits mit Umzugsbeschlüssen nach Bonn versehenen internationalen Einrichtungen wie das UN-Freiwilligen-Programm, oder das Sekretariat der UN-Klima-Rahmenkonvention, aber auch neu anzusiedelnde Institutionen, wie der Ausschuß der Regionen der EU-AdR).
- Die "Dialogsäule" (es wird eine jährliche hochrangige Petersberg-Konferenz zur Entwicklungspolitik vorgeschlagen; außerdem muß Bonn Treffpunkt informeller Kommunikation, ein Ort der Gastfreundschaft und Weltoffenheit bleiben und Gelegenheiten für zwanglose Kontakte in angenehmer Atmosphäre bieten, etwa einen internationalen Club, der UNO-Club heißen könnte. Ein solcher Club könnte Ausstellungen beherbergen und Wegweiser durch die Bonner Institutionen, Mittelpunkt der Besucherbetreuung werden und Angebote wie etwa das von Inter Nationes präsentieren).
- Die "Kultursäule" (das Kulturangebot – von den Museen bis zum "Bonner Sommer" – sollte stärker nord-süd-orientiert ausgerichtet werden, um den Dialog mit den Kulturen und auch Religionen zu intensivieren).
- Die "Mediensäule" (wünschenswert ist sowohl eine bessere Zusammenarbeit als auch ein größeres Gewicht für die Nord-Süd-Redaktionen; Inter Press Service (IPS), Entwicklung und Zusammenarbeit (E+Z) und der entwicklungspolitische Pressedienst der evangelischen Kirche (EPD) sollten in Bonn ansässig werden, um mit den Programmen des Bonner Zentrums eng verbunden zu bleiben. Ebenso ist eine engere Kooperation mit den "One World Broadcaster", der Rundfunkanstalten und dem "Dritte-Welt-Journalistennetz" anzustreben).
Die Studie enthält zahlreiche weitere Vorschläge und betont die Notwendigkeit, insbesondere mit den entwicklungspolitischen Einrichtungen in Ostdeutschland, in Mittel- und Osteuropa Kontakt zu pflegen, was bei der finanziellen Lage besonders der NRO in Ostdeutschland wohl nur durch einen Reisefonds und institutionalisierte Unterbringungsmöglichkeiten in Bonn möglich ist.
Ein qualifiziertes Angebot an Informationen und Dokumentation für das Nord-Süd-Zentrum Bonn und den Verbund der in Bonn angesiedelten Institutionen ist unerläßlich. Die zentrale Dokumentation der DSE in Bonn sollte mit anderen in Bonn befindlichen Informationsstellen vernetzt werden, um mit elektronischer Datenverarbeitung offen für alle Nutzer in Nord und Süd sein zu können.
Zur Förderung der entwicklungspolitischen Bildung sollte die Koordinierungsstelle Nord-Süd im Bildungsbereich der Bundesländer von Wiesbaden nach Bonn verlegt werden und die Zusammenarbeit zwischen BMZ, der Kultusministerkonferenz und den NRO sollte intensiver werden. Für die Bonner Schulen sollte ein "entwicklungspolitisches Informationszentrum" (EPIZ) nach dem Vorbild Berlins geschaffen werden; es sollte auch der Jugendarbeit und Erwachsenenbildung in Bonn mit Darlehen und Fachleuten zur Seite stehen.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 2002