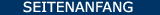![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

Nach dem Sturz der Taliban : kein Frieden von Kabul bis Kaschmir / Michael Lüders - [Electronic ed.] - Bonn, 2003 - 15 S. = 55 KB, . - (Frieden und Sicherheit)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
© Friedrich-Ebert-Stiftung
[Seite der Druckausg.: Titelblatt]
Michael Lüders
Nach dem Sturz der Taliban
Kein Frieden von Kabul bis Kaschmir
März 2003
Nach Beginn der amerikanischen Bombenangriffe auf
Afghanistan am 7. Oktober 2001 wurden die Taliban innerhalb
weniger Wochen besiegt und von der Macht vertrieben.
Ihr Führer Mullah Omar musste ebenso fliehen wie Osama bin Laden.
Aber die Taliban erstarken wieder und Afghanistan steht erneut am Rande
eines Bürgerkriegs.
Unterdessen wächst in Pakistan eine noch größere Gefahr heran.
[Seite der Druckausg.: 1]
Seit dem Abzug der Sowjets 1989 wurde Afghanistan heimgesucht von Milizen- und Clankämpfen, häufig entlang ethnischer und religiöser Trennungslinien. Im September 1994 traten die Taliban ihren Siegeszug an. Zwei Jahre später eroberten sie die Hauptstadt Kabul, auf dem Höhepunkt ihrer Macht kontrollierten sie 90 Prozent des Landes. Die Taliban versprachen Frieden, ein Ende der Milizenherrschaft und eine gerechte soziale Ordnung. Die Bevölkerung glaubte ihnen, vor allem auf dem Land. Doch ihre soziale Basis hatten und haben sie hauptsächlich unter den bis zu vier Millionen afghanischen Flüchtlingen in Pakistan, als ideologische Schaltstellen dienen die religiösen Hochschulen, die Madrasas. Daher auch ihr Name: Taliban bedeutet, wörtlich übersetzt, „Religionsstudenten„. Allerdings rekrutieren sich die Taliban fast ausschließlich aus der Volksgruppe der Paschtunen, die in Afghanistan die Mehrheit stellen. Die Taliban versuchten, das Land unter paschtunischer Vorherrschaft zu einen und scheiterten an ihrer rückständigen Stammesideologie, die sie als „islamisch„ ausgaben. Zwar gelang es ihnen tatsächlich, Anarchie und Chaos zu beenden und das Banditentum in ihrem Machtbereich zu unterbinden. Jenseits von Repression aber entwickelten sie keine politische Vision.
Entgegen der in westlichen Medien und in der Politik vorherrschenden Auffassung verdankt sich die erstaunlich schnelle Niederlage der Taliban nur zum Teil amerikanischen Bomben, auch nicht unbedingt dem „Volkswillen„, dem Haß der ethnischen und religiösen Minderheiten sowie der städtischen Bevölkerung auf ihre jahrelange Schreckensherrschaft. Ausschlaggebend war vielmehr eine der wenigen Konstanten im afghanischen Endloskrieg, der 1979 mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen begann: der Wechsel lokaler Kommandeure auf die Seite der jeweiligen Sieger, gegen gute Bezahlung und klare Versprechen. Nicht anders waren zuvor die Taliban an die Macht gelangt, militärisch und finanziell unterstützt vom pakistanischen Inlandsgeheimdienst ISI. Eine Faustregel besagt, daß die „Eroberung„ einer afghanischen Provinz etwa eine Million Dollar kostet. Der Usbekengeneral Abdul Rashid Dostum soll von den Amerikanern gar 250 Millionen Dollar erhalten haben, für seine (wiederholt mörderischen) Verdienste im Kampf gegen die Taliban. Die Milizionäre „aufgekaufter„ Kriegsgegner haben in der Regel nichts zu befürchten und können in ihre Heimatdörfer zurückkehren.
Zu den am meisten von den Taliban heimgesuchten Bevölkerungsgruppen gehörten, neben den Minderheiten, die afghanischen Frauen. Doch die bei uns vorherrschende Auffassung, mit dem Sturz der Taliban seien die Frauen „befreit„ und sähen einer glänzenden Zukunft entgegen, ist schlichtweg absurd. Paschtunisches Stammesdenken verbannt Frauen seit Jahrhunderten aus der Öffentlichkeit und zwingt sie unter einen Ganzkörperschleier. Die Taliban haben die Entrechtung der Frau in den Rang einer
[Seite der Druckausg.: 2]
Ideologie erhoben, nicht jedoch „erfunden„. Deswegen wagen bis heute nur wenige Frauen, die Burqa abzulegen, selbst in Kabul. Auf dem Land ist daran ohnehin nicht zu denken. Auch in Pakistan sind paschtunische Frauen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, außer Haus grundsätzlich verschleiert und haben kaum die Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen. Stammestraditionen zu überwinden braucht Zeit und Geduld. Der afghanische König Amanullah hat in den zwanziger Jahren, inspiriert von den weitreichenden Reformen Atatürks, lokalen Herrschern Geld gegeben, Bestechungsgeld, damit die Mädchen in ihrem Einflußbereich zur Schule gehen dürfen. Die Herrscher haben das Geld dankend angenommen, die Schulen allerdings blieben den Mädchen noch Jahrzehnte versperrt.
Die Schwäche des Karzai-Regimes
Für ihren Sieg in Afghanistan benötigten die Amerikaner Bodentruppen. Aus diesem Grund verbündete sich Washington mit der größten Oppositionsgruppe im Land, der Nordallianz. Die Nordallianz war zunächst ein Zweckbündnis der nichtpaschtunischen Minderheiten, vor allem der Tadschiken und Usbeken, das nur ein einziges Ziel verfolgte: Die Taliban um jeden Preis zu stürzen. Die politischen und militärischen Führer der Nordallianz sind allerdings mitverantwortlich für die Zerstörung Afghanistans und den Taliban an Menschenverachtung ebenbürtig. Um beim Beispiel der Frauen zu bleiben: die in Pakistan ansässige afghanische Frauengruppe Rawa berichtete, im Herrschaftsbereich der Nordallianz würden Frauen genauso entrechtet wie unter den Taliban, inklusive Zwangsheirat, Vergewaltigungen und der Steinigung von Ehebrecherinnen. Davon war bei uns allerdings wenig zu erfahren - es paßte nicht so recht ins politische Bild. Denn nach der Niederlage der Taliban, der Gastgeber von Al-Qa’ida und Osama bin Laden, übernahm die Nordallianz die Macht in Afghanistan. Mit ihrem Einmarsch in Kabul am 13. November 2001 hatten die tadschikischen und usbekischen Kriegsherren vollendete Tatsachen geschaffen, die von Washington und der Anti-Terror-Koalition anerkannt wurden – auch aus Mangel an Alternativen.
Den Grundstein für die Neuordnung des Landes legte das unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen am 5. Dezember 2001 auf dem Petersberg bei Bonn unterzeichnete Afghanistan-Abkommen. Seither gibt es, zum ersten Mal seit dem sowjetischen Einmarsch, eine international legitimierte Regierung in Kabul. Sie blieb zunächst für sechst Monate im Amt. Im Juni 2002 wurde eine Sonder-Loya-Jirga, die traditionelle Stammesversammlung der Afghanen, einberufen. Sie hatte die Aufgabe, „über eine Übergangsverwaltung zu entscheiden, einschließlich einer breiten Übergangsregierung, damit diese Afghanistan so lange führt, wie eine vollständige repräsentative Regierung in freien und geheimen Wahlen gewählt werden kann, die spätestens zwei Jahre nach dem Datum der Zusammenkunft der Sonder-Loya-Jirga stattfinden müssen„, also im Juni 2004 (Paragraph eins, Absatz vier des Abkommens).
[Seite der Druckausg.: 3]
Soweit die Theorie, die in der Praxis allerdings nicht funktioniert. Schon auf dem Petersberg ließ die Nordallianz, die sich seit ihrem Sieg „Vereinigte Front„ nennt, keinerlei Zweifel, daß sie die Macht für sich allein beansprucht und nicht gewillt ist, sie mit den Paschtunen, der Bevölkerungsmehrheit, zu teilen. In der Übergangsregierung, die bis zur Sonder-Loya-Jirga amtierte, hatte die Nordallianz 17 Ministerposten, die Paschtunen, auf dem Petersberg überwiegend von Exilanten vertreten, lediglich 11. Vor allem die Tadschiken, die höchstens ein Viertel der Bevölkerung stellen, waren überdurchschnittlich präsent; sie besetzten die Schlüsselressorts Außen, Innen und Verteidigung. Die erheblich manipulierte Sonder-Loya-Jirga bestätigte diese Dominanz der Tadschiken, die sich seither als die alleinigen Machthaber im Land aufführen. Genauer gesagt handelt es sich um eine kleine Gruppe tadschikischer Clanchefs und Milizenführer aus dem Pandschirtal nordöstlich von Kabul. Auf die Verhältnisse der Europäischen Union übertragen wäre das ungefähr so, als würden einige Dutzend Drogenhändler und Waffenschieber etwa aus dem Kleinwalsertal die Kontrolle über Politik und Wirtschaft Europas übernehmen. Auch in Afghanistan kann ein solches Modell nicht funktionieren. In der modernen Geschichte des Landes hat es seit 1747, seit der Staatsgründung, nur ein einziges Mal und nur für kurze Zeit einen Machthaber, einen König, gegeben, der nicht Paschtune war – und der, ein Tadschike, wurde ermordet.
Die Amerikaner waren sich dieses Dilemmas durchaus bewußt. Die Paschtunen in Afghanistan hatten die Taliban unterstützt, aus ihren Reihen wollte man niemanden an der Macht beteiligen. Die einflußreichen Exilpaschtunen in Europa setzten auf den greisen König Zahir Schah, der 1973 gestürzt wurde und seither in Rom lebte. Ein fast 90jähriger Monarch allerdings eignete sich kaum als Symbol für den Neuanfang. Ein Hoffnungsträger mußte her, ein Paschtune, der die Zukunft verkörpert. Washington setzte auf Hamid Karzai und machte ihn zum Präsidenten.
Hamid Karzai, Jahrgang 1957, gehört zu dem einflußreichen Popalzoi – Stamm, wie auch König Zahir Schah. Der in Kabul und Indien ausgebildete Jurist diente den Mudschahidin, den Widerstandskämpfern gegen die sowjetische Besatzung, als politischer Berater und Diplomat. Von 1992 bis 1996, bis zur Machtübernahme der Taliban in Kabul, vertrat er seinen Stamm als stellvertretender Außenminister der Mudschahidin-Regierung. Die gestürzten Mudschahidin bildeten anschließend das Rückgrat der Nordallianz. Von den Taliban erhielt Karzai das Angebot, Afghanistan bei den Vereinten Nationen zu vertreten. Er lehnte ab. Auch deswegen, „weil die Taliban Arabern und anderen Ausländern erlaubten, terroristische Ausbildungslager in Afghanistan einzurichten„, erklärte Karzai in einem Interview. „Spätestens 1997 war den meisten Afghanen klar, daß Osama bin Laden eine führende Rolle unter den Taliban spielte. Ich habe die Amerikaner mehrfach vor den Gefahren gewarnt, die von dieser Entwicklung ausgehen, aber niemand hat auf mich gehört.„
Karzai, der fließend Englisch spricht und westliche Einflüsse in Afghanistan als Gegengewicht zu Stammesdenken und dem zerstörerischen Einfluß von Milizen und
[Seite der Druckausg.: 4]
Kriegsherren ansieht, unterhält seit den achtziger Jahren gute Beziehungen in die Vereinigten Staaten, zunächst über die amerikanische Botschaft in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans. 1996 ging er für einige Monate in die USA, auf Einladung der kalifornischen Ölgesellschaft UNOCAL, für die er anschließend als Berater tätig war. UNOCAL versuchte zwei Jahre lang, von den Taliban den Auftrag für den Bau einer Erdgas-Pipeline aus Turkmenistan über Afghanistan nach Pakistan zu erhalten. Im Sommer 1998 jedoch erteilten die Taliban einer argentinischen Ölgesellschaft den Zuschlag. Nur am Rande sei vermerkt, daß die Dämonisierung der Taliban in den westlichen Medien, ihre Gleichsetzung mit Finsternis und Mittelalter, zeitlich mit dieser Entscheidung zusammenfällt. Waren zuvor hochrangige Delegationen der Taliban in Washington empfangen worden, wurden nun, im August 1998, mehrere Ausbildungslager Osama bin Ladens in Afghanistan bombardiert (als Reaktion auf die Anschläge auf die amerikanischen Botschaften in Kenia und Tansania). Anschließend erging gegen Afghanistan auf amerikanische Initiative ein Handelsembargo der Vereinten Nationen.
Nicht nur Hamid Karzai ist mit UNOCAL liiert. Auch Zalmay Khalilzad, der amerikanische Sondergesandte für Afghanistan und Irak, ist ein ehemaliger Berater von UNOCAL. Und wie das Leben so spielt: im Dezember 2002 erhielt ein amerikanisches Konsortium unter maßgeblicher Beteiligung von UNOCAL (Firmenslogan: Improving people’s lives whereever we work – wir verbessern das Leben der Menschen wo immer wir arbeiten) den Zuschlag für den Bau der besagten Pipeline durch Afghanistan, ein potentielles Milliardengeschäft.
Von seinem Wohnsitz in Quetta aus, in Pakistan, organisierte Hamid Karsai ab 1998 den Widerstand gegen die Taliban. Unterstützung fand er insbesondere unter paschtunischen Stammesführern, die den politischen Einfluß Osama bin Ladens und seiner etwa 3000 arabischen Anhänger auf die Entwicklung in Afghanistan ablehnten. Die Taliban reagierten, indem sie 1999 Hamid Karsais Vater ermordeten, den Stammesführer der Popalzai. Hamid Karzai wurde daraufhin dessen Nachfolger. Nach dem 11. September begann er, innerhalb Afghanistans eine Anti-Taliban-Miliz unter den Paschtunen aufzubauen, die von den Amerikanern zunächst ignoriert wurde. Sie wollten Pakistan nicht verärgern, den Mentor der Taliban. Erst Anfang November 2001, einen Monat nach Beginn der Bombenangriffe auf Afghanistan, beschloß Washington, namentlich das Pentagon, politisch auf Hamid Karzai zu setzen. Es folgte eine Blitzkarriere: vier Wochen später wurde er auf dem Petersberg zum Präsidenten berufen.
Die Sonder-Loya-Jirga, die im Juni 2002 in Kabul stattfand, sollte der Übergangsregierung eine breitere demokratische Legitimation verschaffen und die Weichen in Richtung gesellschaftliche Pluralität stellen. Die Arbeit der neuen Regierung war jedoch schon in den ersten sechs Monaten nach dem Afghanistan-Abkommen geprägt von Willkür, Unsicherheit und Instabilität. Politische Gegner wurden wie in der Vergangenheit unter Druck gesetzt, verfolgt oder ermordet. Eine Öffnung der
[Seite der Druckausg.: 5]
afghanischen Gesellschaft fand nicht statt. Nur die Anwesenheit der ebenfalls auf dem Petersberg vereinbarten Internationalen Schutztruppe (ISAF) in Kabul und der amerikanischen Einheiten zur Bekämpfung des Terrorismus verhinderten zunächst einen Rückfall in den Bürgerkrieg, in Verhältnisse wie in den Jahren 1992 bis 1996, als die Nordallianz schon einmal an der Macht war, damals noch unter der Bezeichnung Mudschahidin, und das Land ins Chaos stürzte.
Gewiß gibt es keine Patentrezepte, um Afghanistan zu befrieden. Aber die Vorherrschaft der Nordallianz auf Kosten der Paschtunen, mit Ausnahme der Symbolfigur Hamid Karzai, ist der maßgebliche Konstruktionsfehler der politischen Neuordnung, der in nicht allzu ferner Zukunft zu ihrem Zusammenbruch führen dürfte. Vorbereitung und Durchführung der Sonder-Loya-Jirga waren demzufolge geprägt von Machtmißbrauch und Repression. Die mehr als 1500 Delegierten sollten eigentlich in ihren Heimatregionen gewählt werden. In Wirklichkeit entschied entweder die Übergangsregierung, welche Delegierten entsandt wurden, oder aber lokale Kriegsherren und Gouverneure, die nicht notwendigerweise den Machthabern in Kabul zuzuordnen waren. Bestechung spielte dabei ebenso eine Rolle wie Einschüchterung oder die Ermordung von mißliebigen Kandidaten. Unabhängige oder demokratische Kräfte hatten keine Chance. Die Vereinten Nationen, vor Ort vertreten durch ihren Sonderbotschafter Lakhdar Brahimi, ein ehemaliger Außenminister Algeriens, setzten dieser Entwicklung keinen Widerstand entgegen, im Gegenteil: sie erteilten allen Gouverneuren und den wichtigsten Kriegsherren die Erlaubnis, ungewählt an der Sonder-Loya-Jirga teilzunehmen. Im Gegenzug hatten sie dafür zu sorgen, daß Hamid Karzai als Regierungschef im Amt bestätigt wurde. Danach sah es zunächst nicht aus. Eine große Zahl vor allem paschtunischer Delegierter wollte lieber König Zahir Schah in dieser Funktion sehen. Erst massiver Druck der Vereinten Nationen und Washingtons sorgten dafür, daß der König auf seine politischen Ambitionen verzichtete und zur Wahl Karzais aufrief.
Seit der Sonder-Loya-Jirga ist die Lage in Afghanistan gefährlich instabil und explosiv. Hamid Karzai hat seine Chance verspielt, Politik aktiv zu gestalten und über ethnische Grenzen hinweg nach Bündnispartnern außerhalb der Nordallianz zu suchen. Stattdessen hat er sich vollständig in die Hände der Tadschiken aus dem Pandschirtal begeben, namentlich der Troika aus Verteidigungsminister Mohammed Fahim, Innenminister Junis Qanuni sowie Außenminister Abdallah Abdallah. Ihre Machtfülle hat in der erweiterten Übergangsregierung noch zugenommen, weil in der Verwaltung und in den Ministerien vornehmlich ihre Gefolgsleute sitzen. Die Folge sind Korruption und Vetternwirtschaft. Ungeachtet der zugesagten internationalen Wiederaufbauhilfe in Milliardenhöhe – allein die Bundesregierung hat 500 Millionen Euro bereitgestellt, verteilt auf fünf Jahre – war die Regierung in Kabul bislang unwillig oder außerstande, ein Konzept für den Wiederaufbau vorzulegen, insbesondere mit Blick auf die Armutsbekämpfung. Ausländische Hilfsorganisationen werfen den Machthabern vor, Geld zu unterschlagen und auf eigene Konten umzuleiten.
[Seite der Druckausg.: 6]
In der westlichen Politik und den Medien ist Hamid Karzai außerordentlich beliebt und angesehen, in Afghanistan dagegen genießt er nur wenig Sympathien. Schlimmer noch, er verfügt über keinerlei eigene Machtbasis. Aus der Sicht der Nordallianz ist er lediglich ein „nützlicher Idiot„, der das Anti-Terror-Bündnis zufriedenstellt und dafür sorgt, daß der Geldstrom aus den westlichen Geberländern nicht versiegt. Die Paschtunen fühlen sich von der Übergangsregierung nicht vertreten, sogar sein eigener Stamm geht auf Distanz zu Kabul. Ein Attentat im September 2002 überlebte Hamid Karzai nur dank seiner 50 amerikanischen Leibwächter. Nachhaltiger wäre die eigene Ohnmacht kaum zu dokumentieren gewesen – ein Staatschef, der sein Leben und sein Amt den Vereinigten Staaten verdankt.
Die Kriegsherren
Nach der Sonder-Loya-Jirga wandten sich zahlreiche Gouverneure aus den Grenzprovinzen zu Iran und Pakistan von der Übergangsregierung ab und machten ihre jeweiligen Herrschaftsgebiete zu einem Staat im Staate. Angebote Karzais, Minister in Kabul zu werden, lehnten sie angesichts der Allgewalt der Tadschiken aus dem Pandschirtal ab. Das gilt für den Usbekenführer Abdul Rashid Dostum im Norden ebenso wie für den einflußreichen Kriegsherren und Gouverneur von Herat, Ismail Khan, im Westen. Lediglich Hadschi Qadir, der starke Mann im Osten Afghanistans, nahm das Amt des stellvertretenden Präsidenten an. Im Juli 2002 wurde der Paschtune ermordet – die Spuren weisen ähnlich wie bei der Ermordung des Luftfahrt- und Tourismusministers einige Monate zuvor direkt zu den Pandschiris.
Ismail Khan, ein Tadschike, hat in der Provinz um die Stadt Herat, entlang der iranischen Grenze, sein vortalibanisches Fürstentum wiederhergestellt. Der einstige Mudschahidin-Führer hatte schon vor der Eroberung der Provinz durch die Studentenkrieger 1995 einige Jahre lang die gesamte Region beherrscht. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat in einem im November 2002 veröffentlichten Bericht schwere Vorwürfe gegen den Gouverneur erhoben. Der „Emir„, wie sich Ismail Khan selbst nennt, sei persönlich für die systematische Verfolgung von Angehörigen der paschtunischen Minderheit und Andersdenkenden verantwortlich. Politische Gegner würden verhaftet und gefoltert, ein Recht auf freie Meinungsäußerung gebe es nicht. Genau am Jahrestag der Vertreibung der Taliban aus Kabul, am 13. November 2002, führte Ismail Khan die strikten Taliban-Regeln wieder in Herat ein und verbot Hochzeitsfeiern mit Musik und Tanz, auch bei privaten Feiern. In der Öffentlichkeit dürfen Männer und Frauen nicht miteinander reden. Bildungsangebote für Frauen wurden eingeschränkt. Dessen ungeachtet besuchte der amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im September 2002 Herat und pries Ismail Khan als einen „Mann des Friedens„.
[Seite der Druckausg.: 7]
Dieses Beispiel zeigt, wie beliebig und willkürlich die Unterscheidung von „gut„ und „böse„ in Afghanistan ist. Folgt man der politischen und medialen Rhetorik nach dem 11. September, so waren die Taliban ein Synonym für Menschenverachtung schlechthin, gewissermaßen eine afghanische Pol Pot-Variante. Machtpolitik wurde verklärt als menschliche Mission - der Sturz der Taliban war nicht allein ein Sieg über ein grausames, unfähiges Regime, vielmehr Ausdruck eines Selbstbehauptungswillens westlicher Zivilisation schlechthin. Ein Sieg der Freiheit über den Fanatismus. Kaum waren die Taliban geschlagen, empfahlen amerikanische Kommentatoren auch schon die Ausweitung des Anti-Terror-Krieges auf andere Ziele in der Region, damit auch die Menschen in Bagdad und Basra wieder lächeln, so wie die Frauen in Afghanistan: to put a smile on their face, wie es in der International Herald Tribune hieß.
Erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit solche Propaganda verfängt. Ismail Khan ist ein Beleg dafür, daß in Afghanistan – wie auch im Irak nach Saddam Hussein – nicht die westlichen Lippenbekenntnisse für Demokratie und Menschenrechte von Bedeutung sind, sondern machtpolitische Erwägungen. Eine im Grunde banale Einsicht, die aber hierzulande kaum jemand wahrhaben will, insbesondere nicht die Anhänger der These vom „Kampf der Kulturen„. Ihnen geht es um Ideologie, die Realität blenden sie aus. Und die Realität ist nicht minder banal: Ismail Khan mag durchaus ein Regime einführen wie vor ihm die Taliban. Das allerdings ist ohne Bedeutung. Wichtig ist allein, daß er auf Seiten der Anti-Terror-Koalition steht. Da die Amerikaner den iranischen Einfluß im Westen Afghanistans begrenzen wollen, machten sie Ismail Khan zu ihrem Verbündeten und versorgen ihn mit Waffen und Geld, bislang angeblich 70 Millionen Dollar. Selbstredend ist der Kriegsherr nicht loyal und spielt Iraner und Amerikaner gegenseitig aus, um seinen Preis zu erhöhen. Gleichzeitig unterläuft und schwächt er die Zentralregierung. Eigenmächtig hat Ismail Khan die Posten bei den Zoll- und Finanzbehörden besetzt und die aus Kabul entsandten Beamten zurückgeschickt. Herat war schon immer eine der wichtigsten Handelsstädte in Zentralasien - ein Großteil der Importe Afghanistans aus der Golfregion erfolgt über die iranische Grenze und somit über das nahegelegene Herat. Die Zolleinnahmen sollen bei monatlich zwei Millionen Dollar liegen.
Selbstherrliche Gouverneure und Kriegsherren gibt es viele in Afghanistan. Da sie vorwiegend ihren eigenen Geschäfte nachgehen, reicht der Einfluß der Zentralregierung kaum über die Hauptstadt hinaus. Die Entscheidung der Europäer, die 5000 Soldaten der von ihnen gestellten Internationalen Schutztruppe (ISAF) ausschließlich in Kabul zu stationieren und ihren Einsatz auf die Hauptstadt zu beschränken, mag unter Kosten- und Sicherheitsaspekten (für die Truppe) sinnvoll gewesen sein. Politisch war es das falsche Signal. Jeder Stammesführer wußte nun, daß er nichts zu befürchten hat, solange er nicht Sympathien für die Taliban oder Al-Qa’ida erkennen läßt. Die Entwaffnung der regionalen Machthaber wurde weder auf dem Petersberg noch in der Zeit danach ernsthaft angestrebt. Auch deswegen nicht, weil die Amerikaner sie als Verbündete im Kampf gegen den Terror ansehen. Die Alternative wäre gewesen, eine nationale
[Seite der Druckausg.: 8]
afghanische Armee aufzubauen und die Zentralmacht auf Kosten der Regionen zu stärken. Dazu wird es nicht mehr kommen, weil die Akteure vor Ort zu mächtig geworden sind. Zum Schaden des Landes ziehen Europäer und Amerikaner in Afghanistan nicht an einem Strang, was die Anti-Terror-Koalition naturgemäß schwächt. Während die Europäer versuchen, die Sicherheitslage in Kabul zu verbessern und damit den Wiederaufbau voranzutreiben, zeigen die Amerikaner nur wenig Neigung, sich am nation-building zu beteiligen, der Schaffung von politischen und wirtschaftlichen Grundlagen für ein lebensfähiges Staatswesen. Ihre Priorität liegt eindeutig bei der Terrorbekämpfung. Die dafür benötigten Militärbasen liegen in Kandahar, im Südosten Afghanistans, in Bagram bei Kabul, in Pakistan, Usbekistan und Kirgistan.
Die Taliban kehren zurück
Ein Jahr nach dem Sturz der Taliban, nach aufwendigen Militäraktionen gegen radikale Islamisten in Afghanistan und rund um den Globus, fällte der CIA-Direktor George Tenet im November 2002 ein vernichtendes Urteil über die erzielten Ergebnisse: „Die Gefahr, die von Al-Qa’ida und den mit ihnen verbündeten Dschihad-Gruppen ausgeht, ist noch immer so groß wie vor dem 11. September. Sie haben sich neu konstituiert, und sie sind hinter uns her.„ Der Weltmacht USA gelingt es trotz ihrer Feuerkraft nicht, das eigentliche Kriegsziel zu erreichen: die vollständige Zerstörung der Infrastruktur von Al-Qa’ida und der Taliban, einschließlich der Verhaftung oder Liquidierung ihres Führers Mullah Omar und von Osama bin Laden. Nüchtern besehen hat Washington den Krieg gegen den Terror, der ursprünglich den Codenamen „Grenzenlose Gerechtigkeit„ trug, dann in „Grenzenlose Freiheit„ umbenannt wurde, bereits in Afghanistan verloren – lange bevor er, unter anderen Vorzeichen, in den Irak getragen wurde. Dafür gibt es im wesentlichen zwei Gründe.
Zum einen ist der islamistische Terror mit militärischen Mitteln allein nicht zu besiegen. Ungeachtet seiner Menschenverachtung und nebulösen Ideologie verfügt dieser Terror über einen gesellschaftlichen Nährboden, der mit Bomben nicht aus der Welt zu schaffen ist. Die extreme Armut in Ländern wie Afghanistan und Pakistan gehört ebenso dazu wie die Ablehnung westlicher Hegemonie in Politik, Wirtschaft und Alltagskultur der arabisch-islamischen Welt insgesamt. Da der Krieg gegen den Terror ein Krieg zur Durchsetzung geopolitischer Interessen Washingtons im Nahen und Mittleren Osten geworden ist, erhalten radikale Islamisten verstärkt Zulauf, gewinnt die „asymmetrische Kriegsführung„ an Gewicht: Kalaschnikov-Kämpfer, Guerilleros und Selbstmord-Attentäter, die einer hochgerüsteten Hi-Tech-Armee entgegentreten oder weltweit Terroranschläge verüben. Auch gemäßigte und liberale Kreise in der arabisch-islamischen Welt wenden sich zunehmend vom Westen ab, resignieren angesichts der Kurzsichtigkeit westlicher Politik, die Demokratie sagt und Erdöl meint.
[Seite der Druckausg.: 9]
„Im Laufe des vorigen Jahres haben die USA Pakistan und die Diktaturen Zentralasiens bewaffnet und hofiert, Putins anhaltende Zerstörung Tschetscheniens gebilligt, den Irak auch weiterhin bombardiert und eine Wirtschaftsblockade mit verheerenden Folgen aufrechterhalten. Sie haben neue Militärbasen in der gesamten islamischen Welt eingerichtet und ohne jeden Skrupel Ariel Scharons blutige Zerstörungswellen in den palästinensischen Gebieten vorbehaltlos gebilligt und gerechtfertigt,„ kommentiert die Londoner Tageszeitung The Guardian am 21. November 2002. Zweifellos das beste Rezept für ein Desaster.
Und zum anderen ist es die Lage in Afghanistan selbst, die insbesondere den Taliban, weniger Al-Qa’ida, beständig neue Anhänger verschafft. Die Macht in Kabul liegt wie erwähnt in den Händen der Nordallianz, der Tadschiken aus dem Pandschirtal, die ihr Geld, nebenbei bemerkt, vor allem mit der Kontrolle des Drogenhandels nach Europa verdienen, soweit er über die Transitrouten in Tadschikistan und Usbekistan verläuft. Unter den Taliban wurde der Anbau von Rohopium im Juli 2000 verboten, der Handel kam weitgehend zum Erliegen. 2002 wurden in Afghanistan fast 3400 Tonnen Rohopium produziert. Das entspricht 80 Prozent des in Europa konsumierten Heroins, bei einem Umsatz von etwa einer Milliarde Euro. Da die Amerikaner die Macht in den Provinzen denselben Kriegsverbrechern überließen, die das Land bereits Anfang der neunziger Jahre verwüstet hatten, setzte sich der staatliche Zerfall Afghanistans zwangsläufig fort. Außerhalb Kabuls herrscht dieselbe Anarchie und Gesetzlosigkeit, die zu beseitigen die Taliban 1994 erfolgreich angetreten waren. Aller Aufbruchstimmung in der Hauptstadt zum Trotz: unter den Taliban war die Sicherheitslage deutlich besser als im Zeichen der Anti-Terror-Koalition. Nicht einmal die wichtigste Straßenverbindung, die Strecke von Kabul nach Pakistan über den Khyber-Paß, ist gegenwärtig sicher. Reisende riskieren, von bewaffneten Banden ausgeraubt oder entführt zu werden. Welchen Schluß wird der einfache und ungebildete Afghane daraus ziehen?
Eine konstruktive Politik in Afghanistan kann nur bedeuten, den Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Stämmen, Clanen und Ethnien zu organisieren. Die Minderheit der Tadschiken über die Mehrheit der Paschtunen zu stellen führt unausweichlich zu einer Neuauflage des Bürgerkrieges. An diesem Punkt befindet sich Afghanistan heute. Da die Paschtunen von der Übergangsregierung nichts zu erwarten haben und die regelmäßigen amerikanischen Militäraktionen in ihren Stammesgebieten, bei denen selten Terroristen, aber wiederholt Zivilisten getötet wurden, als Provokation und Demütigung empfinden, erlebten die Taliban ein Comeback. Es gelang ihnen, das politische Vakuum im Siedlungsgürtel der Paschtunen, im Süden und Osten Afghanistans, zumindest teilweise zu füllen. Unterstützung erhalten sie gleichermaßen von Stämmen, die das Regime in Kabul ablehnen, wie auch von lokalen Herrschern, die zuvor gegen die Taliban eingestellt waren, wegen ihrer Liaison mit Al-Qa’ida. Da die letzten Taliban-Kämpfer, bedrängt von militärischen Vorstößen der Amerikaner und der Nordallianz, Anfang 2002 nach Pakistan geflohen oder untergetaucht waren und es anschließend nur noch zu vereinzelten und folgenlosen Angriffen auf die Anti-Terror-
[Seite der Druckausg.: 10]
Koalition kam, ging man in Washington zunächst davon aus, das Taliban und Al-Qa’ida-Netzwerk in Afghanistan zerstört zu haben.
Das war ein Irrtum. Der entscheidende Wendepunkt war die Rückkehr Gulbuddin Hekmatyars aus seinem iranischen Exil nach Afghanistan, im Juni 2002. Der Paschtune Hekmatyar, vor 1992 Premierminister, gilt als einer der skrupellosesten Kriegsherren Afghanistans. Der von ihm angeordnete Dauerbeschuß Kabuls mit Raketen und Artillerie 1994 soll 25 000 Zivilisten das Leben gekostet haben. Als einer der einflußreichsten Mudschahidin-Führer und Gründer der radikalen „Islamischen Partei Afghanistans„ erhielt er von den Amerikanern in den achtziger Jahren modernste Waffen, darunter Stinger-Raketen, die er später Al-Qa’ida verkaufte, sowie mehrere hundert Millionen Dollar für den Kampf gegen die Sowjetunion – die Grundlage seiner heutigen Macht. Und ein Beispiel dafür, wie amerikanische Politik nicht nur in Afghanistan auf fragwürdige Verbündete setzt, deren Gewaltpotential sich jederzeit gegen den Mentor selbst entladen kann, in Form von Terror.
Am 10. August 2002 veröffentliche Ummat, die auflagenstärkste Zeitung Pakistans, eine Titelgeschichte aus Asadabad, der Provinzhauptstadt Kunars. Kunar liegt nordöstlich von Kabul und Dschalalabad und grenzt an Pakistan, ein entlegenes und schwer zugängliches Hochgebirge, das die Amerikaner nur unter Einsatz von Bodentruppen erobern könnten. Demzufolge ist Osama bin Laden nach einem längeren Aufenthalt in der pakistanischen North West Frontier Province nach Kunar gegangen, zusammen mit den Führungskadern von Al-Qa’ida. Auch Mullah Omar und Hekmatyar sollen sich dort aufhalten. „Die Amerikaner wissen das natürlich„, schreibt Ummat. „Aber was sollen sie tun. Die Provinz ist tief religiös, ultra-konservativ und 100 Prozent pro-Taliban.„ Die militärische und terroristische Schlagkraft dieser neuen Guerilla-Koalition ist nicht zu unterschätzen, zumal sie über beträchtliche Waffenlager und Finanzmittel verfügt. Im Juni 2002 verkündete Hekmatyar eine Fatwa gegen die amerikanischen Truppen in Afghanistan und Pakistan und rief auf zum „erneuten Dschihad gegen die fremden Eindringlinge„. Gleichzeitig gelang es den Milizen seiner „Islamischen Partei„, den Osten Afghanistans in weiten Teilen unter ihre Kontrolle zu bringen. Vor allem nehmen sie Einfluß auf die lokale Verwaltung, einschließlich der Polizei und der rudimentären afghanischen Armee. Offenbar hat Hekmatyar die Taliban in die Rolle eines Juniorpartners gedrängt, was allerdings auf Dauer nicht so bleiben muß.
Gleichzeitig nahm die Intensität der Anschläge und Überfälle auf die Anti-Terror-Koalition und die Nordallianz in der zweiten Hälfte des Jahres 2002 stetig zu. Große Schäden verursachten sie nicht, doch sind es die Vorboten eines erneuten Krieges. Im Januar 2003 tauchten in der pakistanischen Grenzstadt Peshawar erstmals Flugblätter einer bislang unbekannten Gruppe auf, die sich „Geheime Armee islamischer Mudschahidin„ nennt. Sie erklärte, für 50 Angriffe auf amerikanische Soldaten und ihre Verbündeten verantwortlich zu sein, darunter eine Bombenexplosion unweit der amerikanischen Botschaft in Kabul und ein Raketenangriff auf das Hauptquartier der
[Seite der Druckausg.: 11]
ISAF. Mit Hilfe solcher Flugblätter, im Volksmund „nächtliche Mitteilungen„ genannt, aber auch mit Propaganda-Kassetten und Radiosendungen aus dem Untergrund wollen Hekmatyar und die Taliban die anti-amerikanische Stimmung in der Bevölkerung für ihre Zwecke nutzen und sie für eine Revolte gegen die 8000 amerikanischen Soldaten in Afghanistan gewinnen. Auffallend ist, daß die Führer von Al-Qa’ida sich an diesem „Dschihad„ offenbar nicht beteiligen. Sie unterstützen ihn ideologisch und wahrscheinlich auch finanziell, doch sie sind nicht bereit, sich auf inner-afghanische Kämpfe einzulassen. Für Osama bin Laden und die Seinen sind die entlegenen Bergregionen Afghanistans lediglich ein Rückzugsgebiet, nicht die Basis für weitere Operationen.
Washington wiederum hat erkannt, daß die Politik der reinen Terrorbekämpfung zu kurz greift. Seit Ende 2002 engagieren sich amerikanische Soldaten auch im humanitären Bereich, helfen etwa bei der Rückführung von Flüchtlingen. Von einigen Gouverneuren und Milizführern haben sich die Amerikaner distanziert, und sie üben Druck auf die tadschikische Führungs-Troika aus, den Aufbau einer nationalen Armee nicht länger zu sabotieren. Doch dieser halbherzige Kurswechsel kommt zu spät. Seit dem Krieg gegen Bagdad ist Afghanistan ohnehin keine Prioriät amerikanischer Politik mehr, während gleichzeitig der Haß auf Amerika im Land zunimmt, wie überall in der arabisch-islamischen Welt.
Die pakistanische Gefahr
Die Entwicklung in Afghanistan zeigt, daß der Einsatz militärischer Gewalt neue Probleme schafft, die noch sehr viel gefährlicher und unberechenbarer sein können als die alten. Wie in einer kommunizierenden Röhre sind politische Allianzen, Akteure und Konflikte in der Region miteinander verwoben, und jeder Druck von außen wirkt auf die Kräfteverhältnisse an anderer Stelle. Das gilt insbesondere für Pakistan und sein Verhältnis zu Indien. Paschtunen leben auf beiden Seiten der Grenze, allein deswegen sind die Ereignisse in Afghanistan immer auch ein Teil pakistanischer Innenpolitik. Sie leben vor allem in den schwer zugänglichen Gebirgslandschaften der North West Frontier Province und verdienen ihren Lebensunterhalt seit Jahrhunderten mit Schmuggel. Die Provinz ist autonomes Stammesgebiet und wird nur teilweise von der Zentralregierung in Islamabad kontrolliert. Hier hat der radikale Dschihad-Islam eine seiner Hochburgen, entsprechend haben die Taliban und Al-Qa’ida in der Provinz eine sichere Zuflucht gefunden. Die rund 10.000 religiösen Hochschulen in Pakistan, die Madrasas, sind, wie bereits erwähnt, die wichtigste soziale Basis der Taliban, und sie bieten extremistischen islamischen Gruppen aus dem In- und Ausland, darunter Al-Qa’ida, ein zuverlässiges Netzwerk, ideologisch wie auch organisatorisch.
[Seite der Druckausg.: 12]
Die pakistanischen Regierungen, ob Zivilisten oder Militärs, stehen dieser Entwicklung hilflos gegenüber oder versuchen, sie für ihre Zwecke zu nutzen. Vor allem General Zia ul-Haq (1977 – 1988) förderte aktiv die Islamisierung des Landes und ließ Hunderte von Madrasas errichten, die, mitfinanziert von der CIA, als Waffenlager und Rekrutierungszentren der Mudschahidin im Kampf gegen die sowjetische Besatzung Afghanistans dienten. Auch die pakistanische Militärregierung unter Pervez Musharraf, der nach einem Putsch im Oktober 1999 Premierminister und später Präsident wurde, läßt den Dschihad-Islam im eigenen Land gewähren. Der Grund ist Machtpolitik. Militante islamistische Gruppen führen seit Beginn der neunziger Jahre einen Guerillakrieg in dem von Pakistan und Indien gleichermaßen beanspruchten Kaschmir, aktiv unterstützt vom pakistanischen Militär. Für die Glaubenskämpfer aus Pakistan oder aus den Reihen der Taliban ist Kaschmir eine Heldenfront wie Afghanistan oder Tschetschenien. De facto sind sie willige Vollstrecker, die den Grenzkonflikt mit Indien schüren, ohne daß die Armee offiziell beteiligt wäre. Die Armee, die einzige funktionierende Institution in Pakistan, braucht den Dauerkonflikt mit Indien, um ihre dominante Stellung in Staat und Gesellschaft zu legitimieren. Insgesamt gibt es mehrere tausend Freischärler, darunter auch Araber, Usbeken, Tschetschenen, die im indischen Teil Kaschmirs Terroranschläge verüben oder die indische Armee angreifen. Finanziert werden sie vom pakistanischen Inlandsgeheimdienst ISI.
Nach dem 11. September hat sich Pakistan uneingeschränkt auf die Seite Washingtons gestellt. Auf amerikanischen Druck ließ Islamabad die Taliban fallen, die jahrelang vom ISI unterstützt wurde, auch militärisch. Da die Nordallianz anti-pakistanisch eingestellt ist, hat das Regime Musharraf folglich seinen Hinterhof in Afghanistan eingebüßt. Als Gegenleistung erwartete Islamabad amerikanischen Druck auf Indien in der Kaschmirfrage, der allerdings ausblieb. Mitte Dezember 2001 griffen militante Islamisten aus Pakistan das indische Parlament in Neu-Delhi an; es gab zahlreiche Tote. Die Aktion verstand sich als eine Art „Vorwärtsverteidigung„ nationalistisch gesinnter Militärkreise in Pakistan, um Washington in eine Vermittlerrolle hineinzuzwingen. War schon Kabul verloren, sollte wenigstens das Kaschmir gewonnen werden. Der Schuß ging gewissermaßen nach hinten los: Indien beschuldigte nunmehr Pakistan, den Terrorismus zu fördern, und Präsident Musharraf blieb keine andere Wahl, als die gewaltbereiten Dschihad-Gruppen zu verbieten und etwa 2000 ihrer Aktivisten zu verhaften. Allerdings wurden sie kurz darauf wieder freigelassen, ihre Anführer lediglich unter Hausarrest gestellt. Die Armee ist auf die radikalen Islamisten angewiesen, die gleichermaßen ein eigenständiger Machtfaktor sind.
Da die Anschläge im indischen Teil Kaschmirs kein Ende nahmen, verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Pakistan und Indien dramatisch. Im Mai 2002 standen die beiden Nuklearmächte am Rande eines Krieges. Über eine Million Soldaten waren entlang der Grenze aufgeboten. Jetzt erst wurde die amerikanische Diplomatie aktiv und vermittelte zwischen Islamabad und Neu-Delhi. Erfolgreich, denn ein Waffengang wurde verhindert – vorerst. Washington braucht Pakistan als logistische Basis für den Anti-
[Seite der Druckausg.: 13]
Terror-Krieg gegen die Taliban und Al-Qa’ida, doch langfristig ist Indien der politisch und wirtschaftlich wichtigere Partner. Die Amerikaner unterstützen folglich Präsident Musharraf aus taktischen Erwägungen, Neu-Delhi dagegen aus strategischen Gründen. Daher kann die pakistanische Führung nicht damit rechnen, daß der Dauerkonflikt in ihrem Sinn entschieden wird. Nach dem Verlust von Kabul jedoch kann Musharraf auf keinen Fall eine weitere Niederlage oder auch nur einen Gesichtsverlust in der Kaschmirfrage hinnehmen. Die Grenzregion wird folglich ein Pulverfaß bleiben, das jederzeit erneut explodieren kann, zumal in beiden Ländern nationalistische und religiöse Extremisten an der Macht beteiligt sind. Für Indien geht es dabei um die nationale Ehre und Souveränität, für Pakistan letztendlich um die eigene Existenz, das Überleben als Nationalstaat.
Historisch gesehen ist Pakistan ein reines Kunstprodukt, entstanden aus der Teilung des indischen Subkontinents 1947, nach dem Ende der britischen Kolonialherrschaft. Indien erhielt die mehrheitlich von Hindus bewohnten Gebiete, Pakistan die mehrheitlich islamischen Gebiete. Fast zehn Millionen Menschen wurden zwischen beiden Ländern umgesiedelt, eine Million bei Massakern getötet. Der Anspruch sowohl Indiens wie auch Pakistans auf das mehrheitlich von Muslimen bewohnte Kaschmir erklärt den politischen Dauerkonflikt der verfeindeten Nachbarn, die bislang drei Krieg gegeneinander geführt haben. Obwohl in Pakistan fast ausschließlich Muslime leben, verfügt das Land über kein Staatsvolk, ebensowenig wie Afghanistan und die meisten arabischen Staaten. Vorherrschend sind auch hier regionale Identitäten, die sich überlagern mit ethnischer und konfessioneller Zugehörigkeit (sunnitischer oder schiitischer Islam). Seit Anfang der neunziger Jahre steht Pakistan am Rande eines Staatsbankrotts, ausgelöst nicht zuletzt durch die schier unermeßliche Korruption der Regierenden. Die Dominanz einer kleinen Kaste von Großgrundbesitzern in Politik und Wirtschaft, der übergroße Einfluß des nördlichen Bundesstaates Pundschab, ferner Armut, Unterentwicklung und der Aufschwung militanter islamistischer Parteien sind eine schwere, kaum zu bewältigende Belastung für Pakistan. Die einzige Institution, die das Land zusammenhält und über ein Minimum an Glaubwürdigkeit verfügt, ist die Armee.
Innerhalb von nur wenigen Monaten hat Pakistan also seinen Einfluß in Afghanistan eingebüßt und gegenüber Indien politisch an Gewicht verloren. Der Preis für den Sturz der Taliban ist die Gefahr einer nicht mehr zu kontrollierenden Eskalation zwischen Indien und Pakistan sowie einer neuen Runde im innerafghanischen Machtkampf. Gleichzeitig verstand es Präsident Musharraf, seine Macht auch weiterhin in Richtung Diktatur auszubauen, was den radikalen Islamisten zusätzlich Munition lieferte für ihre Dschihad-Propaganda. Nicht zuletzt deswegen, weil von den Milliardenbeträgen, die Washington der Regierung in Islamabad für ihren pro-amerikanischen Kurs überwiesen hat, in der breiten Bevölkerung nichts angekommen ist. Das Geld dürfte größtenteils auf die Schweizer Konten der herrschenden Oligarchie umgeleitet worden sein. Zwar ist Pakistan nach den Parlamentswahlen im Oktober 2002 formell zurückgekehrt zur Demokratie, tatsächlich aber kontrolliert Musharraf, der gleichzeitig Oberbefehlshaber
[Seite der Druckausg.: 14]
der Armee ist, auch weiterhin die Regierung und das Parlament, die er jederzeit auflösen kann. Alle Gouverneure werden von ihm ernannt, ohne seine Zustimmung tritt kein Gesetz in kraft. De facto regiert in Pakistan ein Militärregime, das sich eine demokratische Fassade leistet.
Die großen Gewinner der Wahlen waren die Islamisten, die „Vereinigung der islamistischen Parteien„ (MMA). Sie wurden zur drittstärksten politischen Kraft in Pakistan, in den beiden an Afghanistan grenzenden Westprovinzen erhielten sie die Mehrheit und konnten dort die Regierung bilden. Diese Entwicklung ist ebenso bemerkenswert wie beunruhigend. Bis zu den Wahlen waren die Islamisten im Parlament nicht vertreten, ihre Splitterparteien untereinander zerstritten. Ein Machtfaktor waren sie nur indirekt. Denn sie können jederzeit die Straße mobilisieren, und sie genießen großen Rückhalt in der Armee. Zur einigenden Kraft der Islamisten wurde der Anti-Terror-Krieg, die militärische Präsenz der Amerikaner in Afghanistan und Pakistan sowie der abzusehende Angriff auf den Irak. Während also die Taliban in Afghanistan mit Gewalt von der Macht vertrieben wurden, eroberten Taliban-Sympathisanten in Pakistan einen Teil der Macht auf friedlichem Weg. Nüchtern besehen die Quittung für eine verfehlte amerikanische Politik, die überwiegend einer militärischen Logik folgt. Hätte Washington Musharraf beispielsweise gezwungen, das seiner Regierung überlassene Geld sinnvoll zu verwenden, etwa in Form von Kleinkrediten für Bauern, Tagelöhner und Arbeitslose, die ihnen eine Existenzgründung ermöglichen – Präsident Bush wäre vermutlich ein gefeierter Held. Stattdessen kann Musharraf sicher sein, daß der Westen sich mit Kritik an seiner Regierung zurückhalten wird, solange er nur die Islamisten im Griff behält.
Die Folgen sind durchaus fatal. Das Aufspüren von Al-Qa’ida-Infiltranten entlang der Grenze zu Afghanistan ist nicht leichter geworden, seit die Islamisten in den Westprovinzen die Regierung stellen. Auch die fundamentalistischen Madrasas haben keine ernsthafte Kontrolle zu befürchten, seit ihre Absolventen zu Ministern aufgestiegen sind. Der radikale Islam hat seine Wurzeln in der ungerechten Gesellschaftsordnung Pakistans, die durch den Einfluß von außen, die Machtpolitik Washingtons, nicht etwa aufgelöst oder reformiert wird, sondern sich im Gegenteil noch verfestigt. Musharraf ist fest entschlossen, Pakistan im Einflußbereich des Westens zu halten und eine islamische Revolution zu verhindern. Aus diesem Grund arbeiten die Sicherheitskräfte eng mit den Amerikanern zusammen. Wiederholt sind führende Köpfe von Al-Qa’ida in Pakistan, in der Hafenstadt Karachi vor allem, verhaftet und in die USA ausgeliefert worden. Andererseits wäre Musharraf ohne den islamischen Faktor als Bündnispartner des Westens überflüssig. Er wird sich also davor hüten, den Dschihad-Islam offen zu bekämpfen oder gar seine Entmachtung anzustreben, weil er damit letztendlich auch sein eigenes Ende herbeiführen würde – unabhängig davon, daß die Dschihad-Kämpfer im Kaschmirkonflikt eine wesentliche Rolle spielen.
[Seite der Druckausg.: 15]
Mit anderen Worten: der Anti-Terror-Krieg verursacht gefährliche Unwägbarkeiten, die man mit Hilfe von Repression unter Kontrolle zu halten versucht. Gestärkt wird das Militär in Pakistan, nicht die schwache Demokratie. In Bagdad eine Militärdiktatur zu beseitigen, in Islamabad aber dem Militärregime freie Hand zu lassen – dieser Widerspruch läßt selbst die gemäßigte pakistanische Mittelschicht zu Anti-Amerikanern werden. Ohne den mäßigenden Einfluß seiner Eliten jedoch könnte die Atommacht Pakistan sehr bald schon eine größere Bedrohung für den Weltfrieden darstellen als es Saddam Hussein je vermochte.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | März 2003