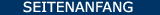![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

Europa als Militärmacht? : Perspektiven der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU / Oliver Thränert - [Electronic ed.] - Berlin [u.a.], 2000 - 17 S. = 63 Kb, Text . - (Frieden und Sicherheit) - ISBN 3-86077-911-7
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2001
© Friedrich-Ebert-Stiftung
-
Die jüngsten Etappen des GASP-Prozesses: Köln, Helsinki und Feira
Motive
Krisenbewältigung
Potenziale
NATO
Verteidigungsidentität
Schluss
Literatur
Oliver Thränert
Europa als Militärmacht?
Perspektiven der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU
Juli 2000
Seit den EU-Gipfeln von Köln und Helsinki hat die außenpolitische und militärische Dimension der Europäischen Union erheblich an Dynamik gewonnen. Wegen der Erfahrungen während des Kosovo-Krieges stehen dabei Fragen des zivilen und militärischen Krisenmanagements im Vordergrund. In der Perspektive wird von einigen darüber hinaus eine gemeinsame Verteidigungspolitik angestrebt.
Eine Vielzahl von Fragen bleibt vorerst offen:
Welche Art von Streitkräften, aber auch welche nicht-militärischen Instrumente sind für eine EU-Krisenstrategie erforderlich?
Wie sollen sich die Beziehungen der EU zur NATO und den Vereinigten Staaten entwickeln?
Inwiefern sind die EU-Mitgliedstaaten bereit, auf nationale Souveränitätsrechte zu verzichten?
Diese Publikation nimmt Ergebnisse eines Projektes der Friedrich-Ebert-Stiftung auf, in dessen Verlauf Konferenzen mit europäischen Parlamentariern in London, Paris, Lissabon, Rom und Berlin durchgeführt wurden. Daran beteiligten sich Abgeordnete aus fast allen EU-Mitgliedstaaten.
Die jüngsten Etappen des GASP-Prozesses: Köln, Helsinki und Feira
Schon im Amsterdamer Vertrag der Europäischen Union, der am 1. Mai 1999 in Kraft trat, wurden wichtige Elemente der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die erstmals im Maastrichter Vertrag von 1992 Erwähnung fand, fortgeschrieben. So wurden die 1992 von der Westeuropäischen Union (WEU) formulierten sogenannten „Petersberg-Aufgaben" in den Vertrag einbezogen. Dabei geht es um humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung, einschließlich friedensschaffender Maßnahmen.
Auch wurden neue Institutionen geschaffen, darunter eine Strategieplanungs- und Frühwarneinheit sowie der Posten eines „Hohen Repräsentanten für die GASP". Er soll den EU-Rat in Angelegenheiten der GASP unterstützen, und ggf. den politischen Dialog mit Dritten führen. „Mr. GASP" wird für die Dauer von fünf Jahren vom Ministerrat ernannt, ist somit den Staats- und Regierungschefs nicht unmittelbar verantwortlich, und soll nach dem Willen der Mitgliedstaaten gleichzeitig den Posten des Generalsekretärs der WEU bekleiden.
Dieser Prozess wurde nach dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages unter erhöhtem Tempo fortgesetzt. Mit den Beschlüssen des Europäischen Rats von Köln im Juni 1999 ist die Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu einem zentralen Bestandteil des europäischen Integrationsprozesses geworden. Die EU will sich zu einem außen- und sicherheitspolitisch handlungsfähigen Akteur auf der weltpolitischen Bühne entwickeln. Als sichtbarer Erfolg konnte in dieser Hinsicht die Ernennung des ehemaligen NATO-Generalsekretär Javier Solana zum „Hohen Repräsentanten für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik" der EU gewertet werden.
Die EU strebt nunmehr autonome Handlungsfähigkeiten an, die sich auf glaubwürdige militärische Fähigkeiten und geeignete Beschlussfassungsgremien stützen. Die Integration von EU und WEU wird ins Auge gefasst, jedoch soll die NATO das Fundament der kollektiven Verteidigung ihrer Mitglieder bleiben.
Einen weiteren Meilenstein stellten die Beschlüsse des Europäischen Rates von Helsinki im Dezember 1999 dar. Dort wurde die Einrichtung eines ständigen politischen und sicherheitspolitischen Komitees mit Sitz in Brüssel beschlossen. Es soll sich mit allen Fragen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik befassen und im Falle der Durchführung von Krisenmanagementoperationen im Einzelfall nach Vorgabe des Rates die politische Kontrolle und strategische Führung der Operationen wahrnehmen. Außerdem wurden ein EU-Militärausschuss und ein dort angesiedelter Militärstab eingerichtet. Da offen ist, ob die Umsetzung dieser Beschlüsse der Änderung des EU-Vertrages bedarf, wurde die Einrichtung dieser Gremien zunächst in Interimsform beschlossen.
Sichtbarster Ausdruck des Willens der EU-Mitgliedstaaten, eigene Krisenbewältigungskapazitäten aufzubauen, waren die in Helsinki vereinbarten Planziele:
Bis zum Jahr 2003 soll die EU in der Lage sein, bei Krisenmanagementoperationen Streitkräfte bis zur Korpsgröße (rund 50.000 bis 60.000 Soldaten einschließlich Kampfunterstützungstruppen und Logistik) und zusätzlich entsprechende Streitkräfteanteile von Marine und Luftwaffe innerhalb von 60 Tagen zu verlegen und eine entsprechende Operation für mindestens ein Jahr aufrechtzuerhalten.
Außerdem wurden die Zuständigkeiten von „Mr. GASP" näher definiert. Dabei geht es um
- die intensive Zusammenarbeit von „Mr. GASP" und dem Kommissar für Außenbeziehungen;
- die Unterstützung des Vorsitzes im Ministerrat zwecks Erreichens einer hohen Kohärenz zwischen allen Sachfeldern der Außenpolitik;
- die Leistung von Beiträgen zur Durchführung der GASP-Beschlüsse in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission, den Mitgliedstaaten und sonstigen Stellen;
- die Erfüllung von spezifischen Aufträgen des Ministerrates;
- die Übermittlung von Erklärungen des Vorsitzes an Drittstaaten und Organisa-tionen.
Der EU-Gipfel in Feira im Juni 2000 schließlich widmete sich besonders dem nicht-militärischen Krisenmanagement. Dabei wurden die bis dahin im Kosovo gemachten Erfahrungen im Hinblick auf die Durchsetzung einer öffentlichen Ordnung beachtet. Analog zu den Helsinki-Beschlüssen im militärischen Bereich wurde in der portugiesischen Kleinstadt festgehalten, dass die EU-Mitglieder bis 2003 dazu in der Lage sein sollen, 5000 Polizisten für eine internationale Mission bereitzustellen. Spätestens innerhalb von 30 Tagen sollen 1000 Polizisten in einem Krisengebiet stationiert werden können. Außerdem sollen die EU-Staaten bereit sein, Richter, Staatsanwälte und Vollzugsbeamte zur Durchsetzung der öffentlichen Ordnung zu entsenden. Solche Operationen sollen entweder auf Anfrage der Vereinten Nationen oder der OSZE oder als autonome EU-Aktivität durchgeführt werden.
Motive
Wie ist es zu erklären, dass die Europäische Union in den letzten Monaten das Thema der GASP mit so hohem Tempo vorangetrieben hat? Zumal da dieser Prozess weiterhin intergouvernemental angelegt ist und sich die EU in der Vergangenheit kaum als ein einheitlicher Akteur in der Weltpolitik zu profilieren vermochte?
Der Politik Frankreichs kommt in diesem Zusammenhang sicherlich eine Schlüsselrolle zu. Paris ist traditionell seit den Tagen de Gaulles darum bemüht, Europa in der Außen- und Sicherheitspolitik stärker und insbesondere von Amerika unabhängiger zu machen. Dabei gilt es für französische Politiker als selbstverständlich, dass Frankreich bei der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik eine Führungsrolle zusteht.
Der frühere französische Präsident Mitterand strebte eine unabhängige europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik außerhalb der NATO an. Nachdem dies als gescheitert anzusehen war, schwenkte sein Nachfolger Chirac auf eine Politik der Balance zwischen europäischen Initiativen und der Annäherung an die Atlantische Allianz um. Doch sein Versuch, Frankreich und Europa im Verhältnis zu den USA mehr Gewicht zu verschaffen, stieß an wenigstens drei wesentlichen Stellen erneut an seine Grenzen:
- Die USA waren nicht bereit, Frankreichs Politik der Annäherung an die NATO mit einer sichtbaren Präsenz französischer Militärs im NATO-Kommando-Gefüge zu belohnen. Im langwierigen und zähen Kampf um das NATO-Kommando-Süd in Neapel, das für den gesamten Mittelmeerraum verantwortlich ist, setzte sich Washington durch. Das Kommando blieb wie gewohnt in amerikanischer Hand.
- Bei der NATO-Osterweiterung wollte Paris zusätzlich zu Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik auch Rumänien und Slowenien aufgenommen sehen. Doch abermals blieb Washington stärker und es blieb bei drei Aufnahmekandidaten.
- Schließlich mußte Frankreich im Kosovo-Krieg die Erfahrung der fast vollständigen Abhängigkeit von amerikanischer Militärtechnik machen. Als Folge blieb der französische Einfluss auf die Zielplanung begrenzt, ja die USA bombardierten sogar Ziele, darunter der Angriff auf die chinesische Botschaft in Belgrad, die überhaupt nicht mit den Bündnispartnern abgesprochen waren. Wie es der französische Verteidigungsminister Rochard ironisch ausdrückte: neben Frankreich war während des Krieges ein weiteres Land nicht voll in das Bündnis integriert, nämlich die USA.
Doch schon im Spätherbst 1998 hatte Paris - für viele ein wenig überraschend - einen neuen Verbündeten gefunden, um die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik voranzutreiben: London. Überraschend deswegen, weil sich das Vereinigte Königreich im Gegensatz zu Frankreich traditionell transatlantisch orientiert und im Zweifelsfalle der NATO den Vorrang einräumt. Noch während der Diskussionen um die Revision des Maastrichter Vertrages, die 1996 und 1997 stattfanden, hatte sich Großbritannien gegen von Frankreich, aber auch Deutschland angestrebte verteidigungspolitische Kompetenzen der EU zur Wehr gesetzt.
Wie also ist der Schwenk der britischen Politik zu erklären? Tony Blair war 1997 als britischer Premier mit der Maßgabe angetreten, in Europa eine Führungsposition einnehmen zu wollen. Da sich Großbritannien von der Währungsunion selbst ausschloss, bot sich das Feld der Sicherheits- und Verteidigungspolitik geradezu an. Denn auf diesem Gebiet hat London nicht nur seinen Status als Kernwaffenstaat einzubringen, sondern auch seinen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat in New York. Hinzu kam, dass Washington positivere Töne im Hinblick auf eine stärkere Rolle der Europäer vernehmen ließ, solange dadurch die NATO nicht beeinträchtigt würde.
So vollzog Blair in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine Kehrtwende. Sie deutete sich bereits bei einem EU-Sondergipfel im Oktober 1998 im österreichischen Pörtschach an, und wurde unmittelbar danach endgültig bei einem Treffen zwischen Blair und dem französischen Präsidenten Chirac im Dezember 1998 vollzogen. Bei dieser Zusammenkunft in St. Malo gaben die beiden Spitzenpolitiker eine gemeinsame Erklärung über die europäische Verteidigung ab. Darin forderten sie, dass die Europäische Union über eine autonome Handlungsfähigkeit verfügen müsse, um auf internationale Krisen reagieren zu können. Daher müsse die EU, um Entscheidungen treffen zu können, wo die NATO als Ganzes nicht betroffen ist, über die entsprechenden Strukturen verfügen und auch verstärkte militärische Kräfte aufbauen. Der britische Verteidigungsminister Robin Cook bezeichnete diese Erklärung in einem Fernsehinterview nach dem Treffen als eine historische Übereinkunft, deren Ursprung vor allem darin zu sehen sei, dass Frankreich und Großbritannien von nun an gemeinsam eine Führungsrolle in der Debatte um eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik einnehmen wollten.
Die britische Regierung war von einem dreifachen Motiv bei ihrer Kehrtwende hin zu einer europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik geleitet:
- Sie wollte das eigene Gewicht in Europa stärker zur Geltung bringen;
- sie wollte darüber hinaus verhindern, dass unter französischem Einfluss die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine Richtung einnehmen würde, die die NATO gefährden könnte;
- sie wollte durch ein stärkeres sicherheitspolitisches Profil ihren eigenen Einfluss in Washington erhöhen.
Frankreich seinerseits sah in der Erklärung von St. Malo in erster Linie eine Möglichkeit, unter Mithilfe Londons einen erneuten Anlauf für die Stärkung Europas und damit Frankreichs im Verhältnis zu den USA zu nehmen.
Die Annäherung der beiden militärpolitisch stärksten EU-Staaten Frankreich und Großbritannien war ein zentrales Moment für die allgemeine Zunahme der Bedeutung der EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Aber auch andere EU-Staaten, darunter Deutschland, hatten schon seit einiger Zeit besonders aufgrund der Balkan-Kriege die Notwendigkeit der Stärkung der EU auf dem verteidigungs- und sicherheitspolitischen Gebiet eingesehen. Dies traf auch auf diejenigen Länder wie etwa Portugal oder die Niederlande zu, die traditionell eher transatlantisch orientiert waren.
Ein weiterer Grund ist in der Tatsache zu sehen, dass nach dem vorläufigen Abschluss der schwierigen Entwicklung hin zur gemeinsamen europäischen Währung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Für viele - besonders in Frankreich - kam es dem nächsten logischen Schritt bei der europäischen Integration gleich, nach der Währung nun die Außen- und Sicherheitspolitik anzugehen.
Schon 1998/99 waren also wichtige Fundamente gelegt, um der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik neuen Schwung zu verleihen. Doch dann kam ein Ereignis hinzu, das der eigentliche Anlass zur Beschleunigung des Prozesses wurde: der Kosovo-Krieg. Wie in jedem Krieg wurden die Machtverhältnisse klar gestellt. Am Ende der militärischen Operation konnte kein Zweifel bestehen: Europa ist von den USA bei der militärischen Krisenbewältigung fast vollständig abhängig. Nicht nur flog die US-Luftwaffe neunzig Prozent der Einsätze, sondern das US-Militär dominierte auch die Aufklärung und damit die Zielauswahl sowie die Kommunikation. Wollten die EU-Staaten wenigstens mittel- bis langfristig ihren Einfluss erhöhen, mussten sie sich auf neue Initiativen nicht nur zur Verbesserung ihres eigenen Entscheidungsprozesses sondern auch zur Stärkung ihrer militärischen Fähigkeiten einigen.
Krisenbewältigung
Es ist diese Erfahrung aus dem Kosovo-Krieg, die dazu geführt hat, dass europä-ische Politiker sich im Hinblick auf die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf diese Art von Krisen und Konflikten konzentrieren, wie sie auf dem Balkan gerade stattfinden. Dies ist der Grund dafür, warum sich die europäischen Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in Helsinki so ehrgeizige Ziele im Hinblick auf die militärische und beim Gipfel in Feira bezüglich der nicht-militärischen Krisenbewältigung setzten.
Einig sind sich alle EU-Staaten darin, dass eine möglichst baldige Erweiterung der Union mögliche Krisen verhindern könnte. Schon die Perspektive einer EU-Mitgliedschaft ist ein hoher Anreiz für die betroffenen Staaten, Konflikte gewaltfrei beizulegen, da dies Voraussetzung für eine Aufnahme ist. Auch würde eine nach Osten ausgeweitete EU stabilisierend in die weitere Region Ost- und Südosteuropas hinein wirken. Doch ist derzeit noch nicht abzusehen, wann und in welchen Schritten sich die EU öffnen wird.
Bei der unmittelbaren Krisenbewältigung bleiben darüber hinaus eine Reihe von Fragen noch offen. Die erste betrifft die Gewichtung von militärischer und nicht-militärischer Krisenbewältigung. Während Frankreich und das Vereinigte Königreich den Schwerpunkt auf die militärischen Mittel legen, neigen insbesondere die neutralen EU-Staaten dazu, den nicht-militärischen Instrumenten eine große Bedeutung beizumessen. Dabei verfügt die EU im Vergleich zu anderen Institutionen wie der NATO einerseits und der OSZE andererseits im Prinzip über einen unschätzbaren Vorteil: Während die NATO eher für die militärische Krisenbewältigung taugt und die OSZE auf die nicht-militärische Krisenbewältigung konzentriert ist, kann die EU sich - jedenfalls perspektivisch - sowohl bei der militärischen als auch bei der nicht-militärischen Krisenbewältigung engagieren.
Damit verfügt die EU potenziell auch über die Fähigkeit, die Grauzone zwischen den beiden Bereichen der Krisenbewältigung zu füllen. Und darauf wird es nach Meinung vieler europäischer Politiker in Zukunft vermehrt ankommen. So sollten in einem Konflikt wie im Kosovo schon frühzeitig Polizeikräfte eingesetzt werden, damit der spätere Einsatz von Luftstreitkräften erst gar nicht nötig wird. Es geht also - in den Augen europäischer Politiker - um ein intelligenteres Krisenmanagement als bisher, für das sich die EU sowohl militärisch, vor allem aber auch nicht-militärisch rüsten sollte. Die Beschlüsse von Helsinki und Feira haben - zumindest auf dem Papier - zu einer angemessenen Gewichtung von militärischem und nicht-militärischem Krisenmanagement beigetragen.
Einig ist man sich im Prinzip unter europäischen Politikern auch darin, dass Krisen und Konflikte einer langfristigen Bearbeitung bedürfen. Mit anderen Worten: nicht erst wenn es in einem Konflikt zu einer Eskalation gekommen ist, soll sich die Europäische Union dafür interessieren und entsprechend handeln, sondern schon weit vorher. Dabei sollten auch die sozialen und ökologischen Dimensionen ethnischer Konflikte einbezogen werden. Wichtig sei dabei die frühzeitige Einbeziehung der Politikberatung. Auch müsse das Verhältnis zur OSZE bei der nicht-militärischen Krisenbewältigung geklärt werden, um auf jeden Fall Doppelstrukturen zu vermeiden.
Bei der militärischen Krisenbewältigung besteht eine wesentliche Frage darin, ob der Kosovo-Einsatz der NATO, der ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrates erfolgte, die einmalige Ausnahme bleiben sollte, oder ob man auch bei möglichen künftigen militärischen Engagements der EU im Falle eines nicht erfolgten Mandats der Vereinten Nationen militärische Kräfte einsetzen sollte, wenn man dies für notwendig erachtet. Während Frankreich und Großbritannien eher dazu zu neigen scheinen, sich notfalls auch ohne UN-Mandat militärisch zu engagieren, schließen dies Vertreter anderer EU-Mitgliedsländer, besonders der neutralen Staaten, meist aus.
Die wichtigste Frage ist aber wohl, ob die EU in den kommenden Jahren überhaupt dazu in der Lage sein wird, wirksame militärische und nicht-militärische Instrumente der Krisenbewältigung aufzubauen. Denn eines gilt es auf jeden Fall zu vermeiden: eine halbe europäische Interventionsfähigkeit, die der EU einen Schein der Unabhängigkeit von den USA lässt, in der Praxis aber dann zu einem Kollaps führt.
Potenziale
Bei dem in Helsinki im Dezember 1999 festgelegten Ziel, 60.000 Soldaten der EU für ein Jahr in einer Krisenregion aufrechtzuerhalten, handelt es sich um ein recht ambitioniertes Vorhaben. Zum Vergleich: In Bosnien-Herzegowina umfassen die dortigen NATO-geführten Einheiten der SFOR derzeit etwa 31.000 Soldaten aus 38 Nationen, während es sich bei der NATO-Mission KFOR im Kosovo um etwa 45.000 Soldaten aus 28 Ländern handelt. An beiden Operationen sind also eine Vielzahl von Staaten beteiligt, darunter die USA und Russland. Die Europäische Union mit ihren derzeit 15 Mitgliedstaaten hat sich nun vorgenommen, Einsätze in etwa dieser Größenordnung unabhängig absolvieren zu können. Dabei gibt es schon bei den derzeitigen Missionen auf dem Balkan nicht unerhebliche Probleme. So sehen viele dort im Einsatz befindliche Bundeswehrangehörige die Stehzeiten im Einsatz von in der Regel sechs Monaten als zu lang an.
Größtes Problem für den Aufbau militärischer Kapazitäten der EU dürfte sein, die Streitkräfte besonders in den Bereichen Aufklärung, Transport und Kommunikation so auszurüsten, dass sie dazu in der Lage sind, über einen längeren Zeitraum in möglicherweise entfernteren Regionen zu operieren. Da in nahezu allen EU-Staaten die Verteidigungshaushalte während der letzten Jahre zurückgefahren worden sind, ist die Ausrüstung mittlerweile oft veraltet. In der modernen Militärtechnologie sind die USA den Europäern daher weit voraus, was im Kosovo-Krieg deutlich geworden ist. Die USA geben nicht nur mehr für Verteidigung aus, vor allem investieren sie auch viel mehr in moderne Militärtechnologie. Daher wird sich die Schere zwischen den USA und Europa bei den militärischen Fähigkeiten in naher Zukunft eher öffnen als schließen.
In kaum einem europäischen Land sind erhöhte Verteidigungsetats derzeit legitimierbar. Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Wegfall der Bedrohung durch die Sowjetunion und den Warschauer Pakt ist die Legitimationsbasis für Rüstungsausgaben allgemein in Europa brüchig geworden. Daran ändern die militärischen Engagements auf dem Balkan nichts. Hinzu kamen die Konvergenzkriterien für die gemeinsame europäische Währung, die Einsparungen in allen Haushalten erforderlich machten. Einige Politiker hegen nun die Vorstellung, durch eine Europä-isierung der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik eine neue Legitimationsbasis für Verteidigungsausgaben zu schaffen. Ob dies jedoch für die europäischen Öffentlichkeiten akzeptabel sein wird, muss derzeit noch offen bleiben.
Oft wird auch argumentiert, eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben sei gar nicht notwendig. Viel wichtiger sei eine bessere Koordinierung zwischen den einzelnen Ländern. Tatsächlich umfassen die Militärausgaben der EU-Staaten etwa 60% derjenigen der USA, ohne dass Europa damit 60% der amerikanischen militärischen Leistungsfähigkeit erreichen würde.
Dies liegt an einer Vielzahl von Doppelstrukturen bei den Ausrüstungen und Investitionen. Daher läge eine verbesserte Kooperation der europäischen Rüstungsindustrien nahe. Diese wird auch vielfach eingefordert, doch ist sie bis jetzt noch nicht in ausreichendem Umfang verwirklicht worden. Einige in den letzten Wochen gefassten Beschlüsse weisen den Weg in Richtung einer verbesserten Kooperation. So haben sich Frankreich, Großbritannien und Deutschland auf die Anschaffung eines europäischen Militär-Transportflug-zeuges vom Typ Airbus geeinigt. Darüber hinaus bekräftigten die französische und die deutsche Regierung bei einem Gipfeltreffen in Mainz im Juni 2000 ihre Absicht zum Aufbau eines europäischen Aufklärungs-Satellitensystems.
Ein Problem bei gemeinsamen Rüstungsprojekten besteht in unterschiedlichen Vorstellungen im Hinblick auf gemeinsame Regelungen beim Rüstungsexport. Die Bundesregierung zum Beispiel sieht die Einhaltung von Menschenrechten als ein Kriterium für Exportentscheidungen an, was in anderen EU-Staaten auf Kritik stößt. Allgemein möchte Deutschland Rüstungsexporte außerhalb der NATO beschränken, um nicht durch solche Exporte erst diejenigen Krisen und Konflikte zu schüren, die man dann hinterher durch Militäreinsätze und andere Maßnahmen bearbeiten muss. Diese Argumente werden nicht von allen europäischen Regierungen uneingeschränkt geteilt.
Fraglich ist auch, ob es gelingen wird, dass sich insbesondere die Streitkräfte kleinerer Länder auf bestimmte Aufgaben konzentrieren. Dies wiederum wirft die Frage künftiger multinationaler Einheiten auf, die bisher noch nicht im EU-Rahmen in Angriff genommen wurde. Sollte man sich dazu entschließen, die europäischen Armeen mehr als bislang miteinander zu verzahnen, könnte ein weiteres Problem dazukommen: die demokratische Legitimation des Einsatzes von Streitkräften. Es könnte zu Handlungszwängen kommen, in deren Folge das nationale Entscheidungsrecht zum Einsatz von Streitkräften, und damit das parlamentarische Veto-Recht in einem solchen Fall, ausgehebelt wird.
Der Bundeswehr kommt sicherlich eine Schlüsselrolle beim Aufbau europäischer Krisenbewältigungsinstrumente zu. Schließlich strebt Bundesverteidigungsminister Scharping an, dass die Bundeswehr etwa ein Fünftel der geplanten EU-Streitkräfte stellt. Doch setzt dies entschlossene Reformen bei der Bundeswehr voraus.
Wegen des ständig rückläufigen Verteidigungshaushaltes ist die Ausrüstung der deutschen Streitkräfte oft hoffnungslos veraltet. Einige sind der Ansicht, die Fortführung der Sparpolitik bei der Bundeswehr würde zu einem Desaster im Hinblick auf die in Helsinki vereinbarten Ziele führen. Verteidigungsminister Scharping selbst meint, gäbe es für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik Konvergenzkriterien wie für die Teilnahme an der Währungsunion, so bliebe Deutschland draußen vor der Tür.
Insofern wird es in nicht unerheblichem Maße von der Strukturreform bei den deutschen Streitkräften abhängen, ob die EU die in Helsinki vereinbarten ehrgeizigen Ziele verwirklichen können wird.
Dabei wird auch die Frage der Aufrechterhaltung der Wehrpflicht von Bedeutung sein. Bekanntlich wird diese in Deutschland von vielen, darunter dem Verteidigungsminister, mit Nachdruck unterstützt. Andere europäische Länder wie Frankreich, aber auch die Niederlande haben bereits Freiwilligenarmeen aufgebaut und die Wehrpflicht ausgesetzt, oder haben traditionell Berufsarmeen wie Großbritannien, oder sie sind wie Portugal auf dem Wege, auf eine Berufsarmee umzustellen. Sie machen dabei unterschiedliche Erfahrungen. Ohne dass hier der Ort ist zu diskutieren, ob die Wehrpflicht die angemessene Wehrform auch im europäischen Maßstab ist, soll doch darauf hingewiesen werden, dass die am Projekt der europä-ischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik beteiligten Regierungen hier unterschiedlicher Auffassung sind. Besonders in Großbritannien wird vielfach die Meinung geäußert, die Wehrpflicht sei für die anstehenden Aufgaben nicht angemessen.
Schließlich trifft auch die in Feira vereinbarte Bereitstellung von Polizisten auf nicht unerhebliche Probleme. Polizisten werden - anders als Soldaten - zur Durchsetzung der öffentlichen Ordnung ihres Heimatlandes täglich benötigt und sind daher nicht leicht abkömmlich. Hinzu kommt, dass ihr Berufsbild in der Regel Auslandseinsätze nicht vorsieht und sie daher auch nicht darauf vorbereitet sind.
NATO
Die politisch brisanteste Frage bei der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik dürfte in ihrem Verhältnis zur NATO und damit zu den USA zu sehen sein. Nicht wenige befürchten, europäische Bemühungen um mehr verteidigungspolitische Selbständigkeit könnten die Atlantische Allianz in eine tiefgreifende Krise stürzen. Am Ende der Entwicklung könnte dann der Rückzug der Amerikaner aus Europa stehen. Wie also sieht das Verhältnis zwischen NATO und EU aus?
Zunächst ist weiterhin von unterschiedlichen Mitgliedschaften der EU und der NATO auszugehen. Es wird kaum gelingen, sie deckungsgleich zu machen. Die USA, Kanada und Island werden nicht der EU angehören. Besonders bei der NATO-Führungsmacht USA besteht daher kein Interesse daran, dass die NATO mit bereits in der EU abgestimmten Positionen konfrontiert wird.
Polen, Ungarn und Tschechien sind keine EU-Staaten, sie dürften aber in den kommenden Jahren aufgenommen werden. Sie stehen der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik eher skeptisch gegenüber, da sie fürchten, bis zum Zeitpunkt ihrer vollen EU-Mitgliedschaft auf dem Gebiet der Verteidigung von europäischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen zu bleiben. Diese Skepsis wird auch dadurch genährt, dass Frankreich die konkreten Planungen für die militärische und nicht-militärische Krisenbewältigung auf die derzeitigen EU-Mitglieder beschränkt wissen will. Paris fürchtet, Polen könnte sich zu einer Art trojanischem Pferd in der EU entwickeln, das amerikanische Interessen in die Union hineinträgt. Diese Ansicht wird von anderen EU-Staaten, besonders Großbritannien, nicht geteilt.
Frankreichs Mißtrauen gegenüber Polen wiederum hat seine Ursache darin, dass Warschau, aber auch Prag und Budapest, sich einen wirklichen Schutz nur vom amerikanischen Bündnispartner versprechen. Ein Rückzug Amerikas aus Europa entspräche daher auf keinen Fall den Interessen dieser Staaten. Ob sich die skeptische Haltung dieser Staatengruppe hinsichtlich einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach ihrer Aufnahme in die EU ändern wird, bleibt abzuwarten.
Die NATO-Staaten Norwegen und die Türkei werden der EU erst zu einem noch weiter in der Zukunft liegenden Zeitpunkt angehören (oder ihr, wie im Falle Norwegens, auf eigenen Wunsch hin weiter fern bleiben). Ihr Interesse besteht darin, durch EU-Entscheidungen, die in das Bündnis hinein getragen werden, nicht in der NATO marginalisiert zu werden. Norwegen hat darüber hinaus ein Interesse an amerikanischer Präsenz in Europa, um Russland im Hinblick auf die nordische Sicherheit ausbalancieren zu können. Ebenso sieht die Türkei in ihrer europä-ischen Randlage Amerika als den wesentlichen Garanten ihrer Sicherheit an.
Finnland, Schweden, Irland und Österreich - alle EU-Staaten - bestehen weiter auf ihren neutralen Status bzw. auf einen Status als nicht allianz-gebundener Staat. Diese Länder unterstützen Bemühungen um europäische Krisenbewältigungsinstrumen-te, aber in keinem dieser Staaten gibt es eine Mehrheit für einen NATO-Beitritt.
Schließlich könnten künftig Länder wie Slowenien und Estland der EU angehören, es ist aber fraglich, ob sie auch gleichzeitig in die NATO aufgenommen werden. Einerseits sind sie womöglich in nicht allzu ferner Zukunft wirtschaftlich für die EU qualifiziert, andererseits stellt sich besonders im Hinblick auf Estland - in der Perspektive aber auch für Lettland und Litauen - die Frage, ob die USA wegen einer NATO-Mitgliedschaft dieser Länder einen handfesten Konflikt mit Russland riskieren wollen.
Besonders die Haltung der USA zur europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ist von Bedeutung. Dort mahnt man schon seit längerer Zeit verstärkte militärische Anstrengungen der Europäer an. In den USA stellen sich viele die Frage, wa-rum das wirtschaftlich so starke Europa so geringe militärische Kapazitäten habe. Diese Kritik an Europa wird mittlerweile nicht nur von Isolationisten, sondern auch von Internationalisten vorgetragen. Um die Stabilität der transatlantischen Beziehungen zu sichern, müssen - so die vorherrschende Meinung jenseits des Atlantik - strategische Ungleichgewichte zwischen Amerika und Europa austariert werden. Mit anderen Worten: die Last für die USA muss verringert werden. Sollten die Europäer keine verstärkten Verteidigungsanstrengungen unternehmen, sehen einige die US-Militärpräsenz in Europa als gefährdet an. Jedenfalls werde es - so die Ansicht einiger amerikanischer Experten - die amerikanische Öffentlichkeit bei Kriseneinsätzen nicht noch einmal hinnehmen, dass die USA 90% der militärischen Einsätze übernehmen, wie dies im Kosovo der Fall war.
Amerikanische Politiker verknüpfen mit der EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik durchaus Hoffnungen. In erster Linie geht es dabei um eine mögliche Entlastung Amerikas. Washington hofft darüber hi-naus, die Europäer würden als Konsequenz einer vermehrten Auseinandersetzung mit sicherheitspolitischen Problemen die Gefahren, die mit der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen einher gehen, er-nster nehmen und künftig auch mehr Bereitschaft zu militärischen Engagements außerhalb Europas zeigen. Darüber hinaus erhofft sich Washington eine weitere Annäherung Frankreichs an die Atlantische Allianz und eine mögliche baldige NATO-Mitgliedschaft der neutralen EU-Staaten.
Der Kern der amerikanischen Hoffnungen besteht aber darin, dass die NATO durch die europäischen Verteidigungsinitiativen stärker gemacht wird. Dies gilt sowohl militärisch als auch politisch. Militärisch sollen neue europäische Anstrengungen zu verbesserten militärischen Optionen führen, politisch soll die bessere Balance zwischen Europa und Amerika das Bündnis stärken.
Die USA sind also durchaus für eine stärkere verteidigungspolitische Rolle Europas. Dies schließt auch Aktionen nicht aus, die nur von den Europäern durchgeführt werden, wenn die NATO als Ganzes - sprich die USA - keine Notwendigkeit einer Beteiligung sieht. Zu diesem Zweck wurde auf dem NATO-Gipfel von Berlin 1996 ein Konzept der „Combined Joint Task Forces" (CJTF) verabschiedet, das es nach dem Motto „trennbar, aber nicht getrennt" europäischen NATO-Streitkräften ohne direkte amerikanische Beteiligung erlauben soll, unter Nutzung von NATO-Infrastruktur militärische Einsätze durchzuführen. Allerdings müsste dem die Zustimmung des NATO-Rates vorangehen, so dass die USA bei jedem möglichen Einsatz ein Veto-Recht hätten. Während besonders Frankreich, aber auch andere europäische NATO-Staaten CJTF als Instrument größerer europäischer Unabhängigkeit ansahen, fasste Washington dieses Konzept als Mittel auf, der NATO flexiblere Einsatzoptionen zu verschaffen.
Mit ihren Beschlüssen von Köln und Helsinki geht die EU nun insofern über dieses Konzept hinaus, als sie in ihrem eigenen Rahmen - also außerhalb der NATO - einen Entscheidungsmechanismus entwickelt und auch die Verfügbarkeit entsprechender Mittel zur Durchführung solcher Entscheidungen anstrebt. Vor allem die EU-Beschlüsse von Köln haben daher in Washington zu der Befürchtung geführt, die EU wolle sich mit ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik völlig unabhängig von der NATO positionieren. Die entscheidende Frage ist daher, inwieweit die EU unabhängig von der NATO militärische, aber auch nicht-militärische Krisenbewältigung anstrebt.
Die amerikanische Haltung dazu wurde bereits 1998 von der Clinton-Admini-stration mit den drei D’s umschrieben: keine Duplizierung, keine Abkopplung (englisch: decoupling), und keine Diskriminierung. Amerika würde also den EU-Bestrebungen positiv gegenüberstehen, falls die EU erstens nicht bereits bestehende NATO-Strukturen duplizieren und damit unnötig Ressourcen vergeuden würde. Zweitens sollte die EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht zu einer Abkopplung Europas von Amerika führen. Damit war u.a. gemeint, dass es innerhalb der NATO nicht zu EU-Vorabsprachen kommen dürfe. Drittens schließlich sollten NATO-Staaten, die nicht der EU angehören, nicht diskriminiert werden.
Verschiedene amerikanische Politiker machten ihre Haltung im Hinblick auf den Vorrang der NATO immer wieder deutlich. So meinte US-Verteidigungsminister Cohen in einem Interview: „Der Sinn der ESDI (der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität) ist es, zu handeln, wenn die Nato dies nicht will. Doch eine separate, unabhängige, autonome Organisation wird sehr wohl das transatlantische Band schwächen. Das sollten wir vermeiden. Deshalb haben wir die Europäer sogar ermutigt. Aber: Bitte keine eigene Sicherheitsbürokratie, keine Strukturen, die mit den Nato-Verpflichtungen kollidieren." (Süddeutsche Zeitung vom 5./6. Februar 2000, S. 12). Und der stellvertretende US-Außenministers Talbott meinte: „Wir möchten keine ESDI erleben, die erst in der Nato entsteht, dann aus der Nato herauswächst und dann sich von der Nato wegbewegt." (Süddeutsche Zeitung vom 9. Dezember 1999, S. 12).
Wie weit die Unabhängigkeit von der NATO bzw. den USA letztlich gehen soll, darüber sind sich die Europäer selbst keineswegs einig. Während besonders die Franzosen traditionell maximale Eigenständigkeit anstreben, legen andere - da-runter Großbritannien und Deutschland - mehr Wert darauf, die NATO durch mögliche EU-Beschlüsse nicht in Frage zu stellen. Der Europäische Rat von Helsinki hat dazu eine Kompromissformel gefunden, die auch die Amerikaner zunächst zufrieden stellte. Im Schlussdokument heißt es: „Der Europäische Rat unterstreicht seine Entschlossenheit, die Union in die Lage zu versetzen, autonom Beschlüsse zu fassen und in den Fällen, in denen die NATO als Ganzes nicht einbezogen ist, als Reaktion auf internationale Krisen EU-geführte militärische Operationen einzuleiten und durchzuführen."
Dies wird von den meisten Europäern dahingehend interpretiert, dass der NATO im Falle einer Krise das Recht der ersten Ablehnung zusteht. Erst falls die NATO nicht aktiv werden will, soll die EU aktiv werden können. Besonders Frankreich scheint sich damit jedoch nicht zufrieden geben zu wollen. Paris würde eigenständige europä-ische Entscheidungsstrukturen und eigenständige militärische Fähigkeiten bevorzugen. Auch ohne Zustimmung der USA handlungsfähig zu sein, darin besteht gerade das Ziel französischer Politik.
Es sind diese französischen Bestrebungen, die viele Amerikaner mißtrauisch machen. Sie befürchten, dass die EU aufgrund des französischen Einflusses doch noch eine völlige Autonomie im Verhältnis zur NATO anstreben könnte. Was Amerika in diesem Zusammenhang missfällt ist die Tatsache, dass Paris eine Übernahme der zwischen NATO und WEU getroffenen Vereinbarungen über die militärische Zusammenarbeit im Sinne der CJTF durch die EU ablehnt.
Warum aber pocht Washington so stark auf den Vorrang der NATO und ist skeptisch gegenüber europäischen Initiativen?
Vonseiten der US-Regierung wird befürchtet, starke europäische Autonomiebestrebungen könnten den amerikanischen Kongress dazu bewegen, den Abzug der US-Truppen aus Europa zu fordern. Entsprechende Stimmen sind auf dem Kapitolshügel schon seit einiger Zeit zu hören. Sie würden durch vermehrte europäische Unabhängigkeitsbestrebungen sicherlich an Bedeutung gewinnen. Eine solche Entwicklung wäre aber nicht im Sinne der US-Regierung, die jeden Isolationismus in der Außenpolitik ablehnt.
Abgesehen von dem Problem der Stärkung isolationistischer Bestrebungen im Kongress möchte Washington auf jeden Fall verhindern, dass sich die NATO hauptsächlich auf die weniger wichtige Frage der Bündnisverteidigung hinsichtlich einer russischen Residualbedrohung konzentriert, während die EU die wichtigeren Missionen in Regionen ethnischer oder anderer Konflikte übernimmt. Dies wäre mit einem Verlust an amerikanischem Einfluss in Europa verbunden, der jedenfalls derzeit nicht gewollt ist.
Auch möchte Washington verhindern, dass sich die EU insofern die Rosinen aus dem Kuchen pickt, als die Europäer sich womöglich auf friedenssichernde Maßnahmen und nicht-militärische Krisenbewältigung konzentrieren, die Amerikaner aber immer dann gerufen werden, wenn es um Kampfeinsätze geht. Umgekehrt ist es auch nicht im amerikanischen Interesse, wenn die EU einen militärischen Kampfeinsatz beginnt, es sich aber dann herausstellt, dass die Kräfte dafür doch zu schwach sind. Für Europa in so einem Fall die Kohlen aus dem Feuer zu holen, das ist nicht die amerikanische Vorstellung künftiger transatlantischer Kooperation.
Tatsächlich ist dies eine Hauptsorge in Washington: dass sich die Europäer zwar hohe Ziele setzen, letztlich aber nicht die Kraft zu vermehrten Verteidigungsanstrengungen aufbringen. Bis auf weiteres bleiben die Europäer ohnehin auf amerikanisches Material angewiesen, weshalb Washington es als sein gutes Recht ansieht, auch den Entscheidungsprozess bei möglichen Einsätzen mitzubestimmen.
Auf jeden Fall möchte Washington dabei vermeiden, dass Europa bei künftigen militärischen Krisenbewältigungseinsätzen auf einem Mandat des UN-Sicherheitsrates besteht. Denn anders als viele Europäer sieht Washington eine solche Legitimation für militärische Aktionen nicht mehr unbedingt als zwingend an.
Schließlich ist den USA auch daran gelegen, eine Marginalisierung der nicht-EU-Staaten in der NATO zu vermeiden. Dies betrifft vor allem die Türkei. Sie ist aufgrund ihrer geostrategischen Lage ein wichtiger Bündnispartner Washingtons, dessen Einfluss auf europäische Belange schon deswegen nicht gemindert werden sollte, damit sich am Bosporus nicht doch die islamistischen Kräfte durchsetzen.
Aber auch die anderen NATO-Staaten, die nicht der EU angehören, hätten - so wird in Washington argumentiert - im NATO-Vertrag eine gegenseitige Beistandsverpflichtung akzeptiert. Diese würde im Falle eines EU-Militärengagements wirksam werden, falls die beteiligten Staaten nicht allein mit der militärischen Lage fertig würden. Insofern müssten die NATO-Staaten, die nicht der EU angehören, von vornherein in den Entscheidungsprozess einbezogen werden.
Viele dieser amerikanischen Einwände und Argumente sprechen dafür, die Beziehungen zwischen NATO und EU zu verbessern. Bisher hielt die EU zweimal pro Halbjahr formelle Treffen mit denjenigen europäischen NATO-Staaten ab, die nicht der EU angehören, um sie über den Fortgang der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu informieren. Der NATO-Generalsekretär Robertson und der Hohe Repräsentant der EU für die GASP Solana trafen sich informell zweimal monatlich.
Doch blieben diese Mechanismen unterentwickelt. Viele europäische Politiker, darunter auch in Deutschland, forderten daher einen verbesserten Dialog zwischen NATO und EU, ja sogar eine Formalisierung der Beziehungen. Diesbezüglich war Frankreich zunächst skeptisch. Es weigerte sich, gemeinsame Institutionen aufzubauen, solange die EU-Streitkräfteplanung noch nicht abgeschlossen ist. Offensichtlich fürchtete Paris den amerikanischen Einfluss auf europäische Belange.
Auf dem EU-Gipfel in Feira im Juni 2000 wurden jedoch Ad-Hoc Arbeitsgruppen zwischen der EU und der NATO beschlossen. Sie sollen u.a. die Aufgabe haben, eine EU-NATO Sicherheitsvereinbarung vorzubereiten. Außerdem sollen künftig regelmäßige Treffen zwischen den 15 EU-Staaten sowie denjenigen 15 europäischen Staaten, die in der NATO, aber nicht in der EU sind bzw. Aufnahmekandidaten der EU sind, stattfinden. Zusätzlich wurden regelmäßige Sitzungen zwischen den 15 EU-Staaten und den 6 europäischen NATO-Staaten, die nicht der EU angehören, vereinbart. Offenbar um französischen Bedenken entgegenzukommen, wurde in den Leitprinzipien für alle Gesprächsformate festgehalten, dass der autonome Entscheidungsprozess der EU respektiert bleibt.
Jenseits aller institutionellen Akrobatik dürfte sich der Dialog zwischen NATO und EU nicht zuletzt deswegen schwierig gestalten, weil sich diesseits und jenseits des Atlantik in den vergangenen Jahren unterschiedliche sicherheitspolitische Diskurse entwickelt haben. Dies betrifft sowohl die Einschätzung von Bedrohungen als auch die Instrumente zum Umgang mit ihnen. So halten Europäer die amerikanischen Befürchtungen im Hinblick auf die Verbreitung von ABC-Waffen und modernen Trägertechnologien oft für übertrieben. Stattdessen konzentriert sich Europa fast ausschließlich auf ethnische Konflikte wie auf dem Balkan. Während in Washington Rüstungskontrolle von vielen nicht mehr als wesentliches Element der Sicherheitspolitik angesehen wird, hält Europa an ihrer überragenden Bedeutung fest. Amerika setzt eher auf militärische Instrumente, wie zum Beispiel auf Raketenabwehr. Europa bleibt dahingehend zögerlich und hebt eher die Bedeutung des politischen Dialoges mit Staaten wie Iran hervor. Mit anderen Worten: seit dem Ende des Kalten Krieges stimmen Amerikaner und Europäer in vielen sicherheitspolitischen Fragen weniger überein als zuvor.
Verteidigungsidentität
Das Verhältnis der EU zur NATO wird auch davon abhängen, ob die Europäer über die militärische und nicht-militärische Krisenbewältigung hinaus tatsächlich eine Verteidigungsidentität anstreben. Der Vertrag von Amsterdam spricht eine solche Möglichkeit zwar an, gleichzeitig verweist er jedoch auf die NATO als Instrument der kollektiven Verteidigung. Eng damit verknüpft ist die Frage, ob die WEU langfristig in der EU aufgehen wird. Dies wurde auf dem Kölner EU-Gipfel avisiert, doch inzwischen haben die WEU-Außenminister auf ihrem Treffen im Mai 2000 in Porto beschlossen, dass die WEU als Beistandspakt bis auf weiteres erhalten bleiben soll.
Kritischer Punkt ist, dass die EU bislang nur die „Petersberg-Aufgaben" der WEU, also die verschiedenen Elemente der Krisenbewältigung, übernommen hat, nicht jedoch die im Art. 5 WEU-Vertrag festgelegte kollektive Beistandspflicht. Während einige EU-Staaten wie besonders Frankreich, aber auch Spanien, eine möglichst baldige Integration von EU und WEU als wünschenswert ansehen, lehnen dies andere ab. Dazu gehören die neutralen EU-Staaten Finnland, Schweden, Irland und Österreich, die bei einer vollständigen EU-WEU-Integration ihren neutralen Status aufgeben müssten. Dazu zählt aber auch Dänemark, das alle Fragen, die mit der kollektiven Verteidigung zusammenhängen, bei der NATO belassen möchte.
Andere EU-Staaten, die gleichzeitig der EU und der NATO angehören wie Portugal, Italien oder die Niederlande, und traditionell eher transatlantisch orientiert sind, sehen zwar seit Jahren im Zuge der Krisenbewältigung auf dem Balkan die Notwendigkeit entsprechender europä-ischer Instrumente ein, sind aber bei der Frage der Übertragung der kollektiven Verteidigungselemente auf die EU vorsichtig. Sie möchten die USA nicht vorzeitig verprellen und plädieren pragmatisch dafür, die in Helsinki beschlossenen Ziele für die Schaffung europäischer Fähigkeiten zur Krisenbewältigung zunächst umzusetzen. Zu dieser Gruppe gehört auch Deutschland. Großbritannien wiederum möchte die EU wohl auf jeden Fall auf die Krisenbewältigung beschränken und ihr keine kollektiven Verteidigungsaufgaben übertragen.
In der Tat wäre ein vollständiges Aufgehen der WEU in der EU nicht nur wegen der kollektiven Verteidigung, sondern auch insofern problematisch, als die WEU eine Zwitterstellung einnimmt. Sie ist zugleich Verteidigungskomponente der EU und Forum für gesamteuropäische Verteidigungs- und Sicherheitsfragen.
Seit dem Ende des kalten Krieges hat die WEU eine komplexe Struktur ihrer Mitgliedschaft entwickelt. Sie umfasst derzeit insgesamt 28 Staaten mit unterschiedlichem Status: 10 Vollmitglieder, die alle sowohl in der NATO als auch in der EU sind. 6 assoziierte Mitglieder, die in der NATO, aber nicht in der EU sind; 5 Beo-bachter, die in der EU, aber nicht in der NATO sind (zu dieser Gruppe gehört als Sonderfall auch Dänemark, das beiden Institutionen, nicht aber der WEU angehört), und 7 assoziierte Partner, die weder in der EU noch in der NATO sind, aber mit der EU ein Europa-Abkommen getroffen haben. Nur die 10 Vollmitglieder haben in allen Entscheidungsprozessen volles Stimmrecht.
Während die WEU also ein kompliziertes Geflecht der Beziehungen zu nicht-Vollmitgliedern entwickelt hat, basiert die EU auf der klaren Unterscheidung zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern. Dies bedeutet nicht nur, dass diejenigen EU-Staaten, die nur WEU-Beobachter sind (Finnland, Schweden, Dänemark, Irland und Österreich) im Falle der vollen Integration von WEU und EU alle Elemente beider Institutionen übernehmen müssten, sondern dass umgekehrt die Rechte derjenigen Staaten, die derzeit assoziierte WEU-Mitglieder sind (Tschechien, Ungarn, Island, Norwegen, Polen und die Türkei) betroffen wären. Diese Länder nehmen derzeit an den WEU-Ratssitzungen teil (ohne Veto-Recht) und haben Rede- und Vorschlagsrecht, es sei denn, eine Mehrheit der Vollmitglieder widerspricht. Ebenfalls nehmen sie an WEU-Arbeitsgruppen teil. Das Kommunikationssystem der WEU ist für sie zugänglich. Falls sich keine Mehrheit der WEU-Vollmitglieder dagegen ausspricht, können sie darüber hinaus an WEU-Operationen und Übungen teilnehmen. Im Falle einer EU-WEU-Integration wäre es fraglich, ob diese Staatengruppe so weitreichende Rechte beibehalten könnte.
Sollte die EU in den kommenden Jahren eine Verteidigungsidentität anstreben, so würden über die bereits angesprochenen Fragen hinaus eine Reihe weiterer Probleme zu lösen sein.
Dies betrifft erstens die Frage, ob die EU-Staaten bei der Sicherheitspolitik zu einer weitgehenden Aufgabe ihrer nationalen Souveränität bereit sein würden. Besonders Großbritannien und Frankreich mit ihrer herausgehobenen Stellung als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und Besitzer von Kernwaffen legen hier noch einige Zurückhaltung an den Tag.
Zweitens wäre das Problem der parlamentarischen Kontrolle zu lösen. Denn die Parlamentarische Versammlung der WEU könnte nicht ohne weiteres in die EU überführt werden, während umgekehrt das Europäische Parlament derzeit noch kaum über außen- und sicherheitspolitische Kompetenzen verfügt. Derzeit behalten sich nationale Parlamente der EU-Mitglieder im Falle von Militäreinsätzen vor, darüber zunächst abzustimmen. Eine entsprechende Verlagerung der Entscheidungsgewalt auf die europäische Ebene ist derzeit nicht abzusehen.
Drittens bleibt noch ungeklärt, welche Rolle die französischen und britischen Kernwaffen in einer europäischen Verteidigungsidentität spielen sollten. Diese Frage ist bereits weit diesseits einer möglichen, bislang aber noch nicht avisierten europäischen Abschreckungsfunktion für diese Kernwaffen politisch relevant. So verfolgen die EU-Staaten Schweden und Irland im Rahmen einer Gruppe von Staaten mit dem Titel „Coalition for a New Agenda" sehr viel weitreichendere nukleare Abrüstungsziele als Frankreich und das Vereinigte Königreich.
Dies schließlich weist viertens auf das grundsätzliche Problem fortbestehender nationaler Interessen hin, die überwunden werden müssten, sollte eine wirkliche europäische Verteidigungsidentität angestrebt werden. Aber so wie sich Schweden und Irland eine gewisse Unabhängigkeit bei der nuklearen Abrüstungspolitik bewahren wollen, zeigt sich Finnland anders als alle andere EU-Staaten derzeit nicht bereit, auf Landminen gänzlich zu verzichten. Es verweist dabei auf seine lange Grenze mit Russland. Während - drittes Beispiel - die meisten EU-Staaten einen amerikanisch-russischen Kompromiss hinsichtlich einer Änderung des ABM-Vertrages zur Begrenzung der Raketenabwehr begrüßen würden, strebt Frankreich dies nicht unbedingt an, da es befürchtet, dadurch könnte die Bedeutung seiner Nuklearstreitkräfte negativ betroffen werden.
Fünftens schließlich bleibt die Frage des geografischen Anwendungsgebietes einer EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik offen. Während die USA von den Europäern erwarten, dass diese sich auch außerhalb Europas militärisch engagieren, wenn dies nötig ist, bleiben die meisten Europäer ihrerseits hier zurückhaltend. Aber Frankreich und Großbritannien könnten wegen ihrer aus der Kolonialzeit stammenden überseeischen Interessen durchaus das Ziel verfolgen, europäische Sicherheitspolitik auch außerhalb Europas zu betreiben.
Schluss
Die EU hat sich auf den Weg gemacht, auch sicherheits- und verteidigungspolitisch an Bedeutung zu gewinnen. Dies ist auch dringend nötig, sollen künftige Krisen erfolgreicher bewältigt werden, als dies auf dem Balkan bisher der Fall war.
Zunächst hat sich die EU sehr ehrgeizige Ziele bei der militärischen und der nicht-militärischen Krisenbewältigung gesetzt. Sie zu erfüllen, wird Aufgabe der kommenden Jahre sein. Ob die EU darüber hinaus eine Verteidigungsidentität entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Noch sind sich die Europäer keineswegs in dieser Frage wirklich einig.
Politisch bedeutsam werden die Beziehungen zur NATO und zu den Vereinigten Staaten sein. Europa sollte hier alles vermeiden, was zu einer ernsthaften Belastung der transatlantischen Beziehungen führen könnte. Denn Amerika bleibt bei der Bewältigung europäischer Krisen und Konflikte vorerst unverzichtbar. Dennoch die Emanzipation von Washington so weit voranzutreiben, dass auch eigenständiges europäisches Handeln möglich wird, darin wird die diplomatische Kunst bestehen. Solange Europa jedoch dafür nicht die konkreten Voraussetzungen u.a. in Form von militärischen Fähigkeiten geschaffen hat, bleibt die Debatte um eine europäische sicherheitspolitische Selbständigkeit ohnehin akademisch.
Mittel- bis langfristig kann eine Stärkung Europas zu einer Stärkung der transatlantischen Beziehungen führen. Denn eine NATO, in der das Gefälle zwischen den USA einerseits und Europa andererseits immer größer würde, wäre auf die Dauer zum Scheitern verurteilt.
Wichtig wird aber die Übergangsphase sein. Die Europäer sollten es vermeiden, durch zu weitreichende Rhetorik von einer sicherheitspolitischen Unabhängigkeit amerikanische Senatoren zu verschrecken, die dann im Gegenzug womöglich den Abzug der US-Truppen aus Europa fordern würden. Wesentlich dürfte auch ein verbesserter transatlantischer Dialog über diejenigen Fragen und Probleme sein, bei denen es in den letzten Jahren eher zur Entfremdung gekommen ist. Dies betrifft die Herangehensweise an das Problem der Verbreitung von ABC-Waffen und weitreichenden Trägertechnologien. Die Rolle, die der Rüstungskontrolle dabei zukommen soll, bedarf dringend der Diskussion. Insbesondere muss vermieden werden, dass sich die derzeitige Debatte um die Raketenabwehr und der Prozess der Bildung eigenständiger europäischer verteidigungspolitischer Strukturen und Instrumente in einer Weise gegenseitig negativ verstärken, dass am Ende der Atlantik breiter wird.
Insgesamt werden sowohl Amerikaner als auch Europäer lernen müssen, sich allmählich auf unterschiedliche Rollenverteilungen einzustellen: die Europäer, mehr Verantwortung zu übernehmen, die Amerikaner, Macht im größerem Umfang als bisher zu teilen.
Literatur
Christian Busse, Die Beziehungen zwischen EU und WEU - Zugleich ein Beitrag zur Eigenart des europäischen Integrationsprozesses, in: Sicherheit und Frieden Nr. 1/2000, S. 75-79.
Matthias Dembinski, Die EU mit eigener Verteidigungsidentität - Ein Beitrag zum Frieden?, in: Ulrich Ratsch/Reinhard Mutz/Bruno Schoch (Hrsg.), Friedensgutachten 2000, Münster/Hamburg/London 2000, S. 109-118.
Hans-Georg Ehrhart, France and NATO: Change by Rapprochement? Asterix’ quarrel with the Roman Empire, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, Hamburger Beiträge zur Friedensforschung und Sicherheitspolitik Nr. 121, Januar 2000.
Gustav E. Gustenau, Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - eine Herausforderung für die „Post-Neutralen", in: Österreichische Militärische Zeitschrift Nr. 1/2000, S. 25-38.
Franz-Josef Meiers, Der europäische Sicherheitspfeiler. Stein des Anstoßes für die USA, in: Internationale Politik Nr. 3/2000, S. 43-48.
Peter Schmidt, Neuorientierung in der europäischen Sicherheitspolitik? Britische und britisch-französische Initiativen, Stiftung Wissenschaft und Politik, Januar 1999.
Peter Schmidt, ESDI: „Separable but not separate?", in: NATO Review Nr.1/2000, S. 12-15.
Stanley R. Sloan, The United States and European Defense, Western European Union Institute for Security Studies, Chaillot Papers Nr. 39, Paris: April 2000.
Peter-Michael Sommer, Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in: Europäische Sicherheit Nr. 12/1999, S. 14-17.
Alexander Vershbow (U.S. Permanent Representative to NATO), Next Steps on European Security and Defense: a US View,http:www.nato.int/usa/ambassador/s991217a.htm
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | April 2001