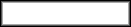
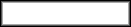
III. Politische Perspektiven
III.1. Arbeit für alle in einer zukunftsorientierten Wirtschaft
(1) Arbeit bestimmt die Entfaltung der Persönlichkeit und des Selbstwertgefühls, des Selbstbewußtseins der Menschen. Alle Formen gesellschaftlich notwendiger Arbeit, auch Familien- und Gemeinschaftsarbeit, müssen daher - insbesondere zwischen Männern und Frauen - gerecht und solidarisch verteilt werden.
(2) Die Erwerbsarbeit vermittelt soziale Anerkennung, bestimmt Lebenschancen und sichert materielle Unabhängigkeit. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ist daher heute die wichtigste Aufgabe der Sozialdemokratie, Vollbeschäftigung bleibt unser oberstes Ziel.
(3) Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten geht es aber auch um die inhaltliche Weiterentwicklung von Erwerbsarbeit zu einer befriedigenden, dauerhaft existenzsichernden, eigenverantwortlichen und gleichberechtigten Tätigkeit im sozialen Zusammenhang.
(4) Eine humane Arbeitswelt setzt - für beide Geschlechter - die Vereinbarkeit von Beruf und Familie voraus. Wir setzen uns für Arbeitszeitregelungen sowie für die Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen ein, die den Bedürfnissen sowohl der Kinder als auch der Eltern entsprechen. Diese Einrichtungen müssen allen, unabhängig von ihrer sozialen Situation, zugänglich sein.
(5) Für uns ist der Mensch der Maßstab des Wirtschaftens. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmerinnen und Unternehmer haben ein gemeinsames Interesse an einer starken Wirtschaft, haben aber auch in vielen Bereichen unterschiedliche Interessen, wie z.B. im Bereich der Einkommensverteilung. Wir wollen diese Interessensgegensätze partnerschaftlich überwinden, weil wir der Überzeugung sind, daß nur faire Verhältnisse im Arbeitsleben eine geeignete Basis für eine gute soziale und wirtschaftliche Entwicklung darstellen, was im Interesse aller am Wirtschaftsprozeß Beteiligten gelegen ist. Wir wollen Veränderungen aktiv gestalten, wir wollen Mut zum Wandel und wir wollen Sicherheit im Wandel bieten. Nur dadurch wird es möglich sein, daß Veränderungen nicht als Bedrohung abgewehrt und verweigert, sondern als Chance begriffen und angenommen werden.
(6) Im Arbeitsprozeß selbst geht es uns um die Sicherung fairer Partnerschaft und Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die auf einem partnerschaftlichen Modell der betrieblichen und überbetrieblichen Steuerung beruhende Wirtschaftsweise hat gerade in Österreich bewiesen, daß hohe Produktivität und soziale Gerechtigkeit vereinbar sein können.
(7) Steigende Lebensqualität, soziale Sicherheit und Vollbeschäftigung beruhen auf einer leistungsfähigen Volkswirtschaft. Daher besteht ein gemeinsames Interesse aller an der Leistungskraft und internationalen Wettbewerbsstärke der österreichischen Wirtschaft. Politik kann und soll nicht den Einsatz und die Initiative der in der Wirtschaft Tätigen ersetzen. Auf der Basis einer vernünftigen Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bzw. deren jeweiligen Interessenvertretungen sowie den politisch Verantwortlichen können aber jene Rahmenbedingungen geschaffen werden, die steigenden Wohlstand und dessen gerechte Verteilung sowie neue Arbeit und bessere Verteilung der bestehenden Arbeit möglich machen.
(8) Funktionierende Märkte und fairer Wettbewerb leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Wohlstands durch ihren Zwang zu effizienter und preiswerter Erbringung von Leistungen und Gütern im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir treten daher für offene Märkte und gegen bestehende und neue Monopole mit ihren Nachteilen und Kosten ein. Ein modernes Wirtschafts- und Kartellrecht hat daher die Aufgabe, das Funktionieren des Markts zu gewährleisten. Wo die Bedürfnisse der Menschen durch den Markt nicht sozial gerecht befriedigt werden können, treten wir für die Regulierung der Marktkräfte beziehungsweise für die Erbringung oder Bereitstellung von Leistungen durch die öffentliche Hand ein.
(9) Der Ertrag wirtschaftlichen Handelns muß gerecht verteilt werden. In einer solidarischen Gesellschaft muß nicht die Gleichheit, sondern die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen ihre Rechtfertigung beweisen. In diesem Sinne akzeptieren wir Einkommensunterschiede, die durch besondere Leistung, Belastung oder Verantwortung begründet werden. Aber auch diese müssen dort ihre Grenzen finden, wo sie das Prinzip der gleichen Teilnahme an der Gesellschaft infrage stellen. Wir treten für ein System von Steuern und Abgaben sowie von sozialen Transferleistungen ein, das eine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung gewährleistet.
(10) Wir treten im Interesse der gerechten Verteilung von Arbeits- und Einkommenschancen für eine den spezifischen Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit ein. Dies bedeutet in erster Linie eine Unterstützung der Gewerkschaften bei ihren diesbezüglichen Initiativen, aber auch die Stärkung individueller Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Verbindung des Arbeitslebens mit Bildungszeiten und Freizeitblöcken. Durch eine bessere Verteilung der Arbeitszeit wollen wir auch erreichen, daß Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht vorzeitig aus dem Erwerbsprozeß gedrängt werden.
(11) Wir setzen uns für eine Qualifizierungsoffensive ein, insbesondere für ein breites Angebot an lebensbegleitenden Chancen des zusätzlichen Erwerbs von Bildung und Qualifikation sowie für entsprechend gesicherte Bildungsfreistellungen und -karenzen - mit begleitenden Förderungsmaßnahmen.
(12) Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist eine zentrale politische Aufgabe, deshalb treten wir für aktive Arbeitsmarktpolitik ein. Arbeitslose dürfen nicht einfach sich selbst und den mit der Arbeitslosigkeit verbundenen psychischen und wirtschaftlichen Problemen überlassen werden. Wir wollen ihnen mit gezielten Maßnahmen ermöglichen, daß sie wieder eine Tätigkeit finden, die Selbstwertgefühl und Anerkennung gibt. Insbesondere bekennen wir uns daher zu Maßnahmen, die Frauen den Einstieg, den Wiedereinstieg und das Fortkommen im Beruf erleichtern. Wir treten für die öffentliche Förderung von Arbeit ein, die nicht marktvermittelt nachgefragt oder erbracht werden kann, aber konkrete Lebensbedürfnisse befriedigt.
(13) Wir befürworten eine gezielte Wachstumspolitik, staatliche Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, steuerliche und geldpolitische Maßnahmen, die Investitionen in den produktiven Sektor begünstigen und spekulativen Kapitaleinsatz auf nationalen und internationalen Finanzmärkten belasten. Wir befürworten die steuerliche Entlastung des Faktors Arbeit und die Belastung des Verbrauchs natürlicher und nicht vermehrbarer Ressourcen. Wir treten dafür ein, die Finanzierung des Sozialversicherungssystems auf eine breitere Basis zu stellen, die auch andere Elemente der Wertschöpfung enthält.
(14) Um Wohlstand und soziale Sicherheit zu erhalten sowie um die Nutzung der neuesten Entwicklungen in Wissenschaft und Wirtschaft zu gewährleisten, setzen wir uns für eine verantwortliche und gesellschaftlich kontrollierte und mitfinanzierte Forschung im Interesse der Menschen ein. Wir treten für eine Vernetzung der Klein- und Mittelbetriebe ein, damit sie gemeinsam in die Lage versetzt sind, europaweit und mit entsprechenden Forschungseinrichtungen zu kooperieren und so ihre Wettbewerbschancen zu erhöhen.
(15) Die Sicherstellung österreichischer Entscheidungszentren in wichtigen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen ist von besonderer Bedeutung, um so die Grundlage der Weiterentwicklung von Produkten und Leistungen, aber auch der Qualifikation von Beschäftigten in Wirtschaft und Wissenschaft im Lande zu halten. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für einen österreichischen Beitrag in einer weltoffenen, auf Partnerschaft, Kooperation und Wettbewerb angelegten Wirtschaft, aber auch für die längerfristige Sicherung von Beschäftigungschancen.
(16) Eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik hat sowohl auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene der Makroökonomie als auch auf der Ebene der Struktur- und Wettbewerbspolitik anzusetzen. Gesamtwirtschaftlich bedeutsam ist vor allem die Sicherung einer dem Ziel der Vollbeschäftigung entsprechenden Nachfrage bei gleichzeitiger Bedachtnahme auf Preisstabilität. Entsprechende Maßnahmen müssen auf nationaler Ebene, vor allem aber auch auf europäischer Ebene, getroffen werden und eine funktionierende Koordination der Wirtschafts- und Sozialpolitik sicherstellen.
(17) Durch eine sich selbst überlassene Internationalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen steigt der Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dem Arbeitsmarkt billig und flexibel zur Verfügung zu stehen. Um ein verantwortungsvolles Wirtschaften im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Konsumentinnen und Konsumenten zu gewährleisten, wollen wir auf internationaler Ebene gleiche Rahmenbedinungen für die Weiterentwicklung der Wirtschaft schaffen. Die Konvergenz sozial-, arbeitsmarkt-, fiskal- und umweltpolitischer Steuerungsmaßnahmen auf möglichst hohem Niveau ist deshalb für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten unumgänglich. Zur Umsetzung dieses Grundsatzes bedarf es der internationalen Stärkung sozialdemokratischer Parteien und der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmervertretung.
(18) Gemeinsam mit den europäischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sowie anderen, die unsere Wert- und Zielvorstellungen teilen, wollen wir ein soziales und wettbewerbsfähiges Europa verwirklichen. Wir wollen die Harmonisierung der Steuersysteme vorantreiben, um eine gerechte Verteilung bei der Finanzierung der Staatsaufgaben sicherzustellen. Auch die abgestimmte Ökologisierung der europäischen Steuersysteme wollen wir durchsetzen.
(19) Der Prozeß der Globalisierung der Wirtschaft bietet für die davon betroffenen Menschen sowohl Chancen als auch Risiken. Unser sozialdemokratisches Wirtschaftsmodell der solidarischen Leistungsgesellschaft verbindet Leistungsfähigkeit mit sozialer Sicherheit und setzt auf Innovation durch partnerschaftliches Wirtschaften. Das Zusammenspiel dieser Eigenschaften bestimmt den Gesamterfolg unseres Modells im globalen Wettbewerb der Systeme.
III.2. Innovation im gesellschaftlichen Interesse - Wissenschaft, Forschung und Technologieentwicklung im 21. Jahrhundert
(1) Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen Wissenschaft und Forschung positiv und aufgeschlossen gegenüber. Nur wenn Österreich in die internationale Dynamik der Wissenschaft und Forschung eingebunden ist, können die wirtschaftliche und geistige Dynamik unseres Landes aufrechterhalten werden.
(2) Innovative und demokratisch gesinnte Kräfte in Wissenschaft, Forschung und Technik sind Schrittmacher für die Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Ihre Leistungen sehen wir als Chance, unsere Gesellschaft humaner und demokratischer zu gestalten und die Lebensqualität aller Menschen zu erhöhen. Denn technologische und soziale Innovation ist notwendig, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, um Arbeitsbedingungen zu verbessern, um umweltschonender zu produzieren, um medizinischen Fortschritt zu erzielen, um den Zugang und den Austausch von Information zu erleichtern oder um das Verstehen von Gesellschaften und Kulturen zu vertiefen.
(3) Technologische Innovation braucht Akzeptanz durch die Gesellschaft. Modernisierung durch Forschung und Technik wird von den Menschen nur als Chance anerkannt werden, wenn klar ist, daß der Fortschritt ihnen nutzt. Als Bürgerinnen und Bürger, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, als Konsumentinnen und Konsumenten müssen sie die Sicherheit haben, daß sich diese Modernisierung nicht gegen ihre Interessen richtet, sondern ihnen Vorteile bringt. Technologischer Fortschritt muß sich an diesem gesellschaftlichen Leitbild orientieren und gesellschaftlicher Kontrolle unterliegen. Damit wissenschaftliche Forschung im Dienste der Menschen und der Gesellschaft betrieben und eingesetzt wird, müssen Forschung und Industrie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.
(4) Wissenschaft und Forschung müssen auch den geistigen und sozialen Fortschritt zum Ziel haben. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Veränderungen muß ein Schwerpunkt der Wissenschaftspolitik sein. Gleichzeitig gilt es sicherzustellen, daß die Menschenwürde gewahrt wird, sowie Risiken für Gesundheit und Umwelt vorzubeugen; strenge Vorsorge- und Haftungsregeln sind deshalb unverzichtbar.
(5) Wir befürworten die gezielte, effiziente und verantwortungsbewußte Förderung von Wissenschaft und Forschung als Investition in die Zukunft. Wir wollen die verstärkte Zusammenarbeit in diesem Bereich auf internationaler Ebene sowie die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft besonders unterstützen. Wir wollen Forschung und Technologieentwicklung in allen zukunftsorientierten Bereichen intensivieren und ihren betriebsübergreifenden und grenzüberschreitenden Austausch auf der Ebene der Betriebe unterstützen. Anreize dafür zu schaffen, ist zentrale Aufgabe der Technologiepolitik.
(6) In unserer Gesellschaft wird Wissen immer mehr zum wichtigen Standortfaktor der modernen Wirtschaft. Bildung und Information werden zu noch wichtigeren gesellschaftlichen Werten; die Gewichte verschieben sich von der Produktion industrieller Güter hin zur Entwicklung, Verarbeitung und Vermarktung von Wissen und Information. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien verändern nicht nur die gesellschaftlichen und kulturellen Beziehungen, sie ermöglichen auch die Entwicklung eines neuen Wirtschaftssektors, als Feld neuer und zusätzlicher Beschäftigung. Wir erkennen die Chancen und die großen Entwicklungspotentiale dieser Technologien, werden ihren Ausbau besonders fördern, aber auch die Risken analysieren und dafür sorgen, daß alle Menschen am neuen Reichtum an Wissen und Information und der Steigerung ihrer Lebensqualität teilhaben können. Damit setzen wir einen wesentlichen Schritt in Richtung Demokratisierung des Wissens.
(7) Wir wollen dafür sorgen, daß diese neuen Technologien zum Nutzen der Menschen verwendet werden und daß es nicht zu einer neuen Spaltung in eine Klasse der Informationsreichen und eine Klasse der Informationsarmen kommt. Dabei ist darauf zu achten, daß Privatsphäre und Konsumenteninteressen geschützt, allen ein finanziell leistbarer und angemessener Zugang zu den Informationstechnologien sichergestellt wird und durch eine Reform des Aus- und Weiterbildungssystems vor allem junge Menschen auf die neuen digitalen Möglichkeiten und Herausforderungen vorbereitet werden. Gemeinsam mit Industrie und Wissenschaft müssen flächendeckende, einfach zugängliche Kommunikationsnetze rasch entwickelt werden.
III.3. In Sicherheit leben - Dimensionen der Wohlfahrtsgesellschaft
(1) Gerade in Zeiten rapiden gesellschaftlichen Wandels, in denen von allen Menschen mehr Bereitschaft zur Veränderung, zu Mobilität und Flexibilität gefordert wird, sind Gesellschaft und Staat gefordert, für die Sicherheit der existentiellen Lebensgrundlagen zu sorgen. Nur auf Basis dieser Sicherheit sind gesellschaftlicher Zusammenhalt, sozialer Frieden und die Voraussetzungen für die freie Entfaltung jedes und jeder Einzelnen gewährleistet.
(2) Sicherheit und Wohlfahrt verstehen wir dabei in einem sehr umfassenden Sinne: Das Ziel der Vollbeschäftigung gehört ebenso dazu wie solidarische Sicherungssysteme für Alter, Krankheit, Behinderung, Unfall und Arbeitslosigkeit sowie ein sozial gerechtes System von Transferleistungen. Bewährte Prinzipien unseres Sozialsystems, wie Selbstverwaltung, Pflichtversicherung, Umlageverfahren und Bundesbeitrag, dürfen nicht zerschlagen werden. Wirkungsvoller Schutz vor Armut, sozialer Ausgrenzung, Gewalt und Verbrechen, zufriedenstellende Wohnverhältnisse sowie ein Bildungssystem, das niemanden ausschließt, sind weitere unverzichtbare Elemente.
(3) Menschen mit Behinderungen, Opfer von Unfällen, chronisch Kranke und andere Benachteiligte haben einen Anspruch auf Hilfe und Betreuung, sodaß ihre Lebensqualität und Leistungsfähigkeit durch Ausbildung, durch Behandlung und Rehabilitation sowie durch spezifische Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt so weit wie möglich wiederhergestellt wird. Sie haben auch einen Anspruch auf ein gesellschaftliches Umfeld, das ihnen zusätzliche Erschwernisse erspart. Ziel aller Maßnahmen muß sein, diesen Menschen gleiche Möglichkeiten der Teilnahme an der Gesellschaft zu ermöglichen.
(4) Wir sind überzeugt, daß ein leistungsstarker und finanziell gesunder Staat im Interesse aller Menschen gelegen ist. Nur er kann insbesondere den Schwächsten in der Gesellschaft helfen, nur er kann jenes soziale Netz spannen, das diejenigen auffängt, die die Solidarität der Gesellschaft brauchen, ob aus Gründen der Arbeitslosigkeit, der Behinderung, des Alters oder der Krankheit. Reformen, die diese Funktion des Staates langfristig absichern, werden von uns deshalb aktiv gestaltet. Wir verstehen ein starkes soziales Netz nicht als gnädigen Akt gegenüber den Schwächeren in unserer Gesellschaft, sondern als wichtiges Instrument für die gerechte Verteilung des gemeinsam erwirtschafteten Wohlstands. Hinter den Forderungen, dieses Netz aufzuknüpfen oder gar zu zerreißen, steht Unwissen, kurzsichtiger Egoismus, Neid oder Interesse an der Spaltung der Gesellschaft. Solche Forderungen werden auch in Zukunft auf entschiedenen Widerstand der Sozialdemokratie stoßen.
(5) Wir wollen aber ständig überprüfen, ob die einzelnen Elemente des Wohlfahrtsstaates auch optimal leisten, was sie leisten sollen. Es muß darauf geachtet werden, daß tatsächlich denen geholfen wird, die in Notlage geraten sind. Zur Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger gehört auch die Bereitschaft, im Rahmen gegebener Möglichkeiten selbst vorzusorgen, der verantwortungsvolle Gebrauch von Leistungen der Gemeinschaft sowie die Pflicht, sich persönlichen und finanziellen Beiträgen für die Gemeinschaft nicht zu entziehen.
(6) Wir befürworten eine Verlagerung der verwendeten Mittel in Richtung Vorbeugung und Vorsorge statt nachträglicher Behandlung. Wir treten für die Angleichung und Harmonisierung sämtlicher Elemente der solidarisch finanzierten sozialen Sicherung ein - auch der heute noch berufständisch unterschiedlichen Versicherungssysteme.
(7) Wir wollen allen Menschen ermöglichen, erschwinglichen Wohnraum zu bekommen. Öffentliche Wohnungspolitik muß den sozialen Wohnbau forcieren und Förderungen nach dem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit einsetzen. Auch den sozial Schwächsten und Betreuungsbedürftigen muß menschenwürdiges Wohnen ermöglicht werden. Klare, die Rechte der Wohnungsbenützerinnen und -benützer schützende Regeln sind für alle Wohnformen zu gewährleisten. Unser besonderes Augenmerk gilt daher auch einem sozialen Mietrecht.
(8) Der Wohlfahrtsstaat muß eine gesicherte Basis für alle Menschen schaffen. Nur eine sichere Existenz schafft die Grundlage für Selbstbestimmung, Selbstbewußtsein und Freiheit. Eine moderne Wohlfahrtsgesellschaft besteht aber nicht nur aus dem staatlichen Sozialsystem. Eine solidarische Gesellschaft muß von den Menschen selbst gewollt und gelebt werden. Soziale Sicherheit läßt sich mit Transferleistungen allein nicht sicherstellen, sondern braucht auch vernetzte soziale Dienste zur Erbringung von Sachleistungen sowie das Engagement und die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger selbst. Ehrenamtliches Engagement, private gemeinnützige Einrichtungen spielen eine wichtige Rolle. Initiativen, die sich im sozialen Sinn für Benachteiligte einsetzen, verdienen - als wertvolle Ergänzung zu unserem Sozialsystem - daher Unterstützung und Förderung.
III.4. Hohe Lebensqualität in einer humanen Umwelt
(1) Wir tragen sowohl der Umwelt als auch den nachfolgenden Generationen gegenüber Verantwortung. Um unsere Umwelt lebenswert zu erhalten, dürfen wir nicht mehr an Ressourcen verbrauchen als wir ersetzen oder wieder erneuern können, müssen wir den Schadstoffausstoß auf ein erträgliches Maß zurückführen und Risiken, die nicht wieder gut zu machende Schäden für die Umwelt auslösen können, vermeiden. Eine in diesem Sinne verstandene ökologische Nachhaltigkeit ist eine Leitlinie unseres politischen und wirtschaftlichen Handelns.
(2) Nachhaltigkeitsstrategien müssen jedoch stets auf soziale Gerechtigkeit und Verteilungsfragen Rücksicht nehmen. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten steht fest, daß es hohe Lebensqualität nicht ohne hohe Umweltqualität gibt - für alle Menschen, und nicht nur für einige wenige.
(3) Zentrale umweltpolitische Zielsetzungen sind die Reduktion der Schadstoff- und Lärmbelastung sowie die gezielte Förderung des öffentlichen Verkehrs und umweltverträglichen Güterverkehrs.
(4) Wir treten für ein Verkehrssystem ein, das am Wohl der Menschen, den Entwicklungsmöglichkeiten der Wirtschaft und der geographischen Lage Österreichs in der Mitte Europas orientiert ist. Wir unterstützen mit Nachdruck die Schaffung transeuropäischer Schienennetze unter Einbindung des österreichischen Verkehrsnetzes. Wir treten für ein Finanzierungssystem ein, das Transportbedürfnisse umwelt- und anrainergerecht erfüllen hilft und damit den unfairen finanziellen Wettbewerb zwischen verschiedenen Verkehrsträgern überwinden hilft.
(5) Eine zukunftsorientierte internationale Verkehrspolitik muß sich an der Kostenwahrheit im Verkehr und der Anwendung des Verursacherprinzips orientieren. Dem Bedürfnis der Menschen nach einer sauberen Umwelt und nach sicheren und zuverlässigen Verkehrsmitteln ist durch eine bessere Balance zwischen den einzelnen Verkehrsarten durch spezielle Maßnahmen für den Personenverkehr, den öffentlichen Personennahverkehr und den Güterverkehr nachzukommen.
(6) Mit der Verbesserung der Mobilität, der Forcierung des umweltfreundlichen Schienenverkehrs, der Schiffahrt und des nichtmotorisierten Verkehrs, der frühest möglichen Nutzung des jeweiligen Standes der Technik zur Vermeidung von Negativwirkungen des Verkehrs und durch bewußtseinsbildende Maßnahmen kann dieses Ziel erreicht werden. Wir fordern eine nationale und internationale Verkehrsplanung, die mit der Energiewirtschaft und der Raumplanung abzustimmen ist. Regionale Verkehrskonzepte müssen die Bedürfnisse der Menschen besser und kundennäher erfassen.
(7) Nachhaltig Wirtschaften ist für uns auch Leitbild für die Landwirtschaft. Bäuerinnen und Bauern erbringen wichtige Leistungen für die Gesellschaft, besonders in benachteiligten Gebieten und in den Bergregionen. Die finanzielle Förderung der Landwirtschaft wollen wir verstärkt nach sozialen und ökologischen Kriterien gestalten. Wir wollen eine Land- und Forstwirtschaft, die möglichst schadstoffrei produziert. Grundwasser, Boden und Luft müssen geschützt, Beeinträchtigungen durch wirkungsvolle Maßnahmen beseitigt werden. Dem Verursacherprinzip ist dabei Rechnung zu tragen. Natur- und Tierschutz sind Teil unserer solidarischen Gesellschaftskonzeption.
(8) Wir treten für die Bevorzugung umweltfreundlicher Formen der Energiegewinnung ein und wollen jedenfalls auf Nukleartechnologie verzichten. Den Ausstieg aus der Atomkraft wollen wir auch auf internationaler Ebene vorantreiben.
(9) Die Erhaltung und Schonung natürlicher Ressourcen und die erhebliche Reduktion der Umweltbelastung durch Schadstoffe und Abfälle soll unter anderem durch eine umfassende Ökologisierung des Steuersystems (Ressourcenbesteuerung bei gleichzeitiger Entlastung des Faktors Arbeit), durch eine ökologische Modernisierung des Industriesystems, die auch die Herstellung langlebiger, reparierbarer und wiederverwertbarer Produkte forciert, und durch strenge Haftungsregeln und Schutzbestimmungen erreicht werden.
(10) Umweltprobleme sind immer seltener ausschließlich auf nationalstaatlicher Ebene zu lösen, internationale Zusammenarbeit ist notwendig - nicht nur im Sinne einer gemeinsamen europäischen Strategie, sondern auch auf globaler Ebene. Umweltbelastung darf im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung nicht in weniger entwickelte Länder exportiert werden. Um diese Länder in ihrer Verantwortung für den globalen Umweltschutz zu unterstützen, sind entsprechende Technologietransfers und Umweltinvestitionen vordringliche Aufgaben der Industriestaaten.
(11) Der Sicherung gleicher Lebenschancen dient ein umfassendes Gesundheitssystem. Es muß der Vielfalt der Anforderungen entsprechen, insbesondere im Bedarfsfall rasche und leicht zugängliche Betreuung für alle gewährleisten und eine regional ausgewogene und hochwertige Versorgung sicherstellen. Zur Weiterentwicklung eines hochwertigen Gesundheitswesens gehört auch die besondere Berücksichtigung von frauenspezifischen Gesundheitsproblemen. Insbesondere sind Maßnahmen zu entwickeln, die den gesundheitsschädlichen Folgen der Doppel- und Dreifachbelastung der Frauen Rechnung tragen.
(12) Weil Gesundheit und Krankheit nicht allein genetisch gesteuert, sondern vor allem auch Ergebnis von Lebensumständen und sozialen Bedingungen sind, ist es umso wichtiger, Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbehandlung nach sozialmedizinischen und ganzheitlichen Gesichtspunkten auszurichten.
(13) Das Gesundheitswesen ist für die Patientinnen und Patienten da - und nicht umgekehrt. Es ist daher stets aufs Neue dem sich ändernden Bedarf der Menschen anzupassen. Seine Leistungen müssen auch in Zukunft allgemein zugänglich sein. Für eine "Zwei-Klassen-Medizin" ist in einem sozialen Gesundheitswesen kein Platz.
(14) Gesundheit hat ihren Preis, aber Gesundheit um jeden Preis ist weder heute noch in Zukunft finanzierbar. Daher sind gleichermaßen Planungsinstrumente, die eine bedarfsorientierte Vorsorge sichern, wie Qualitätssicherung und der Ausbau der Medizinethik in der Berufsausbildung und im praktischen Alltag notwendig.
(15) In Zukunft wird eine noch engere berufs- und fachübergreifende Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe unter Einbeziehung bewährter komplementärer Methoden erforderlich sein. Auch deshalb treten wir für die universitäre Verankerung der Pflegewissenschaft ein.
(16) Gesundheitsförderung und Krankheitsbehandlung greifen immer mehr ineinander. Schon heute sind Gesundheitsförderung und Präventivmedizin aus einem modernen Gesundheitswesen nicht wegzudenken. Wir treten für regionale Gesundheitsförderungsprogramme auf einer möglichst breiten gesellschaftlichen Basis ein, die zwischen dem, was der bzw. die Einzelne für ihre oder seine Gesundheit tun kann, und dem, was gemeinschaftlich getan werden muß, klar unterscheiden. Zu wirksamer Gesundheitsvorsorge gehört es, von den möglichen gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums von Alkohol, Nikotin oder Drogen zu überzeugen. Gesundheitsvorsorge kennt keine Altersgrenzen.
(17) Umfassende Prävention schließt den Schutz der Gesundheit in der Arbeitswelt ein, insbesondere mittels Maßnahmen zur Unfallverhinderung sowie durch verstärkte arbeitsmedizinische und betriebsärztliche Versorgung und Vorsorge. Wir setzen uns für Arbeitsbedingungen ein, die körperliche oder psychische Schäden so weit wie möglich ausschließen.
(18) Wir setzen uns für einen wirksamen Konsumentenschutz ein, der die Verbraucherrechte auf dem Produkt- und Dienstleistungssektor sicherstellt. Ein solcher Schutz beschränkt sich nicht auf die Abwehr unlauterer Praktiken, sondern muß faire Beziehungen zwischen Konsumentinnen und Konsumenten einerseits und Unternehmerinnen und Unternehmern andererseits gewährleisten.
(19) Die Instrumente der Konsumentenpolitik sind vielschichtiger geworden: Die Förderung von Wettbewerb und Transparenz hat besonders in bislang abgeschotteten Marktnischen an Bedeutung gewonnen, ebenso wie die umfassende Information der Verbraucherinnen und Verbraucher und ihre frühzeitige Einbindung in für sie wichtige Entwicklungen. Daneben bleiben gesetzliche Regelungen zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten notwendig. Die Durchsetzung ihrer Rechte muß im außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren erleichtert werden.
(20) Wir wollen eine Vielzahl von ökologisch verträglichen Freizeitmöglichkeiten fördern, die zu einer aktiven, schöpferischen und gesundheitsfördernden Lebensgestaltung beitragen. Der Tourismus soll auf die Lebensinteressen der ansässigen Bevölkerung und der in diesem Bereich Beschäftigten abgestimmt sein und unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, des Schutzes von Natur und Landschaft gestaltet werden.
(21) Sport hat eine hohe Bedeutung für die Erhaltung und Förderung der Gesundheit. Das Erleben von Gemeinschaft und das Streben nach Leistung mit fairen Mitteln dient dem sozialen Lernen und dem Abbau von Aggression. Deshalb unterstützen wir besonders den Breiten- und Schulsport, wobei der gleiche Zugang zum Sport - für beide Geschlechter sowie für alle sozialen Gruppen - gewährleistet sein muß. Der Spitzensport verdient Förderung, soweit er die Jugend zur sportlichen Betätigung motiviert.
III.5. Gleichstellung der Frauen als demokratisches Ziel -Partnerschaft der Geschlechter in einer Gesellschaft der Chancen
(1) Es bleibt für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ein zentrales Ziel, die gesellschaftlichen Bedingungen so zu gestalten, daß Frauen und Männer dieselben Chancen und Möglichkeiten haben. Frauen werden noch immer individuelle, soziale, wirtschaftliche und politische Entwicklungschancen verwehrt.
(2) Die strukturell bedingte Benachteiligung von Frauen muß durch aktive Gleichstellungspolitik konsequent abgebaut und schließlich beseitigt werden. Aktive Gleichstellungspolitik bedeutet gerechte Umverteilung von Arbeit, Einkommen und Macht zwischen Männern und Frauen.
- Umverteilung von Arbeit heißt, die vorhandene bezahlte und unbezahlte Arbeit zwischen Männern und Frauen solidarisch zu teilen,
- Umverteilung von Einkommen heißt, eine gerechte Lohn-, Steuer-, Finanz-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik zu verwirklichen,
- Umverteilung von Macht schließlich meint die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern an allen gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen.
(3) Die Arbeit, ein Beruf, somit ein eigenes Einkommen bringen für Frauen ein Mehr an Unabhängigkeit - auch von falschen Rollenerwartungen, die an sie gestellt werden. Erwerbsarbeit bedeutet für Frauen in jeder Lebensphase Entscheidungsfreiheit, Identität und Selbstbestimmung.
(4) Arbeit ist der Schlüssel zur Gleichstellung. Frauen kommen bei der bezahlten Arbeit als der besten Voraussetzung eigenständiger Existenzsicherung, zu kurz, tragen aber den überwiegenden Teil der unbezahlten Arbeit im Haushalt, in der Betreuung der Kinder und in der Pflege von Angehörigen. Ziel unserer Politik ist es, Frauen zu ermöglichen, ihre Chancen im Beruf aktiv zu ergreifen, sowie diese falsch verteilten Gewichte ins richtige Lot zu bringen. Die Vorbildwirkung jedes Einzelnen in der eigenen Familie und die Erziehung zu gleichberechtigtem Miteinander ist für diese Entwicklung wesentlich.
(5) Die ungleichen Rollenzuschreibungen sind auch Ursache der eklatanten Lohn- und Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Erst die gerechte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit sowie die gleiche Teilnahme von Frauen und Männern an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen wird auch zu einer gerechten Verteilung der Einkommen führen.
(6) Frauen wissen um ihre Fähigkeiten, sehen ihre Möglichkeiten. Aber die Gesellschaft, wie wir sie jetzt kennen, läßt vielfach noch immer nicht zu, daß sie Rechte und Chancen, die ihnen zustehen, auch ergreifen. Uns geht es darum, diese "gläserne Decke" zu durchbrechen und den Weg frei zu machen für alle Frauen.
(7) Frauenförderung - im Sinne einer aktiven Gleichstellungspolitik - bedeutet daher für uns, klare, gesetzlich verankerte Bedingungen zu schaffen, die es Frauen ermöglichen, ihre Qualifizierung zu verstärken sowie ihre Qualifikationen in berufliche Tätigkeit und beruflichen Aufstieg umzusetzen. Uns geht es darum, den Frauen Bildungs- und Berufswege mit Zukunftschancen zu eröffnen und Rollenklischees zu überwinden. Frauen und Männer sollten alle Berufe, entsprechend ihren Neigungen und Interessen, wählen können.
(8) Aktive Gleichstellungspolitik bedeutet für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch, daß Frauen bei Personalentscheidungen bei gleicher Qualifikation bevorzugt behandelt werden, solange gesellschaftliche Ungleichheit existiert. In diesem Sinne bekennen wir uns zur positiven Diskriminierung, also zu einer gerechten Bevorzugung von Frauen bei Personalentscheidungen im öffentlichen Bereich und zur Koppelung von Auftragsvergabe und Förderungen aus der öffentlichen Hand an Maßnahmen zur Frauenförderung im privatwirtschaftlichen Bereich.
(9) Das setzt - für beide Geschlechter - die Vereinbarkeit von Beruf und Familie voraus. Kinderbetreuungseinrichtungen, die den Bedürfnissen sowohl der Kinder als auch der Eltern gerecht werden, sind dafür notwendig. Arbeitszeitmodelle, die es für beide Elternteile möglich machen, sich für eine bestimmte Zeit aus dem Berufsleben zurückziehen, damit sie sich zu gleichen Teilen der Erziehung und Betreuung der Kinder widmen können, sind zu schaffen.
(10) Unterschiedliche Lebensbedingungen von Frauen führen zu ungleichen Chancen, die Diskriminierung setzt sich auch im Alter oft noch verschärft fort. Ein gerechtes System der Alterssicherung kann sich also nicht nur an den durchschnittlichen Lebensläufen von Männern orientieren. Wir treten daher für eine eigenständige Alterssicherung für Frauen ein, die einerseits auf deren Lebensverläufe Rücksicht nimmt und andererseits innerhalb unseres Solidarsystems auf Berufstätigkeit und Beitragsleistungen aufbaut.
(11) Als Ausweg aus einer Zwangslage muß Frauen in ganz Österreich die Möglichkeit offenstehen, eine ungeplante oder unerwünschte Schwangerschaft innerhalb einer medizinisch vertretbaren Frist sowie unter bestmöglicher medizinischer, psychologischer und sozialer Betreuung abzubrechen. Wir treten allen Tendenzen entgegen, die dieses Recht einschränken oder in Frage stellen und verurteilen reaktionäre Gruppierungen, die Frauen in einer Zwangslage zur Zielscheibe ihrer Agitation machen.
(12) Im Sinne einer Partnerschaft der Geschlechter bekennen wir uns zur Ächtung jedweder Gewalt gegen Frauen. Wir fordern wirksame Maßnahmen zum Schutz der Frauen vor Gewalt in der Familie, vor sexueller Belästigung oder vor verharmlosender bzw. verherrlichender Darstellung solcher Formen von Gewalt und Verachtung in den Medien.
(13) Auch auf internationaler Ebene wollen wir den Kampf für das Recht der Frauen auf ein Leben in Würde und auf Gleichstellung führen. Jede Form der Unterdrückung, Diskriminierung und Ausbeutung lehnen wir ab. Wir unterstützen aktiv die internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Frauenhandels in all seinen Formen, wie sexuelle Ausbeutung, Heiratshandel oder Ausbeutung von Migrantinnen in Arbeitsverhältnissen, in denen sie wie Sklavinnen behandelt werden.
(14) Die im Rahmen der Gleichstellung der Geschlechter angestrebten Ziele unterscheiden sich nach dem sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Umfeld. So können im Kampf um Geschlechterdemokratie unterschiedliche Prioritäten gesetzt werden. Grundvoraussetzung für eine Partnerschaft der Geschlechter ist aber immer das Recht auf Selbstbestimmung, auf freie Wahl der Lebensform ebenso wie das Recht auf Arbeit, auf soziale Absicherung und auf ein Leben in Würde. Es geht - im Lichte der heutigen Gegebenheiten - um eine Umverteilung der Rechte in Richtung der Frauen und um eine Umverteilung der Pflichten in Richtung der Männer.
III.6. Solidarisches Miteinander der Generationen
(1) Unsere Gesellschaft kennzeichnet ein tiefgreifender demographischer Wandel sowie eine beträchtliche Veränderung des Generationenverhaltens. Steigende Lebenserwartung und stagnierende Geburtenzahlen erhöhen das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Aufgrund verbesserter sozialer Bedingungen können Menschen länger aktiv bleiben, es schließen sich an das Erwerbsleben weitere Lebensabschnitte an. Insgesamt verwischen sich die Grenzen zwischen Jugend, Erwerbsleben und den verschiedenen Stufen des Alters immer mehr, und auch die einzelnen Generationen werden differenzierter und uneinheitlicher.
(2) Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stellen uns diesem gesellschaftlichen Wandel, der gelebte Generationensolidarität braucht, um ein hohes Maß an Lebensqualität für alle sicherstellen zu können. Unser politisches Ziel ist es, sowohl den Lebensinteressen aller Altersgruppen bestmöglich zu entsprechen als auch das Verständnis und den Austausch zwischen den Generationen in einer "Gesellschaft des langen Lebens" zu unterstützen. Für eine neue generationenübergreifende Politik folgt daraus, daß wir Jugendpolitik und Politik für die Älteren nicht als isolierte Bereiche ansehen dürfen.
(3) Denn die Bedingungen, unter denen wir aufwachsen und leben, bestimmen und prägen nicht nur unsere ökonomische Lage, sondern auch unsere Gewohnheiten, Werte und Ansprüche bis ins hohe Alter. Ob jemand in Würde altern kann, wird nicht erst im Alter bestimmt; vielfach sind schon frühere Lebensabschnitte entscheidend. Politisch aktive Seniorinnen und Senioren etwa sind in der Regel schon früher politisch interessiert gewesen und haben die entsprechenden Anforderungen und Möglichkeiten bereits ab der Jugendzeit erfahren und gelernt. Integrative Politik der Generationen umfaßt deshalb in ihrem vollen Verständnis die Bereiche des Bildungssystems, des Arbeitslebens, der Familienverhältnisse, der Gesundheit, der Gestaltung des Lebensumfelds, der kulturellen, sozialen und politischen Teilhabe und der ökonomischen Sicherung und Vorsorge.
(4) Kinder sind nach unserer Überzeugung Bürgerinnen und Bürger mit eigenständigen Rechten, nämlich dem Recht auf Zuwendung, Betreuung inner- und außerhalb der Familie und Ausbildung, dem Recht, so zu leben und sich so zu verhalten, wie sie es selbst wollen, sowie dem Recht auf Schutz vor Gewalt. Das Fördern von Fähigkeiten, Kreativität, Kritikfähigkeit und Selbstbewußtsein ist eine wichtige Voraussetzung für die Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten im ganzen Leben.
(5) Jugendliche müssen reale Möglichkeiten der Mitbestimmung und der politischen Beteiligung erhalten, damit sie ihre Wünsche, Ansichten und Ziele einbringen und im demokratischen Prozeß der Willensbildung auch umsetzen können. Die ersten Erfahrungen mit demokratischen Entscheidungsprozessen sind für junge Menschen für ihr Leben prägend. Deshalb treten wir für die Einbeziehung von Jugendlichen in demokratische Entscheidungsprozesse ein. Politik mit Jugendlichen statt nur für Jugendliche sichert im Sinne umfassender Demokratie, daß die Anliegen der Jugend im politischen Leben ernst genommen werden. Wir wollen die SPÖ zu einer Plattform für die Beteiligung Jugendlicher am politischen Prozeß entwickeln. Auch der sich entwickelnden Kinder- und Jugendlichenkultur soll ensprechender Raum gegeben werden.
(6) Unsere Gesellschaft ist zusehends geprägt von vielfältigen Formen menschlichen Zusammenlebens. Als politische Kraft für Freiheit und gegen Bevormundung sehen wir es als Bereicherung, daß sich immer weniger Menschen in traditionelle Verhaltensmuster zwängen lassen. Wir unterscheiden nicht zwischen "besseren" und "schlechteren" Formen des Zusammenlebens, für uns sind das Wohl der Menschen, insbesondere der Kinder, das Selbstbestimmungsrecht des Menschen und seine soziale Verantwortung entscheidend.
(7) Wir verstehen unter Familie jede Form des dauernden Zusammenlebens in partnerschaftlicher und demokratischer Form, die den einzelnen Mitgliedern dieser Gemeinschaft Solidarität, Anteilnahme und Schutz bietet. Wir wollen die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, um die Lebensbedingungen der Familien weiter zu verbessern und eine familien- und kindergerechte Gesellschaft schaffen. Jede Form der Familie ist vom Staat durch eine Mischung aus Transfer- und Sachleistungen, steuerlichen Maßnahmen und sozialversicherungsrechtlichen Leistungen zu unterstützen. Dabei müssen soziale Gesichtspunkte und daher die Unterstützung einkommensschwacher Familien - oft Jungfamilien, Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher sowie Mehrkindfamilien - Vorrang haben. Im Mittelpunkt hat das Wohl des Kindes zu stehen.
(8) Da wir dafür eintreten, neben den traditionellen Formen der Familie auch andere Formen des Zusammenlebens lebbar zu machen, muß dies auch deren schrittweise gesetzliche Anerkennung zur Folge haben. Bestehende Diskriminierungen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind in Richtung rechtlicher Gleichstellung zu überwinden.
(9) Die verschwimmenden Grenzen zwischen Jugend, Erwerbsleben und Alter erfordern auch flexible Antworten auf diese neuen Herausforderungen. Dazu gehören die Förderung des lebensbegleitenden Lernens, Modelle des gleitenden Übergangs in die Pension ebenso wie anderen Formen der Weitergabe von beruflicher Erfahrung nach Ende des Erwerbslebens an Jüngere, aber auch Wohnformen, die den Bedürfnissen unterschiedlicher Altersgruppen entsprechen und somit verhindern, daß besonders im dichtverbauten Raum nach Generationen getrennte Wohnzonen entstehen. Auch mit Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, die nicht nur auf Seniorinnen und Senioren fixiert sind, wollen wir die Integration der verschiedenen Generationen unterstützen.
(10) Wir treten dafür ein, ältere Menschen in Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse aktiv einzubeziehen. Die Mitbestimmung der älteren Generation muß auf allen politischen Ebenen durch Partizipationsmodelle gewährleistet sein, die den spezifischen Bedürfnissen des Alters entsprechen.
(11) Wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, die es älteren Menschen erlauben, möglichst lange aktiv, selbständig und im von ihnen bevorzugten Umfeld zu leben und dieses mitzugestalten. Wesentliche Voraussetzung für ein Altern in Würde ist materielle Sicherheit. Wir treten daher für ein gerechtes und effizientes Pensionssystem - einschließlich einer eigenständigen Alterssicherung für Frauen - ein. Wir bekennen uns zu sozial vertretbaren Reformen und strukturellen Anpassungen zum Zweck der langfristigen Absicherung, um Rückschläge in der Alterssicherung zu verhindern.
(12) Der Generationenvertrag stellt für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nach wie vor das gesellschaftliche Fundament einer stabilen Alterssicherung dar. Um die Solidarität zwischen den Generationen nachhaltig zu stärken, sollen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der Wertschöpfung, zusätzliche Formen der Finanzierung entwickelt werden. Betriebliche und individuelle Vorsorge stellen Ergänzungen der gesetzlichen Altersversorgung dar.
(13) Menschen, die im hohen Alter krank sind und leiden, haben ein Recht auf menschenwürdige Betreuung. An ihren körperlichen und seelischen Bedürfnissen orientierte und erschwingliche Formen der Pflege wollen wir für sie gewährleisten, wobei sich die Pflege daheim, ambulante Formen der Betreuung und stationäre Einrichtungen ergänzen.
(14) Zur Würde des menschlichen Lebens zählt auch die Würde des Sterbens. Daher treten wir für humane Sterbebegleitung und für eine offene Diskussion aller damit zusammenhängenden Probleme ein, lehnen aber Tötung auf Verlangen ab.
III.7. Soziale Demokratie leben - für Mitbestimmung und integrative Politik
(1) Nur die Weiterentwicklung der politischen zur wirtschaftlichen, und damit zur sozialen Demokratie schafft die Voraussetzung für die Verwirklichung unserer Grundwerte. In der sozialen Demokratie durchdringen demokratische Prinzipien alle Bereiche der Gesellschaft. Insofern ist der Prozeß der Demokratisierung eine permanente Aufgabe, die niemals an einem Endpunkt angelangt sein wird.
(2) Demokratie ist die einzig menschliche und humane Form der Organisierung des Zusammenlebens der Menschen, aber sie ist empfindlich und verletzbar. Sie muß daher gewollt, verteidigt und weiterentwickelt werden.
(3) Zum Herzstück der Demokratie gehört ein funktionierender Parlamentarismus auf den verschiedenen Ebenen unseres Staates. Diese repräsentative parlamentarische Demokratie – also die durch allgemeine, gleiche, freie und geheime Wahlen legitimierte, zeitlich begrenzte Berechtigung, Entscheidungen in der Gemeinschaft zu treffen - wird ergänzt durch die demokratische Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger und durch Bürgerbeteiligung. Darüber hinaus spielen außerparlamentarische Organisationen und Initiativen, in denen sich Bürgerinnen und Bürger zur Vertretung gemeinsamer Interessen zusammenschließen, eine wachsende Rolle und sollen entsprechende Beachtung im Prozeß der politischen Willensbildung finden.
(4) Demokratie braucht Öffentlichkeit. Demokratische Entscheidungsprozesse und die demokratische Kontrolle staatlicher und politischer Macht beruhen aus unserer Sicht darauf, daß Bürgerinnen und Bürger Zugang zu allen wesentlichen Informationen haben, unterschiedliche Interessen erkennen, artikulieren und bewerten sowie Mitwirkungsrechte wahrnehmen können.
(5) Wir setzen uns für eine Erweiterung demokratischer Rechte ein, durch die mehr Bürger und Bürgerinnen bei sie unmittelbar betreffenden Fragen kontrollieren, mitwirken bzw. mitentscheiden können. Uns geht es bei diesen neuen Modellen der Bürgerentscheidung um eine Ergänzung der Elemente der repräsentativen Parteiendemokratie im Sinne des stärkeren Engagements für die Angelegenheiten der Gemeinschaft. Die neuen Medien bieten eine Möglichkeit, verstärkt partizipatorische Aktivelemente zu fördern und einzubeziehen.
(6) Demokratische Prinzipien haben auch für die Berufswelt zu gelten, wo Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen über ihre Interessensvertretung mitbestimmen, aber auch darüber hinaus bei Entscheidungen einbezogen werden müssen. Ebenso wollen wir im privaten Leben partnerschaftliches Denken und Handeln unterstützen.
(7) Der in jeder Demokratie herrschende Grundsatz der Mehrheitsentscheidung hat seine Grenze dort, wo es um unveräußerliche Rechte von Minderheiten oder Einzelpersonen geht. Die Rechte von Minderheiten auf ihre Identität stehen als solche nicht zur Disposition einer Mehrheit. Aber auch Minderheiten dürfen nicht grundlegende Menschenrechte des Individuums verletzen.
(8) Die österreichische Identität wird nachhaltig auch durch die historisch gewachsene sprachlich-kulturelle und ethnische Vielfalt unseres Staates geprägt. Es ist für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten selbstverständlich, den Bestand sowie die kulturelle und sprachliche Entwicklung dieser Minderheiten zu unterstützen.
(9) Das Zusammenleben zwischen Minderheiten und Mehrheit erfordert die Förderung des Geistes der Toleranz und des Dialogs sowie Maßnahmen zur Förderung der gegenseitigen Achtung, des gegenseitigen Verständnisses und der Zusammenarbeit zwischen allen Menschen unabhängig von deren ethnischer, kultureller, sprachlicher oder religiöser Identität.
(10) Dies schließt insbesondere unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, für deren Integration im politischen Leben, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie im Bildungs- und Sozialsystem wir eintreten.
(11) Im Sinne einer stärkeren Demokratisierung der Europäischen Union setzen wir uns für eine tiefgreifende Reform der EU und ihrer Institutionen zur Durchsetzung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger ein. Es geht darum, dem Souverän, den Bürgerinnen und Bürgern Europas, vermehrte Entscheidungsrechte zu sichern.
(12) Wir setzen uns für die weltweite Verwirklichung demokratischer Grund- und Freiheitsrechte ein und führen gemeinsam mit anderen Demokraten den Kampf gegen alle Formen von Unfreiheit, Diskriminierung, gegen Terror, Todesstrafe und Folter. Außerdem treten wir für die Wahrung der Menschenrechte einschließlich des Rechtes auf Asyl im Falle der Verfolgung aus politischen, religiösen, rassischen oder sonstigen Gründen ein.
III.8. Dienstleistung statt Bürokratie - für ein modernes Staatsverständnis
(1) Der Staat hat für den Interessensausgleich in der Gesellschaft zu sorgen, um den sozialen Zusammenhalt und die soziale Sicherheit und damit das friedliche Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Die Organe des Staates und deren Handeln müssen demokratisch legitimiert sein. Ein dauerhafter innerer Frieden der Gesellschaft kann nur durch Anwendung von allgemein anerkannten fairen Regeln und die gerechte und gleiche Behandlung der Bürgerinnen und Bürger erreicht werden.
(2) Wir glauben nicht, daß der Rückzug des Staates ein Wert an sich ist. Wir sind überzeugt, daß Deregulierung als Selbstzweck zu einer Spaltung der Gesellschaft führen kann. Wir sehen aber ebenso klar die Gefahr eines Übermaßes an Regulierung und Bürokratie, das die Menschen in ihrer Freiheit einengt statt ihnen zu helfen. Wir glauben, daß der Weg zu einem zukunftsorientierten Staatswesen nicht von mehr oder weniger Regeln, sondern von besseren und sinnvollen Regeln bestimmt wird.
(3) Wir brauchen einen aktiven, das heißt einen leistungsfähigen und effizienten Staat, der seine Abläufe an zeitgemäßen Modellen orientiert: Es muß mehr Autonomie, Eigeninitiative und Entscheidungsverantwortung des und der Einzelnen, entsprechend flachere Hierarchien sowie mehr Kundenorientierung und mehr Leistungsorientierung geben.
(4) Wir treten daher für eine Umgestaltung der Beziehungen zwischen Staat und Bürgerinnen bzw. Bürgern ein. Ihnen muß dabei mehr Freiraum und Eigenständigkeit eingeräumt werden. In diesem Zusammenhang treten wir für eine Erweiterung des Prinzips ein, daß dem Schwächeren stärkere Rechte gegeben werden. Das gilt nicht nur für die Geschäfte des täglichen Lebens und die Gewährleistung fairer Austauschverhältnisse, das gilt auch für all die Fragen des Schutzes der Umwelt, der Gesundheit usw, in denen Beweisschwierigkeiten den Schwächeren sehr leicht um sein Recht bringen.
(5) Im demokratischen Rechtsstaat kann es nur Macht geben, die durch das Recht legitimiert und begrenzt ist. Rechtsprechung soll dem Bedürfnis nach Gerechtigkeit dienen. Der Rechtsstaat bindet die Ausübung der Macht an Recht und Gesetz. Die Bindung an die demokratische Verfassung, an Gewaltenteilung und gegenseitige Machtkontrolle legitimiert die staatliche Befugnis zur Durchsetzung der Rechtsordnung und zur Ausübung des Gewaltmonopols.
(6) Funktionen des demokratischen Rechtsstaats sind es, die Grund- und Menschenrechte umfassend zu sichern, eine humane Ordnung aufbauen und sichern zu helfen, dem sozialen Ausgleich zu dienen, den Schutz der Schwächeren zu gewährleisten und einen wirkungsvollen Beitrag zum Schutz vor Kriminalität zu leisten. Eine freie, gerechte und solidarische Gesellschaft muß jedem Menschen garantieren, daß er rechtzeitig und mit zumutbaren Kosten zu seinem Recht kommt. Lange Verfahren sind daher eine Form der Rechtsverweigerung. Hohe Kosten schließen sozial Schwächere vom Rechtsstaat praktisch aus. Die Erleichterung des Zugangs zum Recht und die Beseitigung sozialer Schranken bei seiner Durchsetzung bleiben daher eine zentrale Aufgabe sozialdemokratischer Politik.
(7) Gleichheit vor dem Gesetz und Gleichheit durch das Gesetz sind unverzichtbar, müssen aber auch im Vollzug der Gesetze wahrgenommen und durchgesetzt werden. Wir treten daher für ausgleichende Rechte zur Wahrung der Chancengleichheit ein. Wir befürworten eine weitere Entwicklung der Verbandsklage und der Gemeinschaftsklagmöglichkeiten zugunsten benachteiligter Gruppen (z.B. in Gleichbehandlungsfragen, aber auch bei Arbeitsrechtsansprüchen). Wir treten daher für eine Weiterentwicklung von Recht und Rechtsprechung zu mehr Prävention, für eine verstärkte zivilrechtliche Ordnungsautonomie der Bürger untereinander und für weniger obrigkeitsstaatliche Verwaltungsinstrumente ein.
(8) Im Rahmen umfassender Sicherheit haben alle Menschen das Recht auf wirksamen Schutz vor Kriminalität. Wir bekennen uns zum Kampf gegen die Kriminalität, wissen aber, daß eine Gesellschaft nicht umso sicherer ist, je härtere Strafen sie androht und verhängt. Ein erfolgreicher Kampf gegen Kriminalität hat wesentlich früher einzusetzen als im Gerichtssaal und wesentlich länger anzudauern als die Freiheitsstrafe eines Verurteilten.
(9) Dazu gehört vor allem der Kampf gegen die Ursachen von Kriminalität. Das Zurückdrängen von Arbeitslosigkeit, ein wirksames soziales Netz, ein funktionierendes Bildungssystem, gezielte Integrations- und Jugendarbeit wirken den sozialen Wurzeln von Kriminalität entgegen. In der direkten Verbrechensbekämpfung wollen wir durch bessere Ausstattung, bessere Aus- und Weiterbildung der Exekutive und verstärkte internationale Kooperation die besten Voraussetzungen schaffen.
(10) Der Schutz der Gesellschaft setzt auch ein modernes Strafrecht voraus, in dem den Interessen der Verbrechensopfer besondere Bedeutung zugemessen wird. Ein zeitgemäßer Strafvollzug ist die beste Gewähr gegen eine neue Straffälligkeit. Modelle des außergerichtlichen Tatausgleichs und der integrativen Sozialarbeit müssen weiterentwickelt werden.
(11) Die Unabhängigkeit der Justiz und ihrer Richter sind in gleicher Weise Basis jedes Rechtsstaates wie die freie Ausübung anderer Rechtsberufe. In einer Demokratie bedürfen sie jedoch auch der demokratischen Kontrolle. Der demokratische Charakter der Justiz ist insgesamt zu stärken, auch in der Laiengerichtsbarkeit, die insbesondere durch eine bessere Ausbildung der Laienrichter gestärkt werden soll.
(12) Im österreichischen Katalog an Grund- und Freiheitsrechten fehlen soziale Grundrechte nach wie vor zur Gänze. Wir fordern daher die Schaffung eines modernen Grundrechtskatalogs, der Basis einer modernen, sozialen, freien, gerechten und solidarischen Gesellschaft sein wird. Dieser Grundrechtskatalog hat nicht nur die Beziehungen zwischen Bürgerinnen bzw. Bürgern und Staat neu zu ordnen, sondern auch das Zusammenleben der Menschen unter Wahrung ihrer Würde und des gegenseitigen Respekts voreinander zu gestalten. Dieser Grundrechtskatalog wird daher auch stärker die Praxis der Justiz zu prägen haben.
(13) Wir lehnen die Privatisierung von staatlichen Aufgaben in all den Bereichen, in denen es um Grundrechtsschutz oder Grundrechtseingriffe geht, ab. Dies sind unverzichtbare Staatsaufgaben, die der demokratischen Kontrolle und Legitimation unterliegen müssen.
(14) Auf Basis seiner demokratischen Legitimation muß der Staat definieren, welche Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden sollen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten treten hier für klare Orientierung am Wohl der Bürgerinnen und Bürger, d.h. an der Qualität der Leistungen und an effizienter und preiswerter Aufgabenwahrnehmung ein. Ob Leistungen gemein- oder privatwirtschaftlich erbracht werden, ist danach zu entscheiden, wer bei vergleichbaren arbeits-, sozial- und umweltrechtlichen Bedingungen die Anforderungen in Bezug auf Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit am besten erfüllt, wobei vor allem auch der gesamtgesellschaftliche Nutzen berücksichtigt werden muß. Monopolistisches Verhalten lehnen wir auch auf diesem Feld ab.
III.9. Bildung als Chance der Entfaltung aller Fähigkeiten des Menschen und der Gesellschaft - die Zukunft unseres Bildungssystems
(1) Wir treten für eine Gesellschaft ein, in der alle Menschen gleiche Chancen der Entwicklung finden, und arbeiten daher für ein Bildungssystem, das Möglichkeiten und Anlagen der Menschen entdeckt und entwickelt sowie Kritikfähigkeit und Solidarität fördert. Bildung und Ausbildung sind grundlegende Elemente einer Kultur des Zusammenlebens und der Toleranz sowie zugleich zentraleVoraussetzung, den Lebensstandard auch unter den Bedingungen weltweiten Wettbewerbs zu halten.
(2) Bildung bestimmt auch wesentlich den Grad an Reife, der eine demokratische Gesellschaft auszeichnet. Menschen, die Bildung als Chance erlebt und gelernt haben, sich selbst Meinungen zu bilden, sind in der Regel besser gerüstet gegen Denken in Schwarz-Weiß-Mustern, politische Verhetzung und Demagogie. Bildung hat in der sich verändernden Welt bei der Zuweisung von Lebenschancen eine immer größer werdende Bedeutung. Deshalb wollen wir ein Bildungssystem, das im Zusammenwirken mit Wirtschafts- und Sozialpolitik dazu beiträgt, soziale Gerechtigkeit, Solidarität und aktive Mitgestaltung von politischen Prozessen zu fördern.
(3) Bildung ist die Grundlage, um sich in einer Welt der immer rascheren Veränderung selbst und gemeinsam mit anderen Menschen zurecht zu finden. Wir treten daher für ein Bildungsangebot ein, das neben Fachwissen und Berufsvorbereitung auch fachübergreifendes Denken, soziale Kompetenz und kulturübergreifende Kooperationsfähigkeit entwickeln hilft. Bildung ist die Voraussetzung, um Chancen in der Gesellschaft wahrzunehmen, und ist damit der Schlüssel für ein selbstbestimmtes, selbstgestaltetes Leben.
(4) Wir wollen daher ein Bildungssystem, das Neugier, Lust am Lernen, Eigenständigkeit sowie Interesse an anderen Menschen und an der Welt fördert, das Ängste abbauen und Mut entwickeln hilft. In diese Richtung gilt es das bestehende Bildungssystem weiterzuentwickeln. Wir wollen weg vom Disziplinieren, hin zum Wecken von Interesse, weg vom Auswählen besonders "Geeigneter", hin zum optimalen Fördern aller in den Menschen steckenden Möglichkeiten, weg vom bloßen Beseitigen von Schwächen, hin zum gezielten Entwickeln von Stärken.
(5) Unsere Perspektive geht weg vom unreflektierten Eingeben und Abrufen von Fakten- und Datenwissen, hin zum Vermitteln der Fähigkeit, neues Wissen richtig zu verarbeiten und anzuwenden, weg vom reinen Frontalunterricht, hin zu Unterrichtsformen, durch die Bildungsinhalte aktiv erarbeitet und die Entwicklung der Persönlichkeit sowie die Bereitschaft zur Diskussion und zur demokratischen Willensbildung gefördert werden. Das Prinzip des gemeinsamen Lernens muß vor dem der individuellen Leistung stehen.
(6) In diesem Zusammenhang treten wir dafür ein, die Chancen und Potentiale von Mädchen und Buben jeweils voll zu entwickeln. Die Erziehung vom Kindergarten bis zu den Universitäten soll unter Bedachtnahme auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse gemeinsam sein (geschlechtersensible Koedukation). Chancengleichheit heißt hier auch ausgleichende Fördermaßnahmen zu entwickeln und regelmäßig zu überprüfen.
(7) Wir sehen Bildung als soziales Grundrecht aller Menschen. Lernende haben ein Recht auf ein Bildungssystem und auf Bildungsangebote, die ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und die der Staat zu sichern und in einer Weise zu finanzieren hat, die gleiche Chancen aller Menschen gewährleistet. Wir arbeiten daher auch weiterhin an der Herstellung von Chancengleichheit, wo heute noch ökonomische, soziale, geografische, geschlechtsspezifische, sprachlich-kulturelle oder andere Hürden oder Vorurteile gleichen Zugang zu den Bildungseinrichtungen und ihre Inanspruchnahme behindern. Das Bildungsangebot muß Menschen mit besonderen Problemen ebenso berücksichtigen wie besonders Begabte und Leistungsfähige. In diesem Zusammenhang ist uns vor allem die Integration von Menschen mit Behinderungen in unser Bildungssystem ein zentrales Ziel.
(8) Vor dem Hintergrund des europäischen Integrationsprozesses treten wir für die Entwicklung gemeinsamer europäischer Bildungskonzeptionen und -angebote sowie für ein Studienangebot ein, das den Wechsel zwischen den Universitäten der Mitgliedsländer problemlos erlaubt. Wir setzen uns für den verstärkten internationalen Austausch von Lernenden und Studierenden ein. In diesem Zusammenhang fordern wir Maßnahmen, die die Fremdsprachenkompetenz der Österreicherinnen und Österreicher erhöhen, wobei sich diese Maßnahmen nicht nur auf die Sprachen der Länder der Europäischen Union beschränken sollen.
(9) Wir schaffen die notwendigen Rahmenbedingungen rechtlicher Art und sichern die notwendigen Investitionen, um bereits möglichst früh eine kritische Auseinandersetzung mit und die Beherrschung von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zu vermitteln, weil die Chancen der Informationsrevolution im Interesse aller genutzt werden müssen.
(10) Wir treten für intensiven Austausch und verstärkte Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Bildungssystem ein, um neue gesellschaftliche und wirtschaftliche Anforderungen frühzeitig im Bildungsangebot aufgreifen zu können und damit Ausbildung anzubieten, die gebraucht wird.
(11) Wir setzen uns im Interesse einer weiteren Demokratisierung für eine weitgehende Autonomie der Schulen bei gleichzeitiger Einbettung in das regionale Umfeld ein sowie für verstärkte Mitbestimmung der Eltern und der Schülerinnen und Schüler. Die allgemeine Anerkennung erworbener Berechtigungen muß aber auch beim Ausbau der Autonomie gewahrt bleiben.
(12) Wir treten für ein durchlässiges Bildungssystem vom Kindergarten über eine gemeinsame Schule der 6-14-jährigen bis zu vielfältigen weiterführenden Angeboten ein. Dort sollen Lernprozesse in einer modularen Form gestaltet werden, die es ermöglicht, sie auch nach der schulischen Erstausbildung jederzeit zu ergänzen und zu vertiefen.
(13) Wir treten für eine Weiterentwicklung der Oberstufe ein. Sie muß breite berufsfeldorientierte Grundqualifikationen, umfassende Allgemeinbildung und Schlüsselqualifikationen vermitteln. Dies bedeutet eine deutliche Rücknahme des Spezialisierungsgrades und intensivere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Schultypen bis hin zur Schaffung neuer und auf die Erfordernisse der Region abgestimmter gemeinsamer Schulformen unter Einbeziehung der Berufsschule.
(14) Bei der Weiterentwicklung des dualen Berufsausbildungssystems Lehre geht es um die Erweiterung der allgemeinbildenden Basis und um die Sicherung der beruflichen Qualifizierung, die Entkoppelung von Berufsausbildung und Gewerbeordnung, neue Berufsbilder, die dem Strukturwandel der Wirtschaft gerecht werden, die sinnvolle Bündelung von Berufsbildern, betriebsunabhängige praktische Ausbildungseinrichtungen und neue schulische Ausbildungsformen mit einem hohen Praxisanteil. Um den betrieblichen Teil der Lehrausbildung zu sichern, sind ein Lastenausgleich zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben sowie die Schaffung von Ausbildungsverbünden notwendig.
(15) Wir treten für eine Entlastung der Schüler und Studierenden von einem Übermaß an schnell veraltendem Wissensstoff zugunsten der Entwicklung von Methodensicherheit, Denk- und Arbeitsfähigkeit ein und für die Bereitstellung von Angeboten, die lebensbegleitend das Erwerben weiteren Wissens und weiterer Bildung sowie das Erwerben von Abschlüssen und Ausbildungen im zweiten Bildungsweg ohne finanzielle Barrieren möglich machen.
(16) Wir treten für den Abbau von Schranken ein, die den Zugang zur weiterführenden Bildung erschweren. Wir wollen mehr Menschen ohne traditionelle Matura und aus sozial schwächeren Familien im Interesse der Chancengleichheit ermöglichen, ein Studium zu beginnen und positiv zu absolvieren.
(17) Im Hochschul- und Universitätsbereich geht es um ein System, das Durchlässigkeit sichert, damit die individuellen Interessen bestmöglich verfolgt und die Möglichkeiten der Studierenden im Interesse der Gesellschaft optimal genützt werden können. Dies umfaßt auch eine vermehrte Anrechnung nichtuniversitärer Vorstudien und eigene Studienangebote für Berufstätige. Wir wollen einen ständigen Prozeß der Qualitätskontrolle organisieren, der sicherstellt, daß den Absolventinnen und Absolventen optimale Chancen ermöglicht werden.
(18) Wir treten für offenen Hochschulzugang, für Autonomie der Universitäten und Hochschulen, aber zugleich für deren Einbettung in die Gesellschaft ein. Die Kompetenz zu eigenständiger Regelung muß mit größerer Verantwortlichkeit, Rechenschaftspflicht, Transparenz und demokratischer Kontrolle, vor allem auch im Bereich der finanziellen Gebarung, einhergehen. Hochschulen und Universitäten sollen auch eine wichtige Funktion als Dienstleistungsunternehmen für die Entwicklung der Regionen wahrnehmen. In diesem Zusammenhang sollen Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, aber auch für Absolventinnen und Absolventen ausgebaut werden.
(19) Auch im gesamten Hochschulbereich muß die Möglichkeit der demokratischen Mitbestimmung gesichert und erweitert werden. Darüber hinaus setzen wir uns für besondere Maßnahmen der Entwicklungs- und Karriereförderung von Frauen ein. Wir wollen einen fairen Anteil von Frauen an allen Positionen im Bereich der Universitäten und Fachhochschulen erreichen.
(20) Um auch die Lehrenden für die neuen Aufgaben zu rüsten, setzen wir uns für verbesserte Ausbildung der Lehrkräfte ein sowie für ein qualifiziertes Angebot berufsbegleitender Supervision und Fortbildung, das vor allem die Fähigkeit zu kommunizieren stärkt. Eine Gestaltung der Lernprozesse, die allen gleiche Entwicklungschancen bietet, kann nur dann gelingen, wenn Lehrende und Lernende solidarisch miteinander arbeiten.
(21) Lebensbegleitende Weiterbildung wird immer wichtiger. Wir sehen es als Aufgabe der öffentlichen Hand, daran mitzuwirken, daß in ganz Österreich ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot zur Verfügung steht, von dem niemand aus finanziellen Gründen ausgeschlossen ist. Um die Möglichkeit zur Teilnahme an Weiterbildungsangeboten zu sichern und die Chancen am Arbeitsmarkt zu verbessern, treten wir dafür ein, daß allen arbeitenden Menschen ein Recht auf bezahlte Bildungszeit eingeräumt wird und daß Arbeitslosen durch gezielte Bildungsangebote der Einstieg in die Arbeit erleichtert wird. Wir treten für den Ausbau der Erwachsenenbildung sowie für den Aufbau eines flächendeckenden, kostenlos zugänglichen Systems der Bildungsinformation und -beratung zur Orientierung im Weiterbildungssystem ein.
III.10. Identität und kritische Öffentlichkeit - Kunst und Medien
(1) Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten verstehen unter Kultur nicht bloß den engeren Bereich der Kunst, sondern die gesamte Vielfalt an Ausdrucksformen des menschlichen Zusammenlebens und der Auseinandersetzung der Menschen mit ihren Lebensbedingungen. Ziel sozialdemokratischer Kulturpolitik ist es, allen Menschen zu ermöglichen, ihr schöpferisches Potential zu entwickeln und zur Geltung zu bringen, um im Rahmen einer toleranten und solidarischen Gesellschaft die eigenen Lebensbedingungen mitzugestalten.
(2) Sozialdemokratische Kulturpolitik sorgt dafür und schafft die erforderlichen Freiräume, daß Tendenzen gesellschaftlicher Entwicklungen erkannt, gezeigt, benannt und öffentlich diskutiert werden. Sie fördert und unterstützt daher nicht nur Kunst, sondern sämtliche kreativen Milieus. In diesem Sinne sind daher unter anderem auch Bildung, Wissenschaft und Medien Felder der Kulturpolitik,da auch sie wesentlich zum Selbstverständnis einer Gesellschaft und dessen kritischer Reflexion sowie zur Alltagskultur beitragen.
(3) Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bekennen uns zum Grundsatz der Freiheit der Kunst und zu künstlerischer Vielfalt. Kunstpolitik hat sich nicht in künstlerisches Schaffen einzumischen, sie soll vielmehr Rahmenbedingungen und Möglichkeiten schaffen, damit sich die Künste frei entfalten können. Sie soll daher Künstlerinnen und Künstler fördern, zu ihrer sozialen Absicherung beitragen sowie Infrastruktur, insbesondere in Form von Ausbildungseinrichtungen und Möglichkeiten der öffentlichen Darstellung, Realisierung und Vermittlung von Kunst, bereitstellen bzw. unterstützen.
(4) In Ergänzung zum etablierten Kunstschaffen sind besonders jene künstlerischen Ausdrucksformen zu fördern, die kulturelle Investitionen in die Zukunft darstellen, wie zum Beispiel der gesellschaftlich wichtige Bereich der Jugendkultur oder innovative Kunstrichtungen, die im Feld der audiovisuellen Medien und der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien entstehen.
(5) Die Pflege der künstlerischen Tradition Österreichs darf sich nicht auf die Vermarktung großer künstlerischer Leistungen der Vergangenheit beschränken. Im Spannungsverhältnis mit gegenwärtigen und zukünftigen Kunstströmungen sollen fruchtbare kulturelle Impulse entstehen. Wir wollen eine künstlerische Landschaft, in der das Experimentelle neben dem bereits Akzeptierten Platz findet. Dies gilt auch für die Darstellung österreichischer Kunst im Ausland.
(6) In einer durch Kommunikation und Mobilität der Menschen vernetzten Welt ist die Beschränkung von Kunst und Kultur auf den nationalen Raum überholt. Wir streben die produktive Förderung und Umsetzung eines grenzüberschreitenden künstlerischen und kulturellen Schaffens und Dialogs an. Diese Internationalität fördern wir auch im Bereich der Kulturpolitik. Deshalb unterstützen wir den beständigen Austausch von internationalen Erfahrungen sowie die Koordination von gemeinsamen Programmen, z.B. auf europäischer Ebene.
(7) Innovative oder gesellschaftskritische Kunst ist häufig nicht von vornherein marktfähig. Staatliche Förderung von Kunst kann deshalb durch private Investoren ergänzt, jedoch nicht ersetzt werden. Daher treten wir auch zukünftig für eine ausreichende Dotierung der Kunstbudgets ein. Gefordert ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung zeitgemäßer Vergabemodelle sowie eine konzeptive Arbeitsteilung zwischen öffentlicher Verwaltung und ausgelagerten Einrichtungen wie Stiftungen und Fonds.
(8) Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen ein gesellschaftliches Klima fördern, das künstlerischen Pluralismus gewährleistet und kritische Auseinandersetzung ermöglicht. Daher wollen wir den Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern und die öffentliche Diskussion über kunstpolitische Fragen führen und fördern sowie für die Auseinandersetzung mit Kunst aktiv werben. Die verfassungsmäßig verankerte Freiheit der Kunst verteidigen wir vorbehaltlos gegen ihre Gegner.
(9) Sozialdemokratische Kulturpolitik arbeitet für einen breitestmöglichen Zugang zur Vielfalt des künstlerischen Lebens. Sie setzt sich für den Abbau von Barrieren ein, die sich z.B. durch Preisgestaltung, regionale Gegebenheiten oder Bildungsdefizite ergeben können. Kulturelle Vielfalt muß über Ballungsräume und eine kaufkräftige Bildungselite hinausreichen.
(10) Im Verbund mit Schulen, Museen, Bibliotheken und Medien kommt der Kunstvermittlung ein besonderer Stellenwert zu, um ein reiches kulturelles Leben zu schaffen. Wir fördern zeitgemäße Formen und Strategien, um Interesse zu wecken und die kreative und gegenwartsbezogene Auseinandersetzung mit Kunst zu stimulieren.
(11) Öffentlichkeit ist Grundbedingung für eine funktionierende Demokratie. Wir sind daher für eine breite Medienvielfalt, gegen Medienkonzentration, die diese gefährdet, sowie für die Förderung wirtschaftlich schwächerer Medien durch die öffentliche Hand nach den Kriterien Vielfalt und Qualität. Der Pluralismus an Meinungen ist nur durch umfassende Pressefreiheit und Unabhängigkeit der in den Medien Tätigen (innere Pressefreiheit) gewährleistet.
(12) Im Bereich der elektronischen Medien wird es aufgrund der neuen Technologien zu besonders großen Veränderungen kommen, neben traditionellen elektronischen Medien wie Radio und Fernsehen werden vor allem die neuen Informationstechnologien zu einem neuen Medienangebot, aber auch zu einer veränderten Mediennutzung führen.
(13) In diesem Bereich (Rundfunk, TV, Neue Medien) treten wir für ein Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen, nichtkommerziell privaten und kommerziellen Programmanbietern ein. Dabei erwarten wir vom öffentlichen Rundfunk und Fernsehen ein Programm, das in besonders umfassender Weise Informations-, Bildungs- und Kulturangebote sowie regionale Berichterstattung enthält. Um dies leisten zu können, muß der Bestand öffentlicher Rundfunk- und Multimediaanbieter durch eine Neugestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der wirtschaftlichen Basis langfristig abgesichert werden.
(14) Zur Sicherung der Programmqualität gehört die Förderung der Herstellung und des Vertriebs von Produktionen, die den kulturellen Standards und den Forderungen nach geistiger Vielfalt und umfassender sachlicher Information entsprechen. Interaktive Angebote, die Mediennutzung über den passiven Konsum hinaus ermöglichen, verdienen besondere Unterstützung.
(15) Wir wollen die Medienkompetenz in unserer Gesellschaft unter anderem durch entsprechende Bildungsangebote fördern. Auf dieser Basis muß es auch zur Neudefinition der Verantwortung zwischen Medienproduzentinnen und -produzenten einerseits und -konsumentinnen und -konsumenten andererseits kommen. Es müssen in manchen Bereichen neue Formen der Selbstbeschränkung wirksam werden, es ist aber auch durch öffentliche Kontrolle - unter Einbeziehung relevanter Vertretungen der Konsumentinnen und Konsumenten - sicherzustellen, daß z.B. die Verherrlichung und Verniedlichung von Gewalt, die Diskriminierung von gesellschaftlichen Gruppen und die Ausbeutung von Schutzbedürftigen in allen Medienprogramminhalten wirksam unterbunden werden können. Klare Regeln müssen hinsichtlich der Informationsaufgabe und Ausgewogenheit sowie des Schutzes der Persönlichkeitssphäre von Bürgerinnen und Bürgern gelten.
III.11. Politik jenseits enger Grenzen - das Projekt Europa
(1) Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen für eine Politik, die den Frieden als bestimmenden Wert einer Gesellschaft betrachtet. Daher ist für uns die Einigung Europas ein entscheidendes Friedensprojekt. Nur durch den schrittweisen Aufbau eines gemeinsamen Europa können die Voraussetzungen geschaffen werden, Konflikte zwischen Staaten, aber auch zwischen ethnischen Gruppen, friedlich zu regeln. Für uns ist die Europäische Union daher eine Gemeinschaft der Solidarität, der Chancengleichheit, der Toleranz und der Sicherheit, die all jenen Staaten Europas offenstehen muß, die diese Werte teilen und die gemeinsam festgelegten Voraussetzungen erfüllen.
(2) Wir werden nur dann breite Zustimmung in der Bevölkerung für das neue Europa finden, wenn es nicht nur um die Herstellung eines gemeinsamen Marktes geht, sondern in Ergänzung zum Projekt der Friedenssicherung um ein Europa der Bürgerinnen und Bürger, um ein Europa der Arbeit und der sozialen Sicherheit. Zu dieser breiten Akzeptanz ist es daher erforderlich, alle Politikfelder der europäischen Union im Sinne einer querschnittsorientierten Gleichstellungspolitik weiterzuentwickeln.
(3) Eine besondere Herausforderung und Chance sehen wir darin, die soziale Dimension Europas zu stärken. Arbeitslosigkeit wird von uns niemals akzeptiert werden. Sie muß auf nationaler Ebene, aber auch durch verstärkte Anstrengungen auf europäischer Ebene bekämpft werden. Die neue Qualität der europäischen Einigung durch die Herstellung einer Wirtschafts- und Währungsunion muß auch durch die Inangriffnahme einer Beschäftigungs- und Sozialunion ihre notwendige Ergänzung finden. In diesem Zusammenhang haben auch die Sozialpartnerschaft und die Gewerkschaften eine wichtige internationale Rolle.
(4) Das Europa der Bürger ist ein Europa, das seine demokratischen Strukturen weiterentwickeln muß. Der Einigungsprozeß ist notwendigerweise mit dem Aufbau zentraler europäischer Institutionen verbunden. Solche bergen immer die Gefahr einer Verselbständigung und einer Entfernung von den Interessen der Bürger in sich. Daher bedarf es auch einer aktiven europäischen sozialdemokratischen Partei und eines starken Europäischen Parlaments. Wir brauchen aber auch eine lebendige zivile Gesellschaft mit vielen privaten Initiativen und Organisationen auf europäischer Ebene. Unser Europa ist ein Kontinent der lebendigen Demokratie, des Rechts und der Freiheit.
(5) Sicherheit in Europa bedeutet heute nicht in erster Linie militärische Sicherheit. Viele akute Bedrohungen sind nicht-militärischer Art: Ökonomische und ökologische Krisen stellen realistischere Bedrohungen dar als kriegerische Konflikte.
(6) Wir wollen, daß europäische Sicherheitspolitik nicht nur militärisch konzipiert und organisiert wird. Europäische Sicherheitspolitik hat vorausschauend und vorbeugend Maßnahmen zur Stabilitätsförderung und Demokratiesicherung zu setzen. Die Sozialdemokratie verfolgt den Gedanken einer Sicherheitspartnerschaft mit dem Ziel, Sicherheit miteinander statt gegeneinander zu gewährleisten.
(7) Die effektivste Gewaltprävention ist die Entwicklung Europas zu einer Zone demokratischer Rechtsstaaten. Demokratien führen in aller Regel keine Kriege gegen andere Demokratien. Daher treten wir dafür ein, die europäische Stabilitätszone auszuweiten. In ihr stehen Maßnahmen zur Förderung der Demokratie, Rüstungskontrolle und Abrüstung, Instrumente des Minderheitenschutzes, friedliche Streitbeilegung sowie Konsultation und Kooperation, Frühwarnung und Vermittlung im Vordergrund, ergänzt durch das Spektrum des militärischen Krisenmanagements.
(8) Die Perspektiven für ein europäisches Sicherheitssystem haben sich seit Ende der Bipolarität und des Kalten Krieges radikal geändert. Standen vor 1989/90 für den Westen die Verteidigung Westeuropas und der USA im Vordergrund, so wird auf absehbare Zukunft kooperative Konfliktprävention und Krisenmanagement entscheidend sein.
(9) Ein Militärbündnis ist dafür kein geeignetes Instrument, weil Friedenspolitik nach Ende des Kalten Krieges sinnvollerweise nicht mehr in nuklearer oder konventioneller Abschreckung durch ein kollektives Verteidigungsbündnis bestehen kann. Ein künftiges europäisches Sicherheitsmodell muß weit darüber hinaus gehen und auf sehr flexiblen Strukturen (Konfliktprävention, Krisenmanagement, internationale Solidaritätseinsätze usw.) beruhen, sodaß für große wie kleine Staaten vielfältige Sicherheitsstrategien und verschiedene Formen der Kooperation und Konsultation möglich werden.
(10) Österreich verfügt in Form der Neutralität, in Kombination mit internationaler kooperativer Solidarität, über ein bewährtes Sicherheitskonzept. Es gestattet eingegangene Verpflichtungen in vertragstreuer und solidarischer Weise wahrzunehmen. Wir lehnen daher eine automatisierte Verpflichtung zur Teilnahme an militärischen Operationen in einem Bündnis ab. Wir benötigen auch keinen Bündnisbeitritt, um unsere internationale Solidarität unter Beweis zu stellen. Wir leisten schon bisher einen - bezogen auf unsere Bevölkerungszahl - überproportionalen Beitrag zur internationalen Friedenssicherung.
(11) Im Rahmen dieser Konzeption bekennen wir uns zu einer demokratisch organisierten Landesverteidigung. Den Angehörigen des Bundesheers sind alle Persönlichkeitsrechte sowie menschenwürdige Bedingungen bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu gewährleisten.
(12) Die Entwicklung der Nationalstaaten war seit der Aufklärung eng verbunden mit dem Kampf gegen das individuelle Faustrecht, welches durch den Aufbau des Rechtsstaates und durch die Schaffung des Gewaltmonopols des Staates zurückgedrängt und abgeschafft wurde.
(13) In weiterer Konsequenz gilt es nunmehr, durch die Schaffung supranationaler rechtsstaatlicher Strukturen und durch ein Gewaltmonopol für legitimierte Organe der Völkergemeinschaft, das "internationale Faustrecht" in Form militärischer Aggression zurückzudrängen und zu überwinden und damit zur dauerhaften Friedenssicherung beizutragen.
(14) Teil dieser Bemühungen sollte die Entwicklung einer gemeinsamen friedensorientierten europäischen Außen- und Sicherheitspolitik sein, die - eingebettet in eine globale Sicherheitspolitik - dazu führen soll, daß in Europa Kriege zwischen Staaten und die Anwendung von Gewalt zur Lösung politischer Probleme der Geschichte angehören.
(15) So wenig es heute für Österreich einen plausiblen Grund gibt, einem Militärbündnis beizutreten und auf die österreichische Neutralität zu verzichten, wäre doch ein solches europäisches Sicherheitssystem und eine neue Kultur bei der Bewältigung von Konflikten ein Friedensmodell, dem sich kein europäischer Staat entziehen sollte.
(16) Die Erweiterung der Europäischen Union betrachten wir als Erweiterung einer Zone des Friedens und der Stabilität. Sie muß schrittweise und nach sorgfältiger Vorbereitung bzw. nach einer Periode der Annäherung der Sozial- und Umweltstandards erfolgen, um sicherzustellen, daß die Erweiterung auch unter wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten Vorteile für ganz Europa bringt. Auch nach Vollendung des Prozesses der Erweiterung der Europäischen Union wird Europa keine Festung gegenüber anderen Völkern und Kontinenten sein, sondern dialogbereit und weltoffen.
III.12. Globale Gerechtigkeit schaffen - die Zukunft der Weltgesellschaft
(1) Ebenso wie innerhalb Europas wollen wir uns auf globaler Ebene für die Verwirklichung unserer Grundwerte einsetzen. Auch unser eigenes Schicksal hängt mit davon ab, ob es gelingt, eine friedliche Welt der Demokratie und Humanität, des Wohlstandes und des umweltschonenden Wirtschaftens zu verwirklichen oder uns diesem Ziel anzunähern.
(2) Neue Strukturen der Weltgesellschaft, die weder von militärischer Gewalt noch von wirtschaftlicher Übermacht bestimmt sind und in denen gleiches Recht und gleiche Verantwortung für große und kleine Nationen gelten, sind dafür eine unabdingbare Voraussetzung. Zentraler Platz für globales politisches Handeln sollen die Vereinten Nationen sein, die - um ihrem Namen gerecht zu werden - auch mit den Mitteln und Instrumenten auszustatten sind, um ihre Friedensmission und andere Aufgaben, die ihnen von der internationalen Gemeinschaft übertragen werden, erfüllen zu können.
(3) Eine ebenso bedeutende Rolle muß jenen regionalen Organisationen zukommen, die - wie für den europäischen Raum die OSZE - für regionale Friedenssicherung legitimiert sind. Völkerrecht muß vor nationalem Recht gelten und vor allem über nationalen Interessen stehen. Auch und gerade große Staaten müssen Völkerrecht beachten. Im internationalen System von morgen müssen neben Regierungen, Parlamenten und anderen bestehenden Institutionen auch neue Akteure der internationalen Politik, internationale Bürgerbewegungen und regierungsunabhängige Organisationen den ihnen gebührenden Platz finden. Besonders für die internationale Sozialdemokratie müssen sie privilegierte Bündnispartner von morgen werden.
(4) Globale Sicherung des Friedens ebenso wie die Eindämmung lokaler Konflikte setzt voraus, daß der Primat der Politik vor der Logik militärischer Gewalt kommt. Abrüstung und Rüstungskontrolle unter der Ägide der Vereinten Nationen muß als Ziel eine von Massenvernichtungswaffen freie Welt haben. Scharfen internationalen Kontrollen muß aber auch der Handel mit Waffen vor allem in Konfliktzonen unterworfen werden. Waffen, die gegen humanitäres Recht verstoßen wie z.B. Landminen sind zu ächten.
(5) Wahrung und Verbreitung der Menschenrechte und Grundfreiheiten gehören zu den wichtigsten Grundlagen eines stabilen politischen Weltsystems. Menschenrechte und Grundfreiheiten sind universal und unteilbar und gelten in gleicher Weise für alle Kulturen und alle Stufen wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung.
(6) Im Zeitalter der Globalisierung müssen Weltwirtschaft und Weltwährungssystem von überschaubaren und transparenten Regeln gelenkt werden. So wie die nationalen Märkte bedürfen auch die Weltmärkte einer nach demokratischen Spielregeln entstandenen Marktordnung, die Schutz vor Mißbrauch wirtschaftlicher Macht bietet, die Spekulation auf den internationalen Finanzmärkten eindämmt und die Krisenanfälligkeit des Weltwirtschaftssystems mindert. Das Weltwährungssystem von morgen darf nicht nur von den Launen der Märkte abhängen, sondern muß die Gestaltungsmöglichkeiten von Regierungen, Zentralbanken und Weltwährungsinstitutionen erhalten.
(7) Ein erneuertes Weltwirtschaftssystem muß auch den heute noch armen Nationen gleiche Chancen bieten und ihre Integration in den Welthandel und die Weltwirtschaft insgesamt fördern. Voraussetzung dafür sind für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten allerdings weltweite soziale und ökologische Mindeststandards, insbesondere Vereinigungsrecht, Recht auf Kollektivvertragsverhandlungen, Verbot der Kinderarbeit und der Gefangenen- und Sklavenarbeit. Eine weitere Voraussetzung auf diesem Weg bleibt eine zwischen allen Gebern abgestimmte Entwicklungspolitik, auch als ein Gebot internationaler Solidarität. Partnerschaftliche Entwicklungszusammenarbeit darf nicht an den Menschen vorbeigehen und muß auch der Schaffung moderner und demokratischer gesellschaftlicher und staatlicher Strukturen im Geiste der Verantwortung und Transparenz dienen.