

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausgabe: 39 / Fortsetzung]
7. Lernen aus der Stadtplanung des 20. Jahrhunderts
Der Vertreter der AG Landschafts- und Freiraumplanung/Bremen stellte in Ergänzung der bereits mehrfach angesprochenen Frage, ob sich unsere Gesellschaft derzeit in einem tiefgreifenden Wandel befindet, oder ob es sich bei den gegenwärtig beobachtbaren Tendenzen lediglich um kontinuierliche Fortschreibungen geschichtlicher Entwicklung handelt, drei Thesen zur Diskussion [Fn. 10: Vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Lebenswerte Stadtquartiere. Lehren aus der Stadt- und Verkehrsplanung für Städte von morgen.- Bonn 2000.].
- These 1: Aus positiven und negativen Erfahrungen der Stadt-, Verkehrs-, Architekturraumplanung läßt sich lernen, was sich in den Bereichen Bauen und Wohnen bewährt hat bzw. was nicht.
- These 2: Seit der Phase des modernen Städtebaus der zwanziger Jahre werden keine Städte mehr gebaut oder weiter entwickelt, sondern aufgelockerte, gegliederte, autogerechte Trabanten in unterschiedlichen Formen errichtet, die weder untereinander noch mit der „alten" Stadt in Beziehung stehen.
- These 3: Die vorbildliche, kompakte europäische Stadt war bis zur Gründerzeit eine gereihte Häuserstadt mit einem engmaschigen Wege- und Straßenraster sowie einem dichten Nebeneinander verschiedener Nutzungen um Gewerbe, Handel, Dienstleistungen. Die Kernelemente dieser Haus- und Quartiersorganisation sollten bei Bau, Erhalt und Reparatur von Städten berücksichtigt werden.
7.1 Übertragbarkeit historischer Lösungsansätze
Mit Bezug zur ersten These bemerkte der Referent, Geschichte bedeute immer ein Stück Kontinuität und Wiederholung analoger Ereignisse. Dies umfasse sowohl die kontinuierliche Erscheinung von Brüchen als auch fortbestehende Traditionen. Daneben gehöre zur Geschichte immer auch eine fortschrittliche Komponente der Gleichzeitigkeit und eine beharrende Seite der Ungleichzeitigkeit, die meist als Rückständigkeit assoziiert wird. Vor diesem Hintergrund plädierte der Referent dafür, aktuelle Ereignisse mit ausreichender Gelassenheit und Distanz in den Lauf der Geschichte und somit in die Ambiva-
[Seite der Druckausgabe: 40]
lenz von Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit einzuordnen. Man müsse sich die Fragen „Was verändert sich wirklich?", „Was ist neu?" oder auch „Was soll sein?" im Sinne von Wunschvorstellungen aus Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft stellen.
In der von Professor Holzapfel und der AG Landschafts- und Freiraumplanung für die Friedrich-Eber-Stiftung erstellten Studie „Lebenswerte Stadtquartiere" wurden Projekte aus dem Städtebau und der Verkehrsplanung der Nachkriegszeit in Deutschland an ihrer Alltagstauglichkeit für die Bewohner gemessen. Auf dieser Basis konnten dann sowohl vorbildliche als auch negative Beispiele erarbeitet werden. Durch „genauen Hinsehen" sollte ein klares Verständnis beispielsweise einer Bauepoche oder eines bestimmten Haus- oder Straßentyps erlangt werden. Hierbei war es Ziel, die jeweiligen Folgen und Bedeutungen für den täglichen Gebrauch durch die Nutzer zu erkennen. Erst wenn der jeweilige Gegenstand beschrieben und die erarbeitete Bedeutungsfindung plausibel belegt ist, könne nach Übertragbarkeiten und Lösungsansätzen für die heutige Situation gefragt werden. Man müsse stets eine sachliche und eine politische, moralische oder ökonomische Seite bei einem zu betrachtenden Gegenstand unterscheiden. Diese Differenzierung sei bei Häusern, Straßen oder Quartieren als Betrachtungsgegenständen nicht leicht. Daher wurde in der Studie „Lebenswerte Stadtquartiere" der Versuch unternommen, architektonische und städtebauliche Ergebnisse auf ihre Alltagstauglichkeit zu überprüfen anstatt über den Geschmack und Zeitgeist der jeweiligen Jahrzehnte zu streiten. Vor allem Fehler müßten genau analysiert werden, um sie zukünftig vermeiden zu können.
7.2 Stadt- und Verkehrsplanung der Nachkriegszeit im Überblick
Zur zweiten These, keine Stadt würde seit der Moderne und der Trennung der Daseinsfunktionen Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Freizeit und Erholung an die alten Strukturen anknüpfend weitergebaut, schränkte der Referent zunächst ein, dass der Grundstein für Funktionstrennung schon weit vor der Charta von Athen mit dem Auszug der Arbeit aus dem Haus gelegt worden sei (Manufakturen, Industrialisierung). In der Geschichte des deutschen Städtebaus und der deutschen Verkehrsplanung sei das Bild von Neubausiedlungen allerdings erst seit den 50er Jahren durch entsprechende Leitbilder der bestimmt worden, wie ein kurzer Rückblick zeigt: [Fn. 11: Vgl. dazu auch: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Lebenswerte Stadtquartiere. Lehren aus der Stadt- und Verkehrsplanung für Städte von morgen.- Bonn 2000: S. 25ff.]
Der Städtebau der Nachkriegsjahre war durch detaillierte Siedlungsmodelle der „gegliederten und aufgelockerten Stadt", des „organischen Stadtbaus" und der „autogerechten Stadt" gekennzeichnet. Im Vordergrund stand die Versor-
[Seite der Druckausgabe: 41]
gung der Bevölkerung mit ausreichendem und gesundem Wohnraum -Belüftung, Belichtung und Wohnen im Grünen bildeten wichtige Kriterien für Neubauten. Damit einher ging die Trennung der Funktionen Wohnen und Ver-kehr. Neubausiedlungen der 50er Jahre waren durch weitläufige, geringgeschossige Zeilenbauten mit großen, keinen weiteren Nutzungen vorbehaltenen Abstandsflächen („sanitäres Grün") sowie ein Erschließungssystem gekennzeichnet, das innere Fußgängerbereiche und äußere Verkehrsstraßen unterschied. Diese Leitbilder hatten ihre ideologische Grundlage bereits im „modernen Städtebau" der 20er Jahre. Maßgeblich für die Entwicklungen der 50er Jahre war die 1933 entwickelte und 1943 von Le Corbusier verfaßte „Charta von Athen", die eine Abkehr von der gründerzeitlichen, parzellierten Stadt bedeutete.
Das zentrale Leitbild der 60er und 70er Jahre hieß „Urbanität durch Dichte" und bedeutete einen Wechsel vom aufgelockerten zu einem stärker verdichteten Siedlungsbau. Im Vordergrund stand nun die Idee, städtische Qualitäten vor allem durch quantitativ hohe Bau- und Wohndichten herzustellen. Trabanten-Großsiedlungen entstanden an den Stadträndern. Sammelstraßen, Zubringer, zentrale Parkplätze und davon abzweigende Wohnwege zur Gebäudeerschließung sollten einen reibungslosen Verkehrsfluß garantieren. Zur Belebung von Neubauwohnsiedlungen wurde wieder über eine Mischung der Funktionen „Wohnen", „Konsum" und „Erholung" nachgedacht.
Im Zentrum „postmoderner" Städtebau-Konzepte der 80er Jahre stand die Rückorientierung zum alten städtischen Bestand. Die in den 70er Jahren begonnene Alt- und Innenstadtsanierung wurde fortgesetzt (vgl. unter anderem das Motto „Stadtreparatur" der IBA Berlin). In dieser Zeit entstanden vergleichsweise wenige Neubauten. Zunehmender interkommunaler Konkurrenzdruck um (weiche) Standortvorteile war ein Motor für die Aufwertung (Gentrification) innerstädtischer Altbauquartiere und die Einführung von Konzepten zur Verkehrsberuhigung.
Die 90er Jahre waren vor allem von „Investorenplanung" und „public private partnerships" vor dem Hintergrund der Aufhebung der Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau im Jahr 1988, kommunaler Finanzknappheit, der Privatisierung kommunaler Zuständigkeitsbereiche und des Rückzugs des Staates aus der Bauleitplanung aus Kosteneinsparungsgründen geprägt. Inhaltlich stand das „Wohnen im Grünen" bzw. das „Wohnen für einkommensstarke Haushalte" mit einem Trend zur Abschottung - unter anderem durch Verkehrsführung und -erschließung - im Vordergrund. Es schien nicht mehr die Frage zu dominieren, wie gebaut wurde, sondern dass überhaupt gebaut wurde, verbunden mit der Entstehung von Masterplan-Siedlungen auf der „grünen Wiese".
[Seite der Druckausgabe: 42]
Ebenfalls aus den 90er Jahren stammt das Schlagwort „nachhaltige Stadtentwicklung", das zwar eine neuartige Kombination von Nutzungsmischung, Dichte, Verkehrsreduktion sowie teilweise auch Wohnen im Grünen beinhaltet. Dabei bleiben die Bauformen aber im Grundsatz die gleichen wie seit den 50er Jahren. Bei den meisten Projekten - beispielsweise in Potsdam-Kirchsteigfeld oder Freiburg-Rieselfeld - wird die Trennung der Daseinsfunktionen nach wie vor aufrecht erhalten, denn es kommt bis auf die Zulassung von Ladenzeilen und Einkaufszentren in Wohngebieten zu keiner wirklichen Nutzungsmischung. Als eine positive Ausnahme nannte der Vertreter der AG Landschafts- und Freiraumplanung das bereits vorgestellte Entwicklungsprojekt Tübinger Südstadt.
Kritisiert wird, dass es bei allen Beispielen des modernen, den Prinzipien der nachhaltigen, dichten, gemischten Stadt folgenden Städtebaus keine hauswirtschaftliche Einheit von Haus und Hof oder von „Innenhaus und Außenhaus" (Meta Hülbusch, 1978), also eine private Verfügung über den eigenen Wohn- und Lebensort gibt. Straßen seien hier nach wie vor zum Wohnweg oder zur verkehrsberuhigten Fläche reduziert, und Autos würden auf gesonderten Parkplätzen - im Zweifelsfall im Nachbarquartier - abgestellt, womit die „normale" Straße in Vergessenheit gerate. Damit allerdings werde die Straße als die kommunale Seite des Lebensortes zum leeren Ort: Ankommen und Wegfahren, Be- und Entladen seien wichtige Anlässe und Gelegenheiten, um zufällig mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen, sich auf der Straße zu zeigen und andere Menschen kennen zu lernen. Diese Interaktionen seien wichtige Bedingungen für Sicherheit und Identität am Wohnort. Nicht zuletzt sei die Straße auch von Bedeutung als Lernort für Kinder.
Betont wird, dass sich ein Großteil der heute viel zitierten und gelobten Qualitäten der europäischen und kompakten Stadt als nicht auf neue Stadtentwicklungskonzepte übertragbar erweisen kann, wenn nach wie vor die Trennungen der Daseinsfunktionen - in erster Linie von Wohnen und Verkehr sowie von Wohnen und Arbeit - aufrecht erhalten bleiben. Daher sei es notwendig, den organisatorischen Merkmalen gründerzeitlicher Quartiere mehr Beachtung zu schenken.
[Seite der Druckausgabe: 43]
Abbildung 4: Parzellierung und Grenzen sichern die private Verfügung der Höfe (Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), 2000, S. 121)
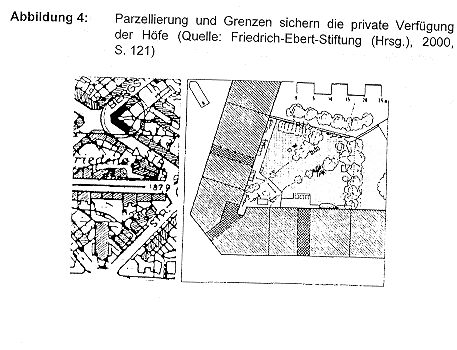
7.3 Kernelemente gründerzeitlicher Quartiere als Vorbild
Zu den Kernelementen gründerzeitlicher Quartiere gehören enge Straßenraster, gereihte Häuser mit Höfen und ein dichtes Nebeneinander verschiedener Nutzungen. Haus und Hof hatten große Bedeutung für den Alltag zu Hause (Kinderspiel, Reparaturarbeiten, das Abstellen und Lagern von Dingen, Arbeiten und Aufenthalt im Freien). Die Straße war für alle Bewohner Anteil an der Kommune und am „sozialen Markt" des Quartiers sowie der Platz vor der eigenen Haustür.
Bei der gründerzeitlichen Organisationsform sind im wesentlichen zwei Hausformen zu unterscheiden: das für viele niederländische, englische und deutsche Kleinstädte typische gereihte Haus und das gereihte Geschosshaus mit Hinterhofbebauung, Seitenflügeln und damit sehr hoher Bebauungsdichte der gründerzeitlichen Blockerweiterungen, das es in nahezu allen europäischen Großstädte gibt. Ein Beispiel für den ersten Gebäudetyp ist das „Bremer Haus", das durch eine schmale, lange, vergleichsweise kleine Parzelle (rund 6,5m x 25m) gekennzeichnet ist. Die Parzellierungen sind dicht an dicht entlang einer Vielzahl kleinerer Straßen gereiht, die auf Erschließungsstraßen mit ihren vielen Einmündungen und Ecken, Fußgänger-, Fahrrad- und Autoverkehr sowie öffentlichen Verkehrsmitteln führen. Dort liegen die Geschäfts- und damit kommunikativen Zentren des Quartiers. Entsprechend dem gründerzeitlichen Straßensystem waren solche Zentren relativ gleichmäßig in der Stadt verteilt. Bei den Gebäuden handelt es sich um so genannte „Drei-Fenster-
[Seite der Druckausgabe: 44]
Häuser" mit Souterrain und sehr hohem Sattelgeschoss. Der Hof ist durch einen zweiten, rückwärtig gelegenen (Wirtschafts-)Eingang durch den Keller zu erreichen, wodurch Straße und Hof miteinander verknüpft werden.
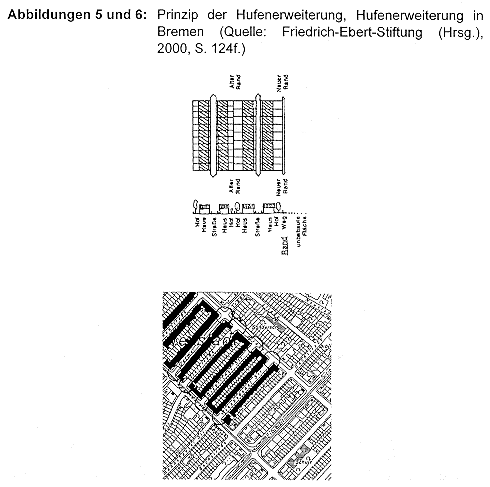
Bei der klassischen gründerzeitlichen Einspännerbebauung, die es beispielsweise in Kassel gibt, erschließt ein seitlich gelegener Hauseingang vier übereinander liegende Wohnungen. Auch diese Gebäude verfügen über Sockelgeschoss und Hinterhof mit separatem Eingang. Die Einheit von Haus und Hof bleibt gewährleistet - allerdings mit intensiverer Nutzung aufgrund der höheren Bewohnerzahl. Die Parzellen sind zwar breiter als beim „Bremer Haus", werden aber noch immer deutlich von der Grundrisstiefe dominiert. Im Gegensatz zur Reihenhausbebauung in Bremen sind in den gründerzeitlichen Quartieren Kassels bereits Blockstrukturen erkennbar, die allerdings noch immer komplett
[Seite der Druckausgabe: 45]
erschlossen werden. Auch hier gibt es eine Vielzahl von Straßen, jedoch mit ersten zentralen Organisationsformen wie Plätzen. Kassel ist ein Beispiel für ein Quartier mit hoher Wohnungsdichte, während Bremen ein Quartier mit relativ hoher Hausdichte zeigt.
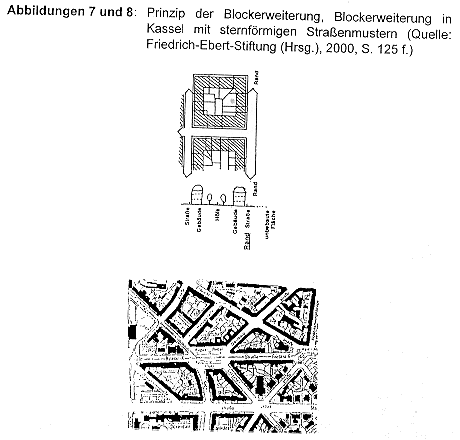
Vor allem die Art und Weise der Straßensituationen in den vorgestellten Beispielquartieren kann nach Auffassung des Vertreters der AG Landschafts- und Freiraumplanung zur Schaffung „nachhaltiger", „dichter", „kompakter" Stadtsituationen genutzt werden: Durch die Einkaufsstraßen mit ihrem relativ hohen Anteil nebeneinander liegender Ladengeschäfte und damit verbundenem starken Fußgänger- und Radverkehr entstehe Öffentlichkeit. Die abzweigenden Wohnstraßen mit ihren Fahrbahnen, Bürgersteigen, Parkmöglichkeiten und Vorgärten bieten genügend Anreize, die Straßen auch für andere Zwecke als die reine Distanzüberwindung zwischen Orten zu nutzen.
[Seite der Druckausgabe: 46]
Sollen aus diesen Beispielen Regeln und Prinzipien für Reparatur und Neubau in heutigen Städten abgeleitet werden, muss aus Sicht des Referenten der organisatorischen Einheit von Haus, Hof und Straße mit ihren Qualitäten als Handlungsräume für die Quartiersbewohner mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Gesucht werden Antworten unter anderem auf folgende Fragen:
- Wo und wie sind Höfe auch im Bereich von Zeilenbauten möglich?
- Mit welchen städtebaulichen Maßnahmen können anbaufreie Straßen sicherer und für andere Fortbewegungsmöglichkeiten als per Auto gestaltet werden?
- Welche Zonierungen können im Straßenfreiraum zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer (wieder) eingeführt werden?
- Wie können gereihte Häuser mit städtischer Dichte gebaut und dennoch zu einem durchlässigen Quartier organisiert werden?
Die Studie „Lebenswerte Stadtquartiere" zeigt in diesem Zusammenhang acht übertragbare Prinzipien für den Bau, den Erhalt oder die Reparatur von Quartieren:
- Erreichbarkeit und Durchlässigkeit durch die Anlage vieler kurzer Wege als besondere Attraktivität für Fußgänger,
- Nebeneinander und Überlagerung verschiedener Nutzungen, Haushaltsgrößen und sozialer Gruppen,
- Schaffung und Sicherung privat verfügbaren Freiraums,
- Ermöglichung von Anlässen und Gelegenheiten für Kommunikation im öffentlichen Raum,
- Verhaltenssicherheit und Toleranz als Prinzip für Kommunalität,
- Anpassungsfähigkeit, Alterungsfähigkeit und Gebrauchsfertigkeit der Bausubstanz und Quartiersbeschaffenheit,
- Rückbau von Strukturen im Sinne von Rückgabe an die Bürger bzw. Bewohner sowie
- Bestandspflege zur Qualitätssicherung.
Bei Beachtung dieser Prinzipien geht es weniger um die exakte Übertragung eines einhundert Jahre alten Musters auf die heutige Zeit, sondern um die Berücksichtigung der in den Kernelementen der gründerzeitlichen Haus- und Quartiersorganisation liegenden Qualitäten bei baulichen Maßnahmen. Die in den Informationen zur Raumentwicklung veröffentlichte Studie „Wohnen, Wunsch und Wirklichkeit" (Heft 2/1999) kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass der viel zitierte Wunsch nach Wohnen im Eigenheim nicht auf den Gebäudetyp des Einfamilienhauses gerichtet ist. Vielmehr scheint das Bedürf-
[Seite der Druckausgabe: 47]
nis nach Wohneigentum mit den Eigenschaften eines Einfamilienhauses -Unabhängigkeit, Freiheit, Sicherheit, Verfügbarkeit über das Wohnobjekt, Anpassungsmöglichkeiten an individuelle Bedürfnisse, materielle Sicherheit - zusammenzuhängen. Diese Attribute spiegeln die Organisationsstrukturen der vorgestellten gründerzeitlichen Quartiere wider. Deshalb sollten Planer und Verwaltungen das Konzept von Haus und Hof in gereihter und kompakter Form bei ihrer Arbeit stärker berücksichtigen.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Mai 2001