

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausgabe: 24]
4. Stadt der kurzen Wege
Für den Stadtplaner aus Tübingen umschreibt der Begriff „Stadt der kurzen Wege" weniger ein verkehrstechnisches Planungsprinzip zur Verbesserung der Stadt, sondern vielmehr die Charakterisierung von Stadtquartieren, in denen physische Nähe - also leichte Erreichbarkeit - einer vielfältigen (Markt-) Situation aus Gütern und Waren, Dienstleistungen und Jobs, kultureller Differenz, Bildungs- und Begegnungsmöglichkeiten einen lebhaften Austausch zwischen Menschen hervorruft, die sonst eher weniger miteinander in Kontakt stehen. Als Synonym für diese Zusammenhänge schlägt der Referent den Terminus „das lebendige Stadtquartier" vor, das im Gegensatz zu solchen Siedlungseinheiten steht, die sich auf bestimmte Funktionen und - damit verbunden - auch auf das Fernhalten von Störungen spezialisieren.
Die „Stadt der kurzen Wege" existiert in vielen Städten noch immer als „Kiez" am Innenstadtrand. Diese Viertel zeigen auch heute noch, wie sich städtisches Zusammenleben und die aus kleinen und mittleren, vor Ort ansässigen Betrieben bestehende Arbeitswelt gegenseitig stützen können. Das „Fremde und Andere" (Louis Wirth) wird hier nicht nur akzeptiert, sondern gerade wegen seiner Nützlichkeit für die Gesellschaft ausdrücklich honoriert. Der Städtebau der vergangenen 80 Jahre hat allerdings dieses Modell städtischer Nähe als überholt betrachtet und nicht mehr selbst produziert. Heute wird versucht, solche städtischen Milieus wieder zu schaffen.
4.1 Ziele
Mit welchen Mitteln und Werkzeugen läßt sich die „lebenswerte Stadt" als Zielformulierung politischer Programme und Berichte in die konkrete städtebauliche Praxis übersetzen? Für den Stadtplaner kommen hierfür beispielsweise die im Abschlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen und der Umwelt" erhobene Forderung, in Deutschland den Landschaftsverbrauch für Siedlungen und Mobilität bis zum Jahr 2010 auf 10% des bisherigen Umfangs von 120 ha pro Tag zur reduzieren, sowie der Aspekt des Strategiekataloges des Deutschen Städtetages in Frage, nach dem sowohl zur Vermeidung sozialer Segregation als auch zur Verringerung der Verkehrsprobleme künftig verstärkt auf eine Mischung der Funktionen Wohnen, Versorgen, Arbeiten und Freizeit gezielt werden sollte (vgl. Kapitel 1.2).
„Vermeidung von Segregation" als eine zentrale Forderung bedeutet aus Sicht des Referenten, keine Bevölkerungsgruppen unfreiwillig in benachteiligte Gebiete abzusondern. Dies allerdings sei ein Ziel, von dem sich die Stadtplanung in der letzten Zeit zunehmend entfernt habe, erkennbar unter anderem an der
[Seite der Druckausgabe: 25]
unausgeglichenen räumlichen Verteilung von Grund- und Hauptschulen mit überdurchschnittlich hohen Anteilen von Kindern aus Migranten- und/oder benachteiligten Haushalten. Daher gelte es, die Zahl integrativer städtischer Quartiere zu stabilisieren und zu erhöhen. In diesem Zusammenhang sei es notwendig, das vom DST formulierte Ziel der Segregationsvermeidung durch konkrete Zahlenvorgaben analog des Abschlussberichts der Enquete-Kommission zu konkretisieren: beispielsweise könne vorgeschlagen werden, den Anteil entsprechender Quartiere bis zum Jahr 2010 von gegenwärtig rund 10% auf mindestens 20% zu erhöhen.
Beiträge zur Erreichung des Ziels „Verringerung der Verkehrsprobleme" können unter anderem die Erhöhung der Bewegungsfreiheit von Kindern auf Straßen und Plätzen, Verbesserungen der Alltagsorganisation ohne Zwang zur individuellen Motorisierung und generell der Verzicht auf stark verkehrsbelastete Straßen sein. Entsprechenden Forderungen lasse sich allerdings nur mit einer allgemeinen städtebaulichen Neuorientierung nachkommen. Konkret müssten mehr alltagstaugliche und -freundliche Quartiere geschaffen werden, in denen Kinder auch mit der Arbeitswelt in Berührung kommen, und in denen die Voraussetzungen für allgemeine Mobilität ohne Unterordnung unter den Verkehr gewährleistet sind. Dies wiederum erfordere eine gezielte Stabilisierung und zahlenmäßige Ausweitung von Quartieren „der kurzen Wege". Wolle man tatsächlich in dem relativ eng gesteckten Zeithorizont bis 2010 eine Verdopplung solcher Quartiere erreichen, müsste man mit der Umsetzung entsprechender Projekte und Maßnahmen unmittelbar beginnen. Dies erzeuge Handlungsdruck, der durch die demographische Entwicklung vieler Städte ohnehin bereits gegeben sei.
Nach der Vorstellung des Stadtplaners sollte die Stadt eine „Patchwork"-Struktur ausbilden, die im wesentlichen aus zwei unterschiedlichen Quartiersmodellen mit gegensätzlichen Zielsetzungen besteht: Das „moderne" Quartiersmodell zielt auf funktionale und soziale Homogenität; es ist unter anderem durch starken Flächenverbrauch, einen großen Grünflächenanteil sowie Abschottungsmechanismen gekennzeichnet. Sein prägendes Gestaltungswerkzeug ist die Zonierung. Das zweite, eher „klassische" Stadtteilmodell hat dagegen funktionale und soziale Heterogenität zum Ziel; es gründet auf räumlicher Dichte und Vielfalt, auf Austausch und räumlichen Synergieeffekten, der Raum wird effizient und gebrauchsorientiert genutzt. Sein prägendes Gestaltungswerkzeug ist der öffentliche Raum.
Die Balance zwischen diesen beiden Modellen hat sich in der westlichen Welt während der vergangenen achtzig Jahre grundlegend verändert. Städte, die einst zu neunzig Prozent aus Quartieren des zweiten Typs bestanden, weisen heute nur noch „Restbestände" von rund zehn Prozent auf. Diese Entwicklung sei nicht einfach nur Ergebnis gesellschaftlicher Veränderungen, sondern in
[Seite der Druckausgabe: 26]
entscheidendem Maße das Produkt politisch-planerischer Steuerung. Das Zonierungsmodell habe sich während der vergangenen Jahrzehnte zu einer nicht mehr kritisch hinterfragten, sich verselbstständigenden „Normalität" entwickelt, die nicht berücksichtigt, dass die ursprünglich berechtigten Gründe für Zonierung heute aufgrund ökonomischer Umwälzungen und technologischer Neuerungen - beispielsweise im Bereich Immissionsschutz - nicht mehr bestehen.
Dem seit einiger Zeit zu registrierende Trend „Zurück in die Stadt" - dies bedeutet nicht nur ein Zurück in die historischen Stadttzentren, sondern den Wunsch, in städtischen Milieus zu leben - kann nur in geringem Maße entgegen gekommen werden, da während der vergangenen Jahrzehnte aufgrund der planerischen Fokussierung auf „Zonierungslösungen" keine neuen Milieus im ursprünglichen Sinne entstanden sind. Es sei bedauerlich, dass Untersuchungen zu Wohnwünschen der Bevölkerung und Standortpräferenzen kleinerer Betriebe nur selten den Aspekt der Einbettung in ein bestimmtes Milieu berücksichtigen. Solche Befragungsergebnisse würden den Wunsch nach Verortung in einem lebendigen Stadtteil deutlich machen. Von dieser Annahme ausgehend, müßte Stadtentwicklungspolitik die Nachfrage nach deutlich mehr integrierten Quartieren stärker berücksichtigen.
Dieser Nachholbedarf könnte - wie im Strategiepapier des DST bereits ausgeführt - in erster Linie durch die Nutzung städtischer Brachflächen gedeckt werden. Je nach Lage der zu nutzenden Brachen könnten im Sinne dezentraler Konzentration gleichberechtigte Quartiersmodelle innerhalb eines Netzes unterschiedlich großer, kompakter Stadtquartiere entstehen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein politisches Umdenken, das sich von heutigen Zonierungslösungen in Richtung der bereits angesprochenen „Patchwork"-Strukur" bewegen müsste; dazu gehöre auch die Anwendung von Verfügungsrechten bis zur Belegung der entsprechenden Flächen.
4.2 Werkzeuge
Am Beispiel Tübingens kann verdeutlicht werden, mit welchen städtebaulichen „Werkzeugen" der neue städtebauliche Ansatz realisierbar ist: Die Stadt betreibt seit neun Jahren eine Entwicklungsmaßnahme auf einer 60 ha großen, in rund zwei Kilometern Entfernung zum Bahnhof und zur Tübinger Altstadt gelegenen Fläche, die größtenteils zu einem ehemaligen Kasernengebiet gehört. Hier sollen in einem Zeitraum von achtzehn Jahren Wohnungen für 6.500 Einwohner sowie 2.500 neue Arbeitsplätze entstehen. Durch die Ausweisung des Areals als städtebauliche Entwicklungsmaßnahme hat sich die Stadt zum Zwischenerwerb aller Flächen und zur Investition der aus dem späteren Verkauf von Bauland erzielten Wertsteigerungen in die Infrastruktur des neuen Stadtteils verpflichtet.
[Seite der Druckausgabe: 27]
Werkzeug 1: Entwicklung klarer Zielformulierungen durch die Kommune
Die Stadt Tübingen hat seit Beginn der Maßnahme deutlich gemacht, dass mit dem Projekt die Schaffung einer städtischen Struktur erzielt werden soll, die sich durch Mischung von betrieblichen und Wohnnutzungen im Quartier sowie effiziente Flächennutzung auszeichnet. Darüber hinaus wurde mit dem Projektmanagement dieses komplexen Vorhabens kein externer Entwicklungsträger, sondern das städtische Sanierungsamt betraut, um den Charakter der Maßnahme als neuartigen Planungsansatz zu unterstreichen. Im Vordergrund dieses Ansatzes steht die Auffassung, Dichte nicht als „Notmaßnahme" zur Beschaffung neuen Baulands, sondern als konstruktives Element zugunsten eines intensiveren gesellschaftlichen Austauschs zu begreifen.

Werkzeug 2: Mischung
Der Gemeinderat Tübingens hat im städtebaulichen Rahmenkonzept für das Projekt festgelegt, alle Bauflächen als Mischgebiete gemäß § 6 BauNVO auszuweisen. Dadurch sind in jedem Wohnquartier die unterschiedlichsten gewerblichen und kulturellen Nutzungen zulässig, sofern sie „das Wohnen nicht wesentlich stören" (im Gegensatz zum Passus „nicht störende Betriebe"). We-
[Seite der Druckausgabe: 28]
sentlich am Tübinger Konzept ist das Ziel, möglichst viele unterschiedliche Nutzungen zuzulassen, um Segregation und Verkehrsprobleme effektiv zu vermeiden. Dies gelingt aus Sicht des Referenten nicht, wenn von vornherein eine Kombination bestimmter Wohnformen (z.B. Reihenhausanlagen, Wohnparks) und Gewerbesegmente (z.B. Bürokomplexe, Museen, Gastronomie, Urban-Entertainment-Centers) im Ausschlussverfahren festgelegt werden.
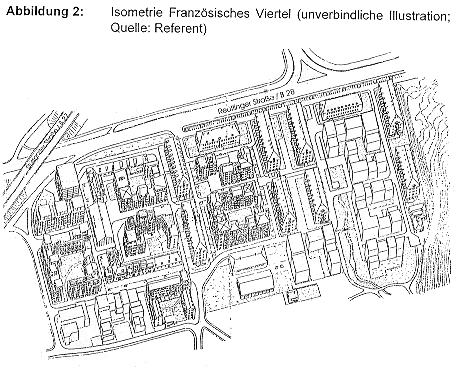
Werkzeug 3: Erhaltung möglichst vieler Altbauten
Altbauten haben als energetische, ökonomische, kulturelle und historische Ressourcen eine große Bedeutung. Jane Jacobs hat in ihrem Buch „The Death and Life of Great American Cities" bereits 1961 darauf hingewiesen, dass ohne Gebäude unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Abnutzung die für ein lebendiges Quartier notwendige Vielfalt an Betrieben nicht existieren kann.
Die Tübinger Erfahrung zeigt, dass der Grundsatz der Erhaltung auch längst abgewirtschafteter Altbauten (in diesem Falle von Pferdeställen, Exerzier- und Fahrzeughallen, Wirtschaftsgebäuden, Werkstätten und Remisen) nicht nur das Bild des entstehenden neuen Stadtteils, sondern auch die Vielfalt der sich
[Seite der Druckausgabe: 29]
hier ansiedelnden Betriebe und kulturellen Angebote positiv beeinflusst. Die Planung wurde auf der Grundlage der vorhandenen historischen Bausubstanz erarbeitet und wird erst während der Umsetzungsphase konkretisiert. Dieses Vorgehen erfreut sich in Tübingen großer Akzeptanz und unterscheidet sich grundlegend von der sonst üblichen Praxis, schwer zu beplanende Bestände zu Beginn der Maßnahmen abzureißen.
Werkzeug 4: Nutzerorientierte Grundstücksvergabe
Im Gegensatz zu der üblichen Planungspraxis, alle im Zusammenhang mit dichter und mehrgeschossiger Bebauung stehenden Maßnahmen geschlossen an Bauträger zu vergeben, legte der Tübinger Gemeinderat fest, Gebäude und Neubaugrundstücke im Rahmen des Südstadt-Projektes den künftigen Nutzern direkt anzubieten. Diese nutzerorientierte, „maßgeschneiderte" Form der Grundstücksvergabe führte zur Selbstorganisation der an den Besonderheiten des Quartierskonzeptes interessierten Nutzer, die gemeinsam an der Konzeption ihrer Etagenhäuser arbeiten. Diese wählen ihre eigenen Architekten, bestimmen ihre individuellen Gebäudekonzepte, klären eigenständig gemeinsame Finanzierungsfragen, stimmen sich mit ihren zukünftigen Nachbarn ab und kommen der Auflage nach, zumindest in den Erdgeschosszonen der Gebäude Betriebe anzusiedeln. Die Grundstücke werden in individuell abgestimmten Parzellengrößen zu festen, vom Gutachterausschuss der Stadt ermittelten Verkehrswerten verkauft. Dadurch entsteht weder ein Preiswettbewerb, noch werden die Bodenpreise seitens der Stadt subventioniert.
Werkzeug 5: Dezentrale Pkw-Stellflächen am Quartiersrand
Das Konzept der kleinräumigen Nutzungsmischung schließt den Gedanken eines „autofreien Wohngebietes" aus. Allerdings lassen die geringe Dimensionierung der Eigentumsparzellierung sowie die gewerbliche Nutzung der Erdgeschosse in der Regel keine Unterbringung von Pkws auf den Grundstücken zu. Das Tübinger Konzept sieht daher vor, im öffentlichen Straßenraum des Quartiers, der vor allem als Aufenthaltsraum genutzt werden soll, nur wenige Stellplätze einzurichten, und dafür an übergeordneten Straßen Autosilos zu errichten. Dieses Konzept entspricht der Forderung des Wiener Verkehrswissenschaftlers Hermann Knoflacher, nach dessen Ansicht ein Autofahrer zum Abstellplatz seines Fahrzeuges ebenso eine Fußwegstrecke zurückzulegen hat wie die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel zur nächste Haltestelle. Damit werden auch Autofahrer zumindest innerhalb ihres Wohnquartiers zu Fußgängern. Darüber hinaus sollen Car-Sharing-Angebote die Anzahl von Privat-Pkw’s reduzieren.
[Seite der Druckausgabe: 30]
In einer „Stadt der kurzen Wege" kann die Finanzierung der erforderlichen Pkw-Stellplätze aus Sicht des Referenten nicht länger Aufgabe der Anbieter von Arbeitsplätzen oder Wohnungen sein. Vielmehr müssten Wege gefunden werden, die Parkierungskosten nach dem Verursacherprinzip den Autohaltern und -nutzern anzulasten, wobei sich allerdings die derzeit geringen Abstellkosten in weiten Teilen der Stadt kontraproduktiv auswirkten.
4.3 Akzeptanz der Maßnahmen
Angesichts der Vorstellung, die Stadt als „Patchwork" aus den bereits beschriebenen Quartiersmodellen zu verstehen, sowie der Zielsetzung, den Anteil durchmischter Strukturen von gegenwärtig 10% auf 20% zu verdoppeln, muss aus Sicht des Referenten nicht in der gesamten Stadtbevölkerung nach Akzeptanz für die „Stadt der kurzen Wege" gesucht werden. Vielmehr reicht es zunächst aus, wenn ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung Interesse an dem Konzept findet und am Aufbau entsprechender Quartiere mitwirkt.
Mittlerweile sind die ersten beiden Bauabschnitte des Tübinger Projektes fertiggestellt. Das Interesse der privaten Baugruppen hat stetig zugenommen. Ein Grund für die große Akzeptanz des Konzeptes liegt in den vergleichsweise günstigen Herstellungskosten, die sich aus den relativ geringen Grundstücksgrößen, der vorgesehenen Baudichte, dem hohen Maß an Selbstorganisation und Eigenleistungen (insbesondere bei Aussiedlern und Migranten) ergeben. Im Entwicklungsbereich wird zu Preisen gebaut, die wesentlich unter dem normalen Eigentumsmarkt liegen. In diesem Zusammenhang betont ein Vorstandsmitglied der Hypobank in einem FAZ-Artikel, preisgünstiger Wohnraum könne erst dann wieder erwartet werden, wenn die Städte bereit wären, Geschossflächendichten von 2,5 bis 3,0 zuzulassen. Dies entspricht exakt den im Tübinger Projekt vorgeschriebenen Dichten, die allerdings bei genauerer Betrachtung laut BauNVO im Mischgebiet mit einem Höchstmaß von GFZ = 1,2 nicht zulässig sind.
Die Akzeptanz seitens (Kredit-)Instituten, Immobilienabteilungen der Banken, der Industrie- und Handelskammer sowie der Wirtschaftsförderung ist im Gegensatz zur positiven Einstellung der direkt Beteiligten eher gering bzw. von Desinteresse und Skepsis geprägt. Dagegen stieß das Projekt im Tübinger Gemeinderat von Anfang an auf Zustimmung und wird nach wie vor als selbstverständlich akzeptiert.
Die Stadt Tübingen hat innerhalb des Entwicklungsbereiches 230 Wohnungen aus dem Garnisonswohnungsbestand übernommen und als Sozialwohnungen zur Verfügung gestellt. Außerdem liegt das Projektareal in unmittelbarer Nachbarschaft zu älteren Sozialwohnungsgebieten, die aufgrund der Offenheit
[Seite der Druckausgabe: 31]
des Projektes an den Prozessen beteiligt sind. Damit werden Befürchtung entkräftet, das Tübinger Konzept könne eher Haushalten mit höheren Einkommen zugute komme.
Bisher ist nur sehr wenig über Standortwünsche von Existenzgründern sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) bekannt. In den beschriebenen neuen Stadtquartieren siedeln sich vor allem Betriebe an, die ausdrücklich nicht in ein Gewerbegebiet oder einen Gewerbepark ziehen wollen, sondern ein Quartier bevorzugen, das auch außergewerbliche Funktionen aufweist. Dabei sei nicht die Wohnkundschaft als rein ökonomischer Faktor, sondern das Milieu des Quartiers der ausschlaggebende Standortfaktor, wie auch der große Anteil an Betrieben zeigt, die nicht als Wohnfolgeeinrichtungen bezeichnet werden können. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass Stadtplanung in Deutschland zu stark am Faktor „Wohnen" orientiert ist und die Belange von KMUs in den vergangenen achtzig Jahren kein Thema städtebaulicher Konzepte gewesen sind.
4.4 Fazit
Die „Stadt der kurzen Wege" ist zur Vermeidung von Segregation und Verringerung von Verkehrsproblemen nicht nur realisierbar, sondern auch notwendig. Durch die Mobilisierung städtischer Brachen für diese Zwecke kann auch das Ziel der Enquetekommission erreicht werden, den Landschaftsverbrauch drastisch einzudämmen. Eine entsprechende Strategie erfordert aus Sicht des Tübinger Stadtplaners
- eine der breiten Öffentlichkeit zu vermittelnde Umorientierung in der Stadtentwicklungspolitik von Bund, Ländern und Kommunen,
- die Etablierung eines fairen wirtschaftlichen Wettbewerbs zwischen den gegensätzlichen Modellen der „zonierten Stadt" und der „Stadt der kurzen Wege",
- die dazu erforderliche Herstellung von größerer „Kostenehrlichkeit" in den Bereichen Stadt- und Mobilitätsentwicklung sowie
- die kreative Nutzung entsprechender städtebaulicher „Werkzeuge".
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Mai 2001