

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
Werner Glastetter:
Zur Reaktivierung des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
[Seite der Druckausgabe: 2]
(01) Das Thema bedarf der Ab- bzw. Eingrenzung [Fn.1: Überarbeitete schriftliche Fassung eines Vertrages, der anläßlich der Tagung des "Kocheier Kreises" am l. Juli 1992 in Bonn gehalten wurde. Für die kritische Durchsicht des Manuskripts danke ich meinem Kollegen, Herrn Prof. Dr. Reinhard Neck; für die Erstellung der Schaubilder bin ich meinem Mitarbeiter, Herrn Dipl.-Volkswirt Frank Vollmann, zu Dank verpflichtet.] . Definiert man (vereinfachend) das in Frage stehende Stabilitäts- und Wachstumsgesetz als Handlungsrichtlinie für eine Regierung, im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung einen angemessenen Wachstumsprozeß aufrechtzuerhalten und diesen gleichzeitig zu verstetigen, so ist damit - im Grundsatz - eine gesamtwirtschaftliche Problemstellung umrissen, auf die die nachfolgenden Überlegungen eingegrenzt werden sollen. Aufgrund dieser Eingrenzung müssen vor allem drei Problemkomplexe ausgeklammert bleiben, die zwar ohne Zweifel erhebliche Rückwirkungen auf den Wachstums- und Verstetigungsprozeß haben, aber gleichwohl mit einem gesamtwirtschaftlich orientierten Gesetz nicht steuerbar sind:
- Ausgeklammert sei - zum einen - die inhaltliche Interpretation dessen, was als "angemessenes" Wachstum verstanden werden kann. Erinnert sei nur an das Stichwort "qualitatives" Wachstum, gerade mit Blick auf die notwendige Infrastrukturausstattung und die ökologische Herausforderung. Hier sind indessen allokationspolitische Fragen aufgeworfen, die zwar keinesfalls Forderungen nach einem Wachstumsverzicht begründen, wohl aber Vorstellungen über Wachstumsinhalte notwendig machen.
[Seite der Druckausgabe: 3]
- Ausgeklammert seien - zum zweiten - die ökonomischen ad-hoc-Herausforderungen, die sich aus dem deutschen Einigungsprozeß ergeben. Hier stellt sich - u.a. - das zweifellos schwierige Finanzierungsproblem. Aber dies ist ein Problem der Mittelaufbringung bzw. des Finanzausgleichs (zwischen Bund, Ländern und Kommunen), insoweit allenfalls ein transitorisches nicht aber ein gesamtwirtschaftliches Wachstums- und Verstetigungsproblem.
- Ausgeklammert sei schließlich - zum dritten - die Frage der Möglichkeiten und Grenzen eines nationalen Alleinganges bei einer gesamtwirtschaftlichen Steuerung - gerade mit Blick auf den Gemeinsamen Markt und die geplante Wirtschafts- und Währungsunion. Gewiß: Je enger diese Grenzen zu ziehen wären, desto eher würde eine noch so optimal angelegte Steuerungsstrategie obsolet. Aber dies ist ein Problem der Umsetzung einer Strategie im internationalen Dialog, nicht eine Frage ihrer inhaltlichen Ausgestaltung.
(02) Nach dieser Abgrenzung läßt sich m.E. die hier relevante Problemstellung eher konkretisieren: Angesichts drohender Wachstumsabschwächungen, wieder gestiegener Preise, noch als ungelöst geltender Arbeitsmarktprobleme, keineswegs als geordnet erscheinender Lage der öffentlichen Haushalte und wieder härter gewordener Verteilungskonflikte stellt sich die Frage, ob das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz noch die adäquaten Antworten gibt, ob - konkreter gesagt - es hinreicht, eine einseitig verengte Interpretation des Gesetzes zu vermeiden, oder ob es erforderlich erscheint (unbeschadet einer juristischen Detailausformulierung), die Vorschriften des Gesetzes zu erweitern oder zumindest zu spezifizieren. Eindeutige - gar objektiv zwingende - Antworten dürften kaum gegeben werden können; die kontroversen Positionen sind bekannt. Was somit bleibt, will man sich nicht auf theoretische Modellaussagen oder spekulative Schätzurteile beschränken, ist die empirische Prüfung der tatsächlichen Entwicklung auf die Frage hin, ob daraus bestimmte konzeptionelle Rückschlüsse für die Ausgestaltung einer konjunkturpolitischen Strategie gezogen werden können. Der vorgegebene Rahmen macht es erforderlich, sich auf einige wenige gesamtwirtschaftliche Eckdaten zu beschränken und die Schlußfolgerungen eher thesenartig vorzutragen. Dabei deckt einerseits der Zeitraum 1950/1989 - für sich genommen - ein Stück Wirtschaftsgeschichte der (ehemaligen) Bundesrepublik Deutschland ab. Andererseits liegen zwischenzeitlich für diese Gebietsabgrenzung auch Daten für 1990/1991 vor. Wobei freilich bei dieser Fortschreibung zumindest als offen gelten muß, ob diese Ergebnisse als Ausdruck einer endogenen Eigendynamik der "alten" Bundesrepublik gewertet werden
[Seite der Druckausgabe: 4]
können, oder ob sie nicht vielmehr als Folge exogener Schocks gesehen werden müssen; der deutsch-deutsche Einigungsprozeß wäre dann interpretierbar als ein Konjunkturprogramm für die "alten" Bundesländer [Fn.2: Die im folgenden vorgestellten Befunde für den Zeitraum 1950/1989 stützen sich einerseits auf die Ergebnisse eines Forschungsprojekts, das im Herbst 1991 veröffentlicht wurde: Werner Glastetter, Günter Högemann, Ralf Marquardt, Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1950 - 1989, Campus-Verlag, Frankfurt/Main - New York 1991. Das dort verwendete Ausgangsmaterial basiert auf dem Stand vom Frühjahr 1991. (Zu Quellenangaben und methodischen sowie theoretischen Fragen sei auf diesen Bericht verwiesen.) Andererseits bat das Statistische Bundesamt zwischenzeitlich Revisionen für 1970 bis 1990 (Heinrich Lützel u.a., Revisionen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, in: Wirtschaft und Statistik, Heft 4/ 1991 - Klaus Schüler, Veronika Spies, Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, in: Wirtschaft und Statistik, 10/1991) und Fortschreibungen für 1990 und 1991 (Hartmut Essig, Wolfgang Strohm, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1991, in: Wirtschaft und Statistik, 3/1992) vorgelegt. Die Ergebnisse wurden berück sichtigt und - bei Bedarf - so umgerechnet, daß sie mit dem Zeitraum 1950/89 vergleichbar sind.] . Für diese zweite Version spricht zumindest, daß mit dem partiellen Auslaufen dieser Schocks - zumindest was die unmittelbaren Nachfrageimpulse angeht, die von den "neuen" Bundesländern auf die "alten" Bundesländer ausstrahlten - die dominierenden gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge wieder durchwirken, was nicht zuletzt die für das laufende Jahr (1992) erwarteten Abschwächungstendenzen (mit)erklären könnte [Fn.3: Soweit Prognosewerte für das Jahr 1992 erwähnt werden, stützen diese sich auf das Gemeinschaftsgutachten der Forschungsinstitute vom Frühjahr 1992: Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft im Frühjahr 1992, in: Ifo-Wirtschaftskonjunktur, 4/1992.] .
(03) Nimmt man die gesamtwirtschaftliche Entwicklung seit der letzten Rezession (1982), in der - cum grano salis - eine vierte Juglarwelle zum Abschluß gekommen war, und vergleicht man die anschließende Entwicklung mit dem zurückliegenden Beobachtungszeitraum, so sind zwei Ausgangstatbestände festzuhalten:
- Der vielfach beschworene "langanhaltende" Wachstumsprozeß - zunächst gemessen an den jährlichen Veränderungsraten des realen Bruttoinlandproduktes (vgl. Schaubild-Nr. l) - erweist sich, anders als nach 1967 bzw. nach 1975, über fünf Jahre hinweg (bis 1987) eher als eine "Waschbrett-Konjunktur", die gerade den langfristig angelegten Trend erreichte. Erst in den Jahren 1988/1989 zeigt sich eine ausgeprägtere Trendüberschreitung. Diese hat sich 1990 und 1991 zwar fortgesetzt; doch hier sind die bereits angemeldeten Vorbehalte angezeigt. Schließlich ist für das laufende Jahr (1992) bereits wieder eine neuerliche Trendunterschreitung angelegt (ca. + 1,5 vH). - Nimmt man überdies den Niveauverlauf auf Indexbasis, und legt man diesem einen Trend für den Zeitraum
[Seite der Druckausgabe: 5]
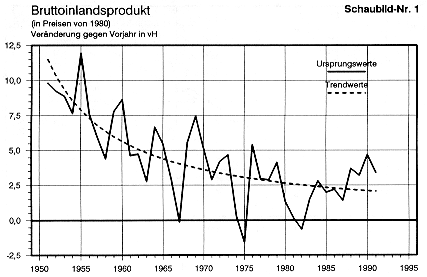
- Die Konsequenzen zeigen sich nicht zuletzt am Arbeitsmarkt. Hier ist ein anhaltendes Arbeitsplatzdefizit zu registrieren (vgl. Schaubild-Nr. 3). Dieses Defizit ist gewiß auch die Folge davon, daß aufgrund der seit Mitte der 70er Jahre steigenden Erwerbsquote die Zahl der (arbeitsplatzsuchenden) Erwerbspersonen angewachsen ist; sie dürfte 1992 deutlich über 31 Mio. liegen und seit der letzten Krise (1982) um reichlich 2,5 Mio. zugenommen haben. Auf der anderen Seite stieg die Zahl der Erwerbstätigen zwar auch an (1992 auf knapp 29,5 Mio.); doch der Anstieg - seit 1982 um etwa 3 Mio. - reichte offensichtlich nicht
1950 bis 1982 zugrunde, der - aus unterschiedlichen Stützbereichen gewonnen - einen relativ stabilen linearen Charakter aufweist, so ist festzustellen, daß - anders als in den Aufschwüngen nach 1967 bzw. 1975 - seit 1982 dieser Trend nachhaltig unterschritten blieb. Im Grunde wurde er sogar im Jahre 1991 noch immer nicht voll erreicht; und im laufenden Jahr ist eher wieder ein Zurückbleiben des Wachstumspfades gegenüber dem Trend angelegt (vgl. Schaubild -Nr. 2). - Insgesamt gesehen, ist somit die Wachstumsdynamik seit 1982 als eher "unterdurchschnittlich" einzustufen.
[Seite der Druckausgabe: 6]
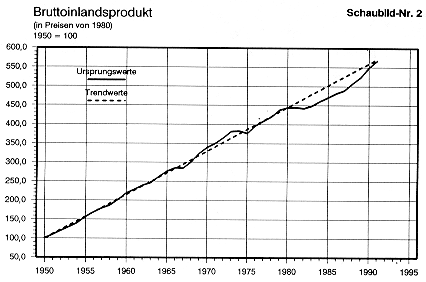
aus, um das Arbeitsplatzdefizit in hinreichendem Umfang abzubauen. - Die Konsequenz liegt auf der Hand: Gemessen an der Arbeitslosenquote (vgl.
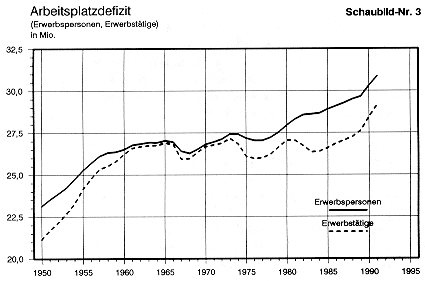
[Seite der Druckausgabe: 7]
Schaubild-Nr. 4) ging die vielfach beschworene Wachstumsdynamik über Jahre hinweg faktisch am Arbeitsmarkt vorbei; trotz des Aufschwungs stieg die Arbeitslosenquote drastisch an und verharrte über sechs Jahre Aufschwung hinweg auf relativ hohem Niveau (ca. 8 - 9 vH). Erst seit 1989 erfolgte eine etwas ausgeprägtere Rückbildung der Quote, deren Höhe Anfang der 90er Jahre aber noch deutlich über dem Niveau von Anfang der 80er Jahre blieb; ein neuerlicher Anstieg im laufenden Jahr (auf ca. 6,5 vH) wird erwartet.
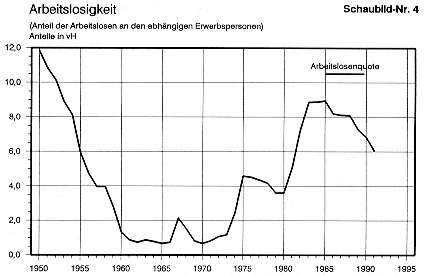
Nimmt man beide Sachverhalte zusammen, so wird man zu dem Ergebnis kommen müssen, daß der Aufschwung (seit 1982) als eher verhalten einzustufen ist - jedenfalls als nicht hinreichend, um die aktuellen Arbeitsmarktprobleme zu bewältigen. Die Frage drängt sich auf, worauf diese Fehlentwicklungen zurückzuführen sind. Dabei sind m.E. drei Problemkomplexe - konzeptioneller Wandel, einseitige Zielkonfliktlösung, fragwürdige Implikationen - auszumachen.
(04) Was - zunächst - den konzeptionellen Wandel angeht, so ist hinlänglich bekannt, daß Anfang der 80er Jahre (nicht nur in der BRD) hinsichtlich der konjunkturpolitischen Strategie die sog. "angebotspolitische Wende" stattgefunden hat. Statt "Nachfragesteuerung" (i.S. von Keynes u.U. mit Hilfe eines "deficit-spen
[Seite der Druckausgabe: 8]
dings") sollten "Freiräume" für das private Angebot geschaffen werden (De-Regulierung, Re-Privatisierung, Lohnkosten-, Steuer- und Zinsentlastung, Konsolidierung der öffentlichen Haushaltsdefizite über eine entsprechende Ausgabendisziplin). Völlig unplausibel schien diese Wende auf den ersten Blick nicht. Unterstellt man die Gültigkeit des Say'schen Theorems (und damit systemimmanente Gleichgewichtstendenzen) sowie die Existenz eines Schumpeter'schen Unternehmertyps (und damit eine Dynamisierung des Wirtschaftsprozesses), so liegt es nahe, eine Nachfragesteuerung als obsolet, ja eher als kontraproduktiv anzusehen. Und schließlich schienen die Stagflationstendenzen in der 70er Jahren und ein nahezu irreversibel erscheinendes Finanzierungsdefizit bei den öffentlichen Händen auf enge Grenzen der konjunkturpolitischen "Machbarkeit" i.S. einer Feinsteuerung hinzudeuten. Gleichwohl erscheint eine etwas differenziertere Sichtweise angezeigt:
Nimmt man den gesamtwirtschaftlichen Auslastungsgrad - konzentriert auf den Unternehmensbereich, ohne Wohnungsvermietung sowie Land- und Forstwirtschaft (vgl. Schaubild-Nr. 5) -, so zeigt sich, daß dieser Auslastungsgrad sich seit 1982 (anders als nach 1967 bzw. nach 1975) nur sehr zögerlich erholte. Im Grunde ist erst 1988/1989 eine spürbar bessere Kapazitätsauslastung zu verzeichnen, die sich dann zunächst fortgesetzt hat, zwischenzeitlich (1992) aber wieder eine Abschwächung (auf ca. 96,5 vH) erfahren dürfte. Beachtet man,
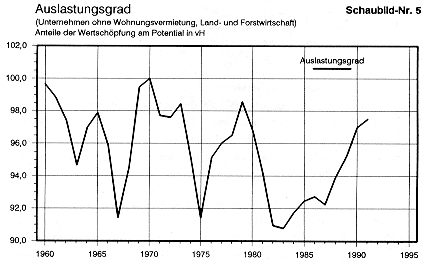
[Seite der Druckausgabe: 9]
daß - in deutlicher Analogie hierzu - der Wachstumsprozeß sich zunächst sehr zögerlich entwickelte, Arbeitsplatzdefizite eher zunahmen, und eine ausgeprägtere Wachstums- und Beschäftigungsexpansion erst mit einem nachhaltigeren Anstieg der Kapazitätsauslastung einsetzte, so ist eben nicht auszuschließen, daß der Kapazitätsauslastung, damit der autonomen Nachfrageentwicklung (und mithin dem Keynes'schen Unternehmertyp), doch ein entsprechend größerer Bedeutungswert zugemessen werden muß, dem eine Angebotsorientierung allein von ihrem Selbstverständnis her nicht die hinreichende Beachtung zuweist.
- Mit dieser Feststellung kann indessen nicht unbedingt - gleichermaßen im Umkehrschluß - die Forderung verknüpft werden, zur globalen antizyklischen Fiskalsteuerung (i.S. eines kurzfristigen deficit-spendings) zurückzukehren. Zwar zeigt die Arbeitslosenquote immer noch in einem gewissen Ausmaß eine Konjunkturreagibilität. Vor allem erscheint die Annahme von crowding-out-Effekten keineswegs als hinreichend sicher belegt. Zum einen ist der Zusammenhang von öffentlichem Finanzierungssaldo (vgl. Schaubild-Nr. 6) und Zinsentwick
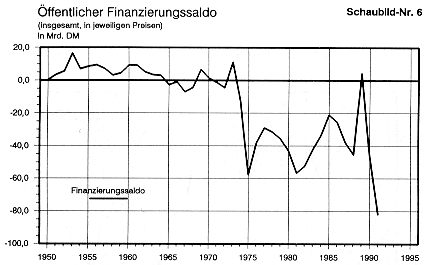
[Seite der Druckausgabe: 10]
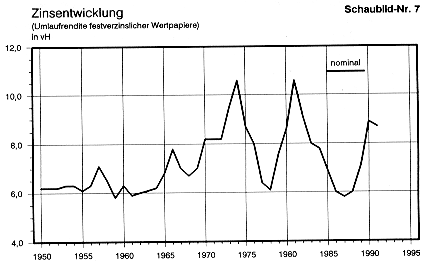
lung (vgl. Schaubild-Nr. 7) keinesfalls eindeutig. Hinzu kommt noch ein weiteres. Die deutlich abgesunkene Fremdfinanzierungsquote im Unternehmensbereich (vgl. Schaubild-Nr. 8), die noch 1991, trotz eines erkennbaren Anstiegs
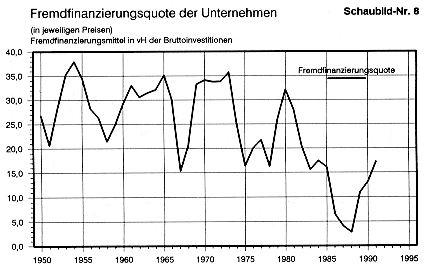
[Seite der Druckausgabe: 11]
seit 1988, deutlich unter dem Durchschnitt des Zeitraumes 1950/82 lag, signalisiert bereits - für sich genommen - eine niedrige Kapitalmarktabhängigkeit. Damit ist die Existenz von crowding-out-Effekten gewiß noch nicht widerlegt; niedrige Fremdfinanzierungsquoten könnten theoretisch auch Folge niedriger (verdrängter) Investitionen sein. Doch berücksichtigt man überdies den tendenziellen Rückgang der Absorptionsquote des Unternehmensbereichs (vgl. Schaubild-Nr. 9), so ist eine Verdrängung von privaten Investitionen durch öffentliche Defizite nur sehr bedingt unterstellbar. (Wie noch zu zeigen ist, hat sie auch gar nicht stattgefunden.)
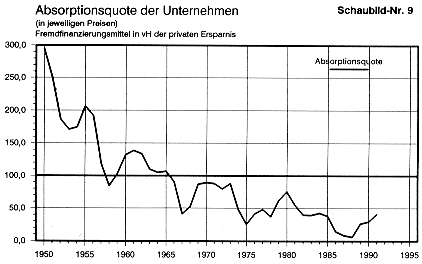
- Wenn dennoch gegenüber einer globalen antizyklischen Fiskalsteuerung Bedenken angemeldet werden müssen, so geschieht dies aus drei Gründen: Erstens dürfte der deutsche Einigungsprozeß eine rein defizitorientierte finanzpolitische Flexibilität erheblich reduziert haben, zumal der negative Finanzierungssaldo (bezogen auf den alten Gebietsstand) drastisch angestiegen ist; und er wird 1992 nochmals ansteigen. Zweitens dürfte (auch bei erkennbarer Konjunkturreagibilität) der Sockelanstieg bei der Arbeitslosenquote auch eine strukturelle Komponente enthalten (Verhärtung aufgrund von Langzeitarbeitslosigkeit), die mit kurzfristigen Programmen kaum korrigiert werden kann.
[Seite der Druckausgabe: 12]
Denn drittens ist nicht auszuschließen, daß kurzfristige Konjunkturprogramme eher Preis- oder Mitnahmeeffekte denn reale Expansions- und Beschäftigungseffekte aufweisen.
Die Gegenüberstellung dieser Überlegungen - das offensichtlich eigenständige Gewicht der Kapazitätsauslastung und somit der Nachfrageentwicklung, die Fragwürdigkeit, crowding-out-Effekte einfach als gegeben zu nehmen, und dennoch die berechtigten Bedenken gegenüber (zu) positiven Erwartungen an eine globale antizyklische Feinsteuerung - lassen zunächst einmal einen Schluß zu: Auch wenn Bedenken gegenüber einer globalen antizyklischen Feinsteuerung gerechtfertigt sind, erweist sich ein grundsätzlicher und somit konzeptioneller Verzicht auf eine "Nachfrageorientierung" in einer konjunkturpolitischen Gesamtstrategie als mindestens genau so verhängnisvoll. Die Ergebnisse der Jahre 1988/89 (als die Bundesregierung mit ihrem Steuerentlastungsprogramm diesem Gesichtspunkt wenigstens in Ansätzen Rechnung trug) und die Ergebnisse der Jahre 1990/91 (als der deutsche Einigungsprozeß letztendlich wie ein umfassendes Nachfrageprogramm wirkte) scheinen dies zu bestätigen. Und genau an diesem Punkt dürfte sich ein erstes Defizit im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz abzeichnen: Mit seinen "Kann"-Vorschriften (z.B. § 6,2 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz) hat es allenfalls einen "Ermächtigungs-" aber keinen "Verpflichtungscharakter", einer Nachfrageorientierung hinreichend Rechnung zu tragen. Insoweit kann die "angebotsorientierte Wende" m.E. (formal) nicht als Verstoß gegen das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz interpretiert werden. Da sie aber zumindest in ihrer Einseitigkeit (materiell) problematisch ist, bliebe zu prüfen, ob der Staat nicht angehalten werden könnte, bei der inhaltlichen Ausgestaltung einer konjunkturpolitischen Strategie das Nachfrageelement unmittelbar und direkt zu beachten (statt spekulativ auf eine Schumpeter'sche Investitions- und Beschäftigungsnachfrage zu setzen).
(05) Was - sodann - die Frage der einseitigen Konfliktlösung angeht, so wurzelt die hier angesiedelte Problematik letztlich darin, daß das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz die "gleichzeitige" Erfüllung der Wachstums- und Verstetigungsziele anmahnt (§ l Stabilitäts- und Wachstumsgesetz). Diese Gleichzeitigkeit ist indessen unterschiedlich interpretierbar. Denkbar ist, daß Kompatibilitätsannahmen zugrunde gelegt werden, wonach die Förderung eines Zieles auch den Zielerreichungsgrad eines anderen Zieles positiv beeinflußt. Denkbar ist, daß aber auch Neutralitätsannahmen zugrunde gelegt werden müssen, wonach die Förderung eines Zieles den Zielerreichungsgrad eines anderen Zieles zwar nicht negativ, aber
[Seite der Druckausgabe: 13]
auch nicht positiv beeinflußt, was bedeutet, daß das zweite Ziel esondert verfolgt werden muß. Noch schwieriger wird die Situation, wenn Konfliktannahmen begründbar sind, die dann das Problem der Güterabwägung aufwerfen. Die Fragestellung erfordert eine etwas differenzierte Prüfung. Klammern wir einmal das Ziel "außenwirtschaftliches Gleichgewicht" aus, weil dieses Ziel auch exogenen Einflüssen - konjunkturbedingte Nachfrage des Auslandes - unterliegt, die nur in engen Grenzen steuerbar sind, so werden drei Zielbeziehungen - Wachstum/Beschäftigung, Wachstum/Preisstabilität, Preisstabilität/Beschäftigung - relevant, die im folgenden kurz zu prüfen sind:
- Was die erste Zielbeziehung - Wachstum/Beschäftigung - angeht, so wird hier mit großer Selbstverständlichkeit Zielkompatibilität unterstellt: Mehr Wachstum führe auch zu mehr Beschäftigung. Einer empirischen Überprüfung hält freilich diese These nur bedingt stand. Natürlich sind, im Jahresverlauf gesehen, Wachstums- und Beschäftigungseffekte positiv korreliert. Doch, im Trend gesehen, ist zu registrieren (vgl. Schaubild-Nr. 10), daß das reale Wachstum des Bruttoinlandprodukts schon seit Mitte der 50er Jahre vom Anstieg der Stundenproduktivität kompensiert, seit Mitte der 60er Jahre gar überkompensiert
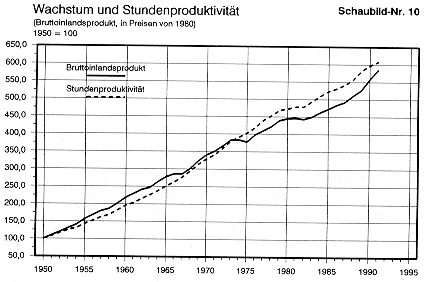
[Seite der Druckausgabe: 14]
wird; seit Anfang der 70er Jahre hat sich die "Produktions-Produktivitäts-Schere" geöffnet, die zwischenzeitlich auch nicht mehr geschlossen werden konnte. Dies ist zwar durchaus plausibel erklärbar (Rationalisierungsprozesse); aber dann ist die Kompatibilitätsannahme nicht mehr einfach unterstellbar. - So ist nicht überraschend, daß schon seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre der Entwicklungspfad des Arbeitsvolumens sich vom Wachstumspfad abkoppelte (vgl. Schaubild-Nr. 11 - in Verbindung mit Schaubild-Nr. 10). Gewiß sind in diesem Zusammenhang einer rein saldenmäßigen Betrachtung - ohne Arbeitszeitverkürzung wäre die Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen der Entwicklung
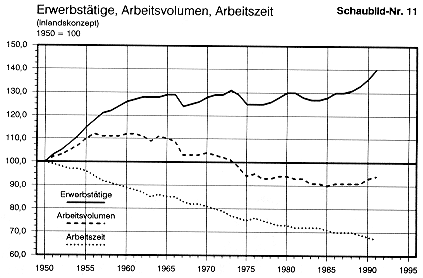
des Arbeitsvolumens gefolgt - erhebliche Bedenken entgegenzubringen: Ohne Arbeitszeitverkürzung wäre die Produktivitätssteigerung vielleicht geringer, mit forcierter Arbeitszeitverkürzung vermutlich höher ausgefallen; ob eine gezielte Arbeitszeitverkürzung mehr Arbeitsplätze schafft oder allenfalls einem Arbeitsplatzabbau entgegenwirkt, mag insoweit offenbleiben. Erkennbar ist aber in jedem Fall, daß eine einfache Kompatibilitätsannahme eben nicht als gegeben unterstellbar ist. Daraus folgt, daß neben dem Wachstum das Beschäfti-
[Seite der Druckausgabe: 15]
- Was die zweite Zielbeziehung - Wachstum/Preisstabilität - angeht, so wird auch hier (obwohl in diesem Falle theoretisch eher strittiger diskutiert) zumindest insoweit Kompatibilität unterstellt, als davon ausgegangen wird, daß "mehr" Preisstabilität als Voraussetzung für "mehr" Wachstum angesehen werden könne. Für diese Hypothese gibt es gute Gründe - mit Blick auf die Kalkulationssicherheit der Investoren; es gibt freilich auch Gegenargumente - mit Blick auf die Renditeerwartungen der Investoren. Feststellbar ist nun zwar (vgl. Schaubild-Nr. 12 - in Verbindung mit Schaubild-Nr. l), daß die Hinnähme höherer Preissteigerungsraten, (bis Mitte der 70er Jahre) im Trend mit einer Wachstumsabschwächung einherging. Doch daraus im Sinne der Kompatibilitätsannahme zu folgern, daß mehr Preisstabilität einen höheren realen Wachstumsprozeß begünstigt hätte, ist freilich auch nicht unproblematisch. Denn feststellbar ist ebenfalls, daß eine Zurückdrängung des Preisanstiegs (von Mitte der 70er bis Mitte der 80er Jahre) eine weiter anhaltende Wachstumsabschwächung
gungsziel als eine eigenständige Zielkategorie behandelt werden muß, wenn die Erwartung, mehr Wachstum führe automatisch zu mehr Beschäftigung, in Zweifel zu ziehen ist.
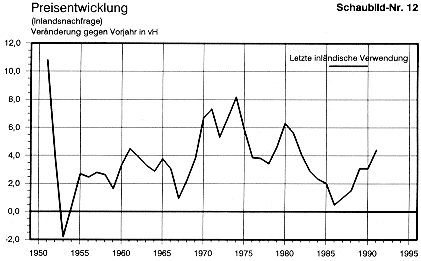
[Seite der Druckausgabe: 16]
- Was die dritte Zielbeziehung - Preisstabilität/Beschäftigung - angeht, so wird in diesem Falle theoretisch reichlich kontrovers diskutiert. Unterstellt man eine Phillips-Konstellation (wenn auch nicht eine zeitlos gültige Kurve), so wäre eine Konfliktbeziehung angezeigt. Vielfach wird auch Neutralität insoweit unterstellt, als davon ausgegangen wird, daß - bei gegebener "natürlicher" bzw. "freiwilliger" Arbeitslosigkeit - die Rückgewinnung eines höheren Maßes an Preisstabilität möglich sei, ohne das Beschäftigungsziel nennenswert zu verletzen. Nicht selten wird über die Wirkungskette, Preisstabilität fördere das Wachstum, und das Wachstum fördere die Beschäftigung, auch bei dieser dritten Zielbeziehung Kompatibilität vermutet. Diese "Phillips-Kurven-Diskussion" soll im folgenden nun freilich nicht im einzelnen aufgearbeitet werden. Festzuhalten ist gleichwohl (vgl. Schaubild-Nr. 12 - in Verbindung mit Schaubild-Nr. 4), daß die Tolerierung eines Anstiegs der Preissteigerungsraten von 1950 bis Anfang der 70er Jahre einherging mit einer Rückgewinnung und Stabilisierung der Vollbeschäftigung, daß - wie bereits 1967 - das seitherige Bemühen um eine Reduktion der Preissteigerungsraten bis Mitte der 80er Jahre wiederum einherging mit einem tendenziellen Anstieg der Arbeitslosenquote; umgekehrt gesehen, ging die Tolerierung eines wieder zunehmenden Preisanstiegs seit 1988 einher mit einem gewissen Abbau der Arbeitslosenquote. Daraus zu folgern, man müsse mit einem höheren Preisanstieg den Abbau der Arbeitslosigkeit "erkaufen", wäre insoweit nicht statthaft, weil dies die Ursache-Wirkungs-Kette auf den Kopf stellte; die Frage ist nicht, ob die Hinnähme höherer Preise zu mehr Beschäftigung führt, sondern ob der Versuch, mehr Beschäftigung zu erreichen, zwingend mit einer sofortigen Preisbeschleunigung einhergeht, zumal unter Nutzung eines gegebenen und mobilisierbaren Produktivitätsspielraums ein höherer Beschäftigungsstand auch ohne einen sich beschleunigenden Preisanstieg zumindest denkbar wäre. Was indessen in jedem Falle gefolgert werden kann,
nicht verhindern konnte. Und darüber hinaus ist zu konstatieren, daß die seitherige Hinnähme zunehmender Preissteigerungsraten einherging mit einer realen Wachstumsbeschleunigung. Damit soll keiner Inkompatibilitätshypothese das Wort geredet werden. Gleichwohl gilt es festzustellen, daß offenbar auch Wachstum und Preisstabilität eigenständige Zielkategorien darstellen, die nicht in eine beliebige Kompatibilitätshypothese gezwungen werden können. Preisstabilität ist nicht per se der Garant für mehr Wachstum; vielmehr ist nicht auszuschließen, daß ein überzogenes Stabilitätsbewußtsein das Wachstum auch behindern kann.
[Seite der Druckausgabe: 17]
ist die Tatsache, daß eine Konfliktsituation nicht einfach auszuschließen ist. Und dann ist die Rückgewinnung von mehr Preisstabilität eben nicht ohne Konsequenzen für eine (negative) Arbeitsmarktentwicklung; auch unter dieser Perspektive müßten Preisstabilität und Beschäftigung einen eigenständigen Zielcharakter erhalten.
Zieht man ein Fazit aus den drei skizzierten Zielbeziehungen, so dürfte erkennbar geworden sein, daß das vom Gesetzgeber angemahnte Kriterium der "Gleichzeitigkeit" nicht dadurch ausgeschöpft wird, daß man auf Kompatibilitäts- bzw. Neutralitätsbeziehungen setzt. Nur dann wäre es, wie geschehen, gerechtfertigt, das Ziel der "Preisstabilität" einseitig in den Vordergrund zu rücken. Damit soll weder die Bedeutung dieses Zieles (im Grundsatz) in Frage gestellt werden noch die (konkrete) Notwendigkeit bestritten werden, seit Mitte der 70er Jahre - mit dem plausiblen Ansinnen, eine drohende Inflationsmentalität zu brechen - Druck auf Preissteigerungserwartungen auszuüben. Was indessen ständig kritisch geprüft werden muß, ist die Frage, ob in jedem Falle Kompatibilität bzw. (zumindest) Neutralität unterstellbar ist. Ist dieses zu bezweifeln, mag es gute Gründe dafür geben, dem Ziel der Preisstabilität gleichwohl ein hohes Gewicht einzuräumen. Nicht zu rechtfertigen ist die Erwartung, damit automatisch (gewissermaßen im Selbstlauf) hinreichende Wachstums- und uno actu hinreichende Beschäftigungseffekte zu erreichen. Wenn indessen Kompatibilität nicht einfach unterstellt werden kann, so bedarf der Begriff "gleichzeitig" (in § 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz) zumindest dahingehend einer Präzisierung, als der Staat gehalten wäre, den skizzierten Zielen in jedem Falle eine selbständige Eigenwertigkeit zuzuweisen - was dann nicht bedeutete, sich auf Kompatibilitätsannahmen zurückzuziehen, sondern die Ziele, für sich genommen, anzustreben.
(06) Was - schließlich - das Problem fragwürdiger Implikationen angeht, so ist damit im Kern nichts anderes gemeint, als daß eine angebotsorientierte Wende notwendigerweise und insoweit auch durchaus folgerichtige Implikationen enthält. Wenn man einmal die ordnungspolitisch-administrativen Implikationen (De-Regulierung, Re-Privatisierung) ausklammert, weil sie ohne die Vorgabe subjektiver gesellschaftspolitischer Werturteile gar nicht diskutierbar sind, so erscheinen derartige Implikationen (ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben) auf drei Ebenen bemerkenswert: Einmal folgt aus dem angebotsorientierten Konzept die Forderung, daß "Freiräume" durch Lohnkostenentlastung geschaffen werden müßten; ob man hier schlicht den Anstieg der Kapitalrentabilität im Auge hat oder (vermeint-
[Seite der Druckausgabe: 18]
lich "objektiver") einen höheren Beschäftigungsstand und eine Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, sei offen gelassen; zum zweiten folgt aus dem Konzept die Forderung, daß die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte auf der Ausgabenseite erfolgen müsse (eine Einnahmesteigerung müßte an sich der Logik des Konzepts entgegenstehen); zum dritten folgt daraus, daß der marktwirtschaftliche Anpassungsmechanismus letztlich optimal den Strukturwandel bewältigte.
- Was die erste Implikation angeht, so ist die Lohnkostenentlastung ein notwendiges Pendant eines angebotsorientierten Konzepts. Freilich: Sie hat seit 1982 massiv stattgefunden. Dies gilt - zum einen - für den Verlauf der Bruttolohnquote (vgl. Schaubild-Nr. 13), wo sich - global wie beschäftigtenstrukturbereinigt - ein massiver Rückgang abzeichnet. Dies gilt - zum zweiten - für den Verlauf der Nettolohnquote (vgl. Schaubild-Nr. 14), wo sich zeigt, daß der Staat die angelegte Marktentwicklung nicht korrigiert, sondern eher akzentuiert hat; der Rückgang der Nettolohnquote ist - global wie beschäftigtenstrukturbereinigt - noch ausgeprägter. Diese Entwicklung soll nicht zum Anlaß für ein "Moralisieren" genommen werden ("Verteilung von unten nach oben"), wenngleich Anlaß bestünde, zumal erst im Jahre 1992 sich eine - freilich bescheidene - Korrektur
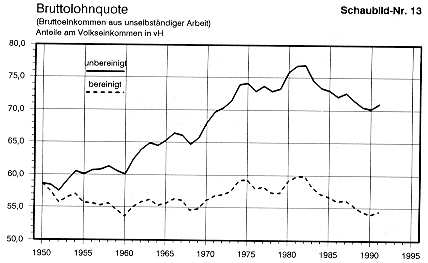
[Seite der Druckausgabe: 19]
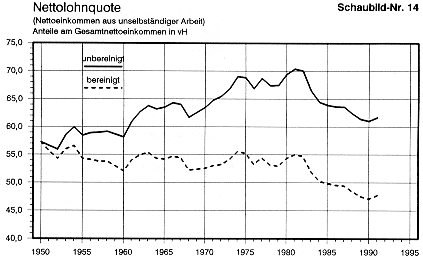
abzeichnet. Die Tatsache, daß die Verteilungskonflikte härter geworden sind, sollte zumindest nicht überraschen. Doch auch ohne gesellschaftspolitische Wertung zeigt sich die Problematik aus "rein" ökonomischen Überlegungen. Lohnzurückhaltung impliziert Kaufkraft- und damit Nachfrageausfall. Das angebotsorientierte Modell kommt damit zwar "theoretisch" zu Rande: Der Kaufkraftausfall werde durch Mehrbeschäftigung kompensiert, und der Realkasseneffekt komme flankierend hinzu. Diese theoretischen Überlegungen brauchen hier nicht diskutiert zu werden. Doch soviel ist sicher: Wenn diese Modellprämissen nicht erfüllt sind, scheitert das Konzept; die erste Implikation erweist sich dann auch unter ökonomischen Kriterien als fragwürdig. Mit diesen Feststellungen soll nicht - im Umkehrschluß - der (expansiv angelegten) Kaufkrafttheorie des Lohnes das Wort geredet werden; hiergegen wären mit guten Gründen (Vorpreschen des Kosteneffektes) Bedenken anzumelden. Nicht zuletzt könnte - bei gegebener Phillipskonstellation - eine aktive Beschäftigungspolitik desavouiert werden. Aber gerade dann zeichnet sich die dringende Notwendigkeit ab, das Verteilungsproblem (über eine substantielle Reaktivierung der konzertierten Aktion gemäß § 3 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz), gerade
[Seite der Druckausgabe: 20]
- Was die zweite Implikation angeht, so wird die Ausgabenzurückhaltung der öffentlichen Hand zu einem notwendigen Pendant eines angebotsorientierten Konzepts. Freilich: Wenn man davon ausgehen muß, daß die Kürzung von Transfer- und Verbrauchsausgaben gewissen rechtlichen und politischen Grenzen unterliegt - mag man auch diese Grenzen ausloten und ausweiten -, so impliziert dieses Konzept letztendlich eine Kürzung bzw. Streckung jener öffentlichen Ausgaben, die vermeintlich einen eher disponiblen Charakter aufweisen, nämlich der Investitionsausgaben. Differenziert man hier einmal den gesamten Investitionsprozeß , so zeigt sich, daß die privaten Investitionen - ganz ausgeprägt die Ausrüstungen, etwas verhaltener die gewerblichen Bauten - nicht nur Anschluß an den angelegten Trend gehalten haben; eher ist um die Wende zu den 90er Jahren eine Wachstumsbeschleunigung erkennbar (vgl. Schaubild-Nr. 15). Der unterdurchschnittliche Stand der Fremdfinanzierungsquote (vgl. Schaubild-Nr. 8) und der tendenzielle Rückgang der Absorptionsquote (vgl. Schaubild-Nr. 9) wurzeln also nicht in einer zu schwachen privaten Investiti
unter gleichzeitiger Beachtung von Kosten- und Nachfrageeffekten, in eine konjunkturpolitische Strategie einzubinden.
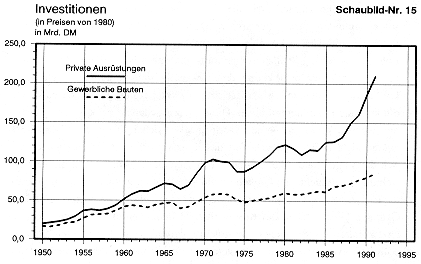
[Seite der Druckausgabe: 21]
onstätigkeit, sondern offenbar (und die Lohnquotenentwicklung bestätigt dies auch) in einer drastischen Gewinnbegünstigung in Verbindung mit dem entsprechenden Zufluß von Eigenmitteln; damit wird die Annahme von crowding-out-Effekten zusätzlich fragwürdig. Freilich sind Defizite bei den Wohnbauten und - v.a. - bei den öffentlichen Investitionen festzumachen; im letzten Fall haben auch die Jahre 1990/1991 keine nennenswerte Korrektur des hier angelegten Trends gebracht (vgl. Schaubild-Nr. 16). Auch hier führt somit ein angebotsorientiertes Konzept - ungeachtet seiner gesellschaftspolitischen Implikationen (Wohnraum- und Infrastrukturdefizite) - gesamtwirtschaftlich gesehen zu problematischen Nachfragedefiziten. Daran gemessen, wäre zu prüfen, ob die reichlich formalistische Behandlung öffentlicher Investitionen (§ 10 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz) dahingehend präzisiert werden sollte, daß ein Konsolidierungsprogramm nicht auf Kosten der öffentlichen Investitionen gehen dürfe, sondern daß hier in jedem Falle eine Verstetigung erreicht werden müsse. Darüber hinaus müßte die Einnahmeseite (über Ergänzungs-, Arbeitsmarkt- oder Solidaritätsabgaben) eben doch stärker in die Konsolidierungsaufgabe einbezogen werden, was - mit Blick auf die (relativ) geringere Konsumneigung bei (relativ) höheren Einkommen - auch nicht in diesem Umfang nachfrageschädlich wäre.
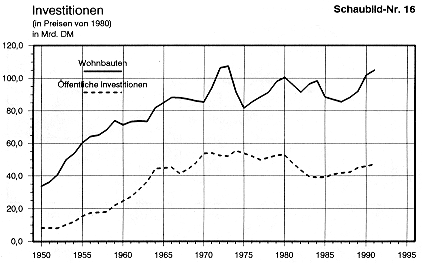
[Seite der Druckausgabe: 22]
- Was schließlich die dritte Implikation eines angebotsorientierten Konzepts angeht, nämlich den in einem gesamtwirtschaftlichen Prozeß nun einmal angelegten Strukturwandel marktwirtschaftlichen Steuerungsmechanismen anzuvertrauen, so gibt es für diese Forderung - mit Blick auf die in einer funktionsfähigen Marktwirtschaft angelegten (aktiven) Innovations- und (passiven) Anpassungsflexibilitäten - gute Gründe, was ein soziales Abfedern ebenso wenig ausschließt wie eine ergänzende Förderung des Strukturwandels, wenn der Markt zu versagen droht. Diese Fragen seien hier ausgeklammert. Entscheidend ist, daß ein gesamtwirtschaftliches Problem sich dann ergibt, wenn am Arbeitsmarkt zusätzliche Defizite entstehen, weil Freisetzungseffekte (des Primär- und Sekundärsektors) und Absorptionseffekte (des Tertiärsektors) inkongruent werden, d.h. sich nicht mehr kompensieren. Bislang hat der Saldierungsmechanismus noch "geklappt": Seit Mitte der 60er Jahre bis in die Gegenwart haben Primär- und Sekundärsektor zusammen zwar gut 4 Mio. Erwerbstätige freigesetzt, im Tertiärsektor stieg die Zahl der Erwerbstätigen aber um ca. 5 Mio. an. Auffällig ist indessen, daß trotz des erkennbaren Strukturwandels (vgl. Schaubild-Nr. 17) die Zuwachsraten bei der Beschäftigung im Tertiärsektor (vgl.
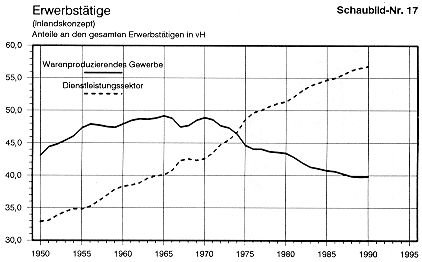
[Seite der Druckausgabe: 23]
Schaubild-Nr. 18) ebenfalls einem sinkenden Trend folgen (auch ohne so ausgeprägte Konjunkturreagibilität wie im Sekundärsektor); nicht auszuschließen ist, daß die Nutzung von Rationalisierungspotentialen auch im Tertiärsektor (etwa: Handel, Banken, Verkehr, Versicherungen) dessen arbeitsmarktpolitische Absorptionsfähigkeit vermindert. Die Aussage, den Strukturwandel dem Marktprozeß anzuvertrauen, bliebe davon unberührt (die mögliche Gefahr wäre die Erhaltung ineffizienter Strukturen); die Vermutung, daß der Staat gleichwohl dann dem Beschäftigungsziel erst recht verpflichtet bliebe, hätte in der tatsächlichen Strukturentwicklung eine unmittelbare zusätzliche Stütze.
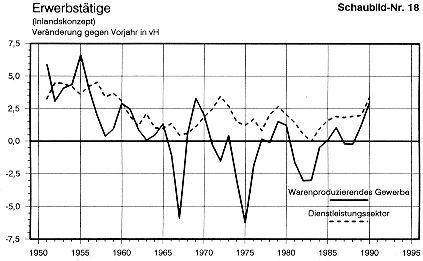
Zieht man Konsequenzen aus den drei skizzierten Aspekten, so dürfte erkennbar geworden sein, daß eine konjunkturpolitische Strategie sich nicht nur verstärkt mit Zielkonflikten auseinandersetzen muß, sondern auch mit Problemen, die sich aus Verteilungskonflikt, öffentlicher Investitionszurückhaltung und Strukturwandel ergeben.
[Seite der Druckausgabe: 24]
(07) Es wurde kein umfassendes und konsistentes Alternativkonzept vorgestellt. Dies war auch nicht die Absicht. Es sollte auf Defizite (konzeptioneller Wandel - einseitige Zielkonfliktlösungen - fragwürdige Konzeptimplikationen) hingewiesen werden, die sich nun aber ein einem umfassenden Sinne präzisieren lassen:
- Die "angebotspolitische Wende" schien nicht nur auf den ersten Blick plausibel. Sie hat darüber hinaus auch konzeptionelle Vorzüge. Sie begründet eine vermeintlich eindeutige "Rollenzuweisung" für die Politikbereiche: Die Lohnpolitik übernimmt die beschäftigungspolitische Verantwortung; die Geldpolitik kann sich ganz auf das Ziel der Preisstabilität konzentrieren; die Finanzpolitik ist gehalten, durch Ausgabenzurückhaltung und Steuererleichterung Freiräume für den Wachstumsprozeß zu schaffen, dessen "Angemessenheit" letztendlich durch das Marktergebnis determiniert ist. Und genau diese Rollenzuweisung ermöglicht eine 'Trendorientierung" der Politik und befreit sie von allen Schwierigkeiten, die mit einer "diskretionären" Steuerung nun einmal verbunden sind.
- Die "angebotspolitische Wende" erwiese sich auf den zweiten Blick aber nur dann als tragfähig, wenn die skizzierten Defizite nicht vorlägen. Doch genau davon kann nicht ausgegangen werden. Natürlich hat die Lohnpolitik (auch) eine beschäftigungspolitische Verantwortung; natürlich ist die Geldpolitik (auch) dem Stabilitätsziel verpflichtet; und natürlich kann die Finanzpolitik ihren Beitrag leisten. Freiräume für den Wachstumsprozeß (etwa über die Begünstigung von Sachinvestitionen) zu schaffen. Aber die Einseitigkeit der Rollenzuweisung erweist sich - gerade mit Blick auf die Defizite - problematisch: Dann aber bleibt der Staat für alle skizzierten Zielbereiche in der Pflicht (wie sie in § l Stabilitäts- und Wachstumsgesetz fixiert sind), mag auch eine diskretionäre Steuerung Probleme aufwerfen. Ihre Bewältigung ist - wenn auch nur bedingt erreichbar - letztendlich ein Pendant zum Sozialstaatsgebot.
Ob nun grundsätzlich und in welchen Grenzen den skizzierten Defiziten in der Weise Rechnung getragen werden kann, daß sie in einer juristischen Fassung ihren Niederschlag finden und die Vermeidung solcher Defizite dann operational wird, muß hier offen blieben. Die Frage selbst, nämlich, ob das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz reaktiviert werden sollte, würde ich bejahen - indessen mit Blick auf Akzentuierung, Präzisierung und Ergänzung.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Oktober 1999