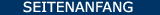![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

Weichenstellungen für die Zukunft : Elemente einer neuen Gesundheitspolitik ; vorlegt zur Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung, Gesprächskreis Arbeit und Soziales, "Mittel- und langfristige Gestaltung des deutschen Gesundheitswesens" am 5. Dezember 2001 in Berlin / Gerd Glaeske ... [Hrsg. vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Forschungs- und Beratungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Arbeit und Sozialpolitik - [Electronic ed.] - Bonn, 2001 - 27 S. = 90 KB, Text - ISBN 3-89892-037-2
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2002.
© Friedrich-Ebert-Stiftung
- 2.1 Fehlsteuerungen im deutschen Gesundheitswesen
- 2.2 Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitswesens im internationalen Vergleich
- 2.3 Struktur und Qualitätsdefizite des deutschen Gesundheitswesens
- 2.4 Institutionelle Blockaden des deutschen Gesundheitswesens
- 2.5 Chancen und Konsequenzen des medizinischen Fortschritts
- 2.6 Herausforderungen des demografischen Wandels
- 2. 7 Kostenentwicklung des deutschen Gesundheitswesens
- 4.1 Solidarische Strukturen sichern
- 4.2 Selbstbestimmung und Eigenverantwortung stärken
- 4.3 Versorgung für alle und Finanzsicherheit erhalten
- 4.4 Den Fortschritt medizinisch bewerten und seine Chancen nutzen
- 4.5 Effizienz und Qualität verbessern
- 4.6 Prävention stärken
- 4.7 Die Qualifizierung im Gesundheitsbereich verbessern
- 5.1 Eine moderne, solidarische Wettbewerbsordnung aufbauen
- 5.2 Qualitätssicherung als Instrument einer modernen Gesundheitspolitik
- 5.3 Bedarfsgerechte und effiziente Versorgungsstrukturen entwickeln
- 5.4 Präventive Instrumente einer modernen Gesundheitspolitik ausbauen
- 5.5 Moderne und flexible Steuerungsinstrumente entwickeln
- 5.6 Transparenz und differenzierte Nutzung der unterschiedlichen Angebote im Gesundheitswesen erhöhen
- 5.7 Solidarische Elemente im Gesundheitssystem verbreitern
- 5.8 Beschäftigungschancen im Gesundheitssystem nutzen, Qualifizierung und Fortbildung verbindlich regeln
1 Aufbruch für eine neue Gesundheitspolitik
2 Herausforderungen und Strukturprobleme des deutschen Gesundheitssystems
3. Innovation und solidarischer Ausgleich – die Politik seit 1998
4 Prinzipien einer solidarischen Gesundheitspolitik
5. GKV 2010 – Eckpunkte und Instrumente einer Strukturreform des Gesundheitssystems
6. Zukunft gewinnen durch Modernisierung und soziale Verantwortung
[Seite der Druckausg.: Titelblatt]
Prof. Dr. Gerd Glaeske
Prof. Dr. Dr. Karl W. Lauterbach
Prof. Dr. Dr. hc. Bert Rürup
Prof. Dr. Jürgen Wasem
Weichenstellungen für die Zukunft
Elemente einer neuen Gesundheitspolitik
Vorgelegt zur Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung,
Gesprächskreis Arbeit und Soziales,
"Mittel- und langfristige Gestaltung des deutschen Gesundheitswesens"
am 05. Dezember 2001 in Berlin
[Seite der Druckausg.: Titelblatt (Rückseite)]
- Hiermit legen wir eine Veröffentlichung der Friedrich-Ebert-Stiftung, Gesprächskreis Arbeit und Soziales, für die Tagung am 5. Dezember 2001 in Berlin vor. Die Ausführungen und Schlussfolgerungen sind von den Autoren in eigener wissenschaftlicher Verantwortung vorgenommen worden.
1 Aufbruch für eine neue Gesundheitspolitik
Solidarität und Gemeinwohlorientierung einer Gesellschaft zeigen sich immer dort, wo es darum geht, Menschen in existenziellen Notlagen zu helfen. Dies gilt insbesondere, wenn es um die Gesundheit und die medizinische Versorgung von Kranken geht. Menschen können nur dann an der Gesellschaft teilhaben und auch Eigenverantwortung übernehmen, wenn sie gesundheitlich dazu in der Lage sind. Gesundheit und Gesundheitspolitik ist deshalb nicht allein Privatsache, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe.
Solidarität und Verantwortung in der Gesundheitspolitik heißt daher, die Gesunden helfen den Kranken, die Jungen den Alten, die sozial besser Gestellten den sozial Schwachen. Dies ist kein Prinzip von gestern, sondern ein Grundwert einer modernen und humanen Gesellschaft. Wer dies aufgibt will eine Gesellschaft mit weniger Solidarität und Gemeinwohlorientierung.
Das deutsche Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen und Reformnotwendigkeiten. Denn die bestehenden Strukturen, Institutionen und Instrumente werden zunehmend ineffizient sowohl für die Leistungserbringer, die Beitragszahler wie für den einzelnen Patienten.
Bei der Reform des Gesundheitssystems geht es um eine evolutorische Weiterentwicklung, nicht aber um einen Ersatz des bestehenden Systems. Ziele sind:
- bessere Qualität und stärkere Patientenorientierung,
- verbesserte Effizienz- und Kostenstruktur bei hoher Leistungsfähigkeit und Versorgungssicherheit für den einzelnen Patienten,
- Bewertung des medizinischen Fortschritts und eine Bewältigung der im demografischen Wandel der Gesellschaft angelegten Probleme,
- eine qualitäts- und effizienzorientierte Wettbewerbsordnung des Gesamtsystems, die Verkrustungen, Ständestrukturen und Lobbyinteressen aufbricht und flexible und moderne marktwirtschaftliche Steuerungsinstrumente durchsetzt und
- eine Gesundheitspolitik, die präventive Maßnahmen stärkt und das Gesundheitsverhalten des Einzelnen verbessert.
Das Gesundheitssystem ist heute nicht einfach nur ein Sozialsystem, es ist ein mächtiger, in einer alternden Wohlstandsgesellschaft wachsender Wirtschaftszweig mit einem Volumen von 413 Mrd. DM pro Jahr. In ihm bündelt sich ein bislang kaum durchschaubares und steuerbares Geflecht von Wirtschafts-, Stan-des-, Lobby- und politischen Interessen. Der Verbraucher, der Patient, fühlt sich überfordert gegenüber diesem System und den jeweiligen Interessengruppen, die häufig die Patienten für ihre Interessen instrumentalisieren.
Die jeweiligen Interessengruppen im Gesundheitsbereich führen seit Jahren einen erbitterten Verteilungskampf um ihren Anteil an einem begrenzten Gesamtbudget.
[Seite der Druckausg.: 2]
Die Politik versucht seit Jahren dieses System zu gestalten. Sie ist dabei mit einem komplexen Geflecht konfrontiert, das gut organisiert die eigenen Interessen und Strukturen bewahren will und in zunehmenden Maße Reformen zu blockieren versucht. Die Gesundheitspolitik der 90er hat mit Ausnahme des GSG bestenfalls zu Notreparaturen bzw. kurzfristigen Kostendämpfungen geführt.
Die 1998 eingeleitete neue Gesundheitspolitik hat sich zunächst auf überfällige Korrekturmaßnahmen konzentriert, um dann strukturverändernde Maßnahmen einzuleiten, wie etwa beim Risikostrukturausgleich, bei der Einführung von Fallpauschalen, der Wahlfreiheit bei Kassen, der integrierten Versorgung, der Wiedereinführung der Primärprävention, der Stärkung der Patientenrechte durch die Krankenkassen.
Jetzt muss es um eine neue Phase der Gesundheitspolitik gehen. Der Aufbau einer modernen, qualitätsorientierten Wettbewerbsordnung ist notwendig, bei der der Staat
- die Rahmenbedingungen für eine patientenorientierte Wettbewerbsordnung, die Effizienz, Qualität und Solidarität sichert,
- die Qualitätsziele für die Leistungen und Anbieter,
- die solidarisch zu finanzierenden Leistungen in der GKV und
- den gesetzlichen Rahmen
definiert.
Auf dieser Grundlage kann ein "solidarischer Wettbewerb" die verkrusteten Strukturen im Gesundheitsbereich neu ordnen und zu mehr Patientenorientierung beitragen.
Wettbewerb heißt dabei nicht, die solidarischen Finanzierungsstrukturen aufzugeben, Wahl- und Regelleistungen einzuführen, immer mehr Gesundheitsrisiken oder –leistungen zu privatisieren.
Wettbewerb heißt vielmehr, den Rahmen für eine solidarische Wettbewerbsordnung klar festzulegen und klare Beziehungen zwischen den Akteuren im Gesundheitssystem zu definieren und die Rolle des Patienten im Gesundheitssystem zu stärken.
Dies wird nicht kurzfristig möglich sein. Aber Schritt für Schritt müssen die entscheidenden Weichenstellungen vorgenommen werden, um den Strukturwandel im Gesundheitssystem voranzubringen. Dabei muss die Politik ihre Rolle ebenso neu definieren, wie Ärzte, Krankenkassen, Pharmaindustrie etc.
Wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion zur Gesundheitspolitik, in der Ziele, Strukturen und die Verantwortung der einzelnen Akteure erörtert werden. Ein Deutsches Gesundheitsforum kann dazu einen Beitrag leisten. Dort, wo gemeinsame Lösungen vorstellbar sind, sollten sie umgesetzt werden. Dort, wo dies nicht geht, muss die Politik im Sinne eines solidarischen, wettbewerbsorientierten Gesundheitssystems entscheiden.
[Seite der Druckausg.: 3]
Die Zeit der Kampagnenpolitik im Gesundheitswesen, die Zeit der wechselseitigen Interessensblockaden und das Schwarze-Peter-Spiel müssen ein Ende haben. Letztlich kann dabei niemand gewinnen. Die Verlierer stehen allerdings fest, die Beitragszahler und die Patienten.
Dies ist ein ehrgeiziges Ziel, aber die Zeit dafür ist reif, diese Debatte verantwortlich zu eröff-
nen. Dazu soll dieses Papier einen Beitrag leisten.
2 Herausforderungen und Strukturprobleme des deutschen Gesundheitssystems
2.1 Fehlsteuerungen im deutschen Gesundheitswesen
Die Strukturen des deutschen Gesundheitssystems sind über Jahrzehnte gewachsen. Die unterschiedlichen Interessen haben sich in einer Form organisiert, wie in keinem anderen gesellschaftlichen oder sozialpolitischen Bereich. Diese wechselseitige Interessensblockade unterschiedlicher Akteure hat zu einem System des kleinsten gemeinsamen Nenners geführt. Diese Negativkorrektur unterschiedlicher Interessen unterminiert die Leistungsfähigkeit und Akzeptanz des deutschen Gesundheitssystems. Alle Akteure im Gesundheitssystem müssen sich wieder auf die hippokratische Maxime, die effiziente und qualitätsgesicherte Versorgung des Patienten, besinnen. Dazu ist als ein neuer Grundkonsens in der Gesundheitspolitik notwendig. Die Orientierung an den Interessen der Einzelakteure im Gesundheitsbereich blockiert das System und sichert keine Zukunft mehr, weder für Ärzte, Standesorganisationen, Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie oder Patienten.
Die Strukturen im Gesundheitssystem haben – so der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen – zu einer Parallelität von Über-, Unter- und Fehlversorgung geführt. Diese Fehlsteuerungen sind das Kernproblem für ein patienten-, gesundheits- und effizienzorientiertes Gesundheitssystem.
Der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen hat für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen die wichtigsten Versorgungsprobleme im Detail untersucht. Dieser Rat kommt zu dem Ergebnis, dass es in allen untersuchten Bereichen in erheblichem Umfang zu einem Nebeneinander von kostensteigernden Qualitätsproblemen und Versorgungsdefiziten, zu einer Parallelität von Über-, Unter- und Fehlversorgung gekommen ist. Diese Fehlsteuerungen sind das Kernproblem für ein patienten-, gesundheits- und effizienzorientiertes Gesundheitssystem. Besonders ausgeprägt sind die Probleme erwartungsgemäß bei den chronischen Erkrankungen.
- Weniger als die Hälfte der Patienten mit Herzinfarkten in Deutschland werden so behandelt, wie dies dem wissenschaftlichen Standard entsprechen würde.
- Patienten mit Diabetes konnte trotz zahlreicher Modellprojekte keine flächendeckende Verbesserung der Versorgung angeboten werden.
[Seite der Druckausg.: 4]
- Es fehlt im Gegensatz z.B. zu den Niederlanden, Großbritannien, und Schweden ein flächendeckendes qualitätsgesichertes Früherkennungsprogramm für die Brustkrebsvorsorge durch Mammographiescreening. Der aktuelle wissenschaftliche Standard wird entweder nicht ausreichend gekannt oder umgesetzt.
- Bei der Krebsbehandlung können im deutschen Gesundheitssystem in 11 von 12 Krebsarten schlechtere Überlebensraten als in den Vereinigten Staaten nachgewiesen werden.
Eine zukünftige Gesundheitspolitik muss diese Fehlsteuerungen im System korrigieren.
2.2 Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitswesens im internationalen Vergleich
Das deutsche Gesundheitssystem hatte im internationalen Vergleich über Jahrzehnte hinweg eine Vorbildfunktion. Zu den Stärken des Systems im internationalen Vergleich zählen nach wie vor
- die ausreichend vorhandenen modernen medizinischen Einrichtungen,
- eine Versorgung ohne Wartelisten, ein schneller und unbürokratischer Zugang zum Arzt und Krankenhaus,
- ein umfassender Versicherungsschutz für alle sowie
- ein einheitlicher und vom Einkommen unabhängiger Leistungsanspruch, der allein durch das medizinisch Notwendige definiert wird.
Dennoch hat Deutschland seine Vorbildfunktion im Gesundheitswesen in den letzten Jahren eingebüßt. Die Lebenserwartung in Deutschland liegt unter dem Durchschnitt der Länder der Europäischen Union und hat sich in den letzten zehn Jahren weniger gut entwickelt als die in vielen unserer Nachbarländer. Im OECD-Vergleich der Sterblichkeit für wichtige Volkskrankheiten zeigen sich für Deutschland fast immer durchschnittliche oder über dem Durchschnitt vergleichbarer europäischer Länder und den Vereinigten Staaten liegende Werte.
Vergleicht man z.B. die Sterblichkeit aufgrund eines Schlaganfalls, Diabetes mellitus, Darmkrebs und Brustkrebs in Deutschland mit der Sterblichkeit in Frankreich, Italien, England, Finnland, Schweden, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten, so belegt Deutschland für jede dieser Erkrankungen einen der drei schlechtesten Plätze.
Vom Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen der konzertierten Aktion im Gesundheitswesen wurden gravierende Qualitätsdefizite festgestellt, die zu dieser Entwicklung mit beigetragen haben. Das deutsche Gesundheitssystem, so lautete die Schlussfolgerung des Rates, leiste nicht, was es leisten könne.
Diesen gravierenden Qualitätsproblemen stehen im internationalen Vergleich deutlich über dem Durchschnitt liegende Ausgaben gegenüber. Nur in den Vereinigten Staaten wird ein höherer
[Seite der Druckausg.: 5]
Anteil des Bruttoinlandproduktes für die Gesundheitsversorgung ausgegeben als in Deutschland. Deutschland hat die höchsten Ausgaben, relativ und absolut, für Gesundheit in Europa.
Im Vergleich mit den oben genannten Ländern belegt Deutschland für die Zahl der Ärzte pro Einwohner, die Krankenhausbetten pro Einwohner und die durchschnittliche Krankenhausverweildauer jeweils einen der drei "Spitzenplätze" mit entsprechenden Konsequenzen für die Beitrags- und Kostenstruktur. Daher hat der Sachverständigenrat die Kosten-Nutzen-Relation des deutschen Gesundheitssystems im internationalen Vergleich als unbefriedigend bewertet.
2.3 Struktur und Qualitätsdefizite des deutschen Gesundheitswesens
Ohne klare Strukturen und Qualitätsziele kann es kein effizientes und hochwertiges Gesundheitssystem geben. Qualitäts- und Versorgungsziele müssen jedoch die Maßstäbe für eine moderne Gesundheitspolitik sein. Strukturen, Institutionen und Instrumente der Gesundheitspolitik müssen sich an diesen Qualitäts- und Versorgungszielen orientieren und nicht umgekehrt.
Fehlen evidenzbasierter Standards und unabhängiger Institutionen in der Qualitätssicherung
Der Sachverständigenrat kommt zu dem Ergebnis, dass die aufgedeckten Qualitätsprobleme ohne Versagen auch der Selbstverwaltung nicht hätten entstehen können. Eine wichtige strukturelle Fehlentwicklung besteht darin, dass die eingeleitete Öffnung für den Wettbewerb nicht zu der notwendigen Verlagerung der Zuständigkeit für die Steuerung der Qualität der Versorgung auf Institutionen außerhalb des Wettbewerbs führte.
So werden die Rahmenbedingungen für die Qualität im Wettbewerb von den Akteuren im Gesundheitssystem, die diese Rahmenbedingungen ausfüllen sollten, selbst bestimmt. Wird z.B. ein neues Entgeltsystem im Krankenhaussystem beschlossen, fällt die Entscheidung über das konkret zu wählende System durch die Vertreter der Krankenkassen und Trägervereinigungen von Krankenhäusern, die von den unterschiedlichen Systemen jeweils Wettbewerbsvorteile oder -nachteile zu erwarten haben. Das System gleicht daher einem Wettkampf, in dem sich die Teilnehmer während des laufenden Spiels die Regeln selbst geben, je nach Interessenslage und Einfluss.
Obwohl der Zusammenhang zwischen einer bestimmten Anzahl an durchgeführten chirurgischen Eingriffen und der Ergebnisqualität gesichert ist, gibt es bislang in Deutschland keine verbindlichen Mindestmengen für die Durchführung selbst sehr komplizierter chirurgischer Eingriffe in Krankenhausabteilungen und ambulant operierenden Einrichtungen. Beispielsweise wird die für die Brustkrebschirurgie notwendige Mindestzahl von Eingriffen zur Sicherung eines bestimmten Qualitätsstandards von einem großen Teil der in Deutschland operierenden gynäkologischen Einrichtungen nicht erreicht.
In den Vereinigten Staaten, Canada, England, Schweden, Finnland, den Niederlanden und zahlreichen anderen Ländern wurden nationale Einrichtungen aufgebaut, die im Auftrag des
[Seite der Druckausg.: 6]
Staates zumindest einen Teil der wichtigsten Anforderungen an die Qualität der Versorgung definieren. Diese gelten dann für alle am Wettbewerb teilnehmenden Einrichtungen und können ohne Einfluss der betroffenen Wettbewerbsteilnehmer im Sinne der Versicherten und Patienten festgelegt werden.
Kein anderes europäisches Land überlässt die Entscheidungshoheit im Bereich der Qualitätsanforderungen so konsequent den unmittelbar betroffenen Wettbewerbern. Für das deutsche Gesundheitssystem existiert z.B. kein nationales Institut für Qualität in der Medizin, das diese Aufgabe im Auftrag des Staates übernimmt. Nicht einmal für die wichtigsten Volkskrankheiten in Deutschland gibt es qualitativ hochwertige wissenschaftliche Behandlungsleitlinien. Dies ist eine von mehreren Ursachen dafür, dass sehr häufig die Versorgung dem wissenschaftlichen Standard nicht entspricht.
Fehlende sektorenübergreifende Versorgung
Im deutschen Gesundheitssystem existiert eine starke Trennung des ambulanten und des stationären Sektors. Beide Sektoren haben ein getrenntes Entgeltsystem, welches die Leistung und insbesondere die Qualität der Versorgung nicht ausreichend berücksichtigt. Durch die Trennung der Budgets, Entgeltsysteme und Zuständigkeiten der beiden Sektoren kommt es zu einer Diskontinuität der Versorgung.
Eine sektorenübergreifende Versorgung, wie sie insbesondere in der Krebsbehandlung und bei fortgeschritten Herz- und Kreislauferkrankungen medizinisch sinnvoll wäre, wird daher selten durchgeführt, obwohl vom Gesetzgeber in der Gesundheitsreform 2000 einige Möglichkeiten dazu geschaffen wurden.
Fehlen eines Hausarztwahltarifs
Im Bereich der ambulanten Medizin hat sich in den skandinavischen Ländern und in den Niederlanden ein Hausarztmodell bewährt, in dem der Hausarzt eine Lotsenfunktion für den Patienten übernimmt. Auch in Deutschland gibt es erste, gute, modellhafte Erfahrungen für eine solche Versorgungsform.
In Deutschland fehlt für den Versicherten bislang die Möglichkeit, sich in ein wirtschaftlich attraktives Hausarztmodell einzuschreiben. Mit einem solchen Modell hätte der Versicherte die Wahl zwischen einem einheitlichen und alles medizinisch Notwendige umfassenden Leistungskatalog mit gezieltem Zugang und dem jetzigen ungesteuerten Zugang zu bestimmten Leistungen.
Eine Wahlmöglichkeit zwischen einem gezielten oder zufälligen Zugang zur Versorgung ist eine bessere Alternative als die häufig geforderte Einschränkung des Leistungskatalogs. Die mit einem solchen Modell einhergehenden Effizienzgewinne durch Vermeidung von Fehlversorgung und Überversorgung können an den Versicherten weitergegeben werden.
[Seite der Druckausg.: 7]
Fehlen von Disease Management Programmen für chronisch Kranke
Bislang fehlen evidenzbasierte Disease Management Programme für chronisch Kranke. Solche Disease Management Programme sind Voraussetzungen in unserem differenzierten unübersichtlichen Gesundheitssystem, die notwendige Leistungen zu vernünftigen Kosten und Qualitätsstandards für die Patienten verfügbar machen. Mit dem jetzt vom Bundestag verabschiedeten Gesetz zur Novellierung des Risikostrukturausgleichs wird das bislang fehlende Disease Management erstmalig gefördert.
Für die Hausarztmodelle als auch für die Chronikerprogramme brauchen die Krankenkassen die Möglichkeit, mit Ärzten, Ärztenetzen und auch Krankenhäusern direkt Behandlungsverträge schließen zu können. Durch die Möglichkeit, mit einzelnen Leistungserbringern zu kontrahieren, kann sich ein Wettbewerb um Wirtschaftlichkeit und Qualität entwickeln.
Voraussetzung zur Sicherung der Versorgungsqualität ist in einem solchen System die Vorgabe verbindlicher, evidenzbasierter Qualitätsanforderungen durch eine neutrale Stelle.
Neuausrichtung des Krankenhausentgeldsystems
Bei vergleichbarer Qualität betragen die Wirtschaftlichkeitsunterschiede im Krankenhaus bis zu 40 %. Mit der Einführung eines in Schritten realisierten bundeseinheitlichen System von Fallpauschalen und gleichzeitig definierten Qualitätsanforderungen wird das bestehende Selbstkostenerstattungsprinzip mit seinen Fehlsteuerungen (Fehlbelegung, Verweildauer) abgelöst. Eine solche Regelung wird zu Kostensenkungen und zu einer sinnvollen Konzentration der Fälle auf dafür entsprechend spezialisierte Einrichtungen und Abteilungen kommen.
Die Gesamtkosten der Versorgung werden bei gleichzeitiger Verbesserung der Qualität sinken. Durch die Verbesserung der Effizienz von planbaren Eingriffen auf spezialisierte Zentren wäre eine gezielte Nutzung frei werdender Ressourcen zur Sicherung einer wohnortnahen, qualitativ hochwertigen Basisversorgung möglich. So könnte zum Beispiel die Möglichkeit von Direktverträgen zunächst auf solche Eingriffe beschränkt werden, die in der Regel planbar durchgeführt werden.
2.4 Institutionelle Blockaden des deutschen Gesundheitswesens
Die Zahl der Kassenärzte hat sich seit 1960 in Deutschland mehr als verdreifacht. Gleichzeitig nimmt das medizinische Wissen in Diagnostik, Therapie und Rehabilitation rasant zu. Folge dieser Entwicklungen ist das Auseinanderfallen der Einheitlichkeit des ärztlichen Berufs.
Daraus hat der Gesetzgeber bereits 1989 (GRG) die Konsequenz gezogen, der kassenärztlichen Selbstverwaltung den Auftrag zu erteilen, die Versorgung in eine hausärztliche und eine fachärztliche zu gliedern. Dieser Auftrag blieb aber ohne Umsetzung durch die Selbstverwaltung, weshalb der Gesetzgeber 1993 (GSG) die Gliederung selbst konkretisieren musste.
[Seite der Druckausg.: 8]
Analog verlief die Entwicklung im Vergütungsbereich. In der EBM-Reform 1987 blieb die behauptete Aufwertung der zuwendungsintensiven Leistungen aus. Auch die darauf hin im GSG vom Gesetzgeber verfügten direkten Vorgaben für die Umstrukturierung der Vergütungsstrukturen durch die gemeinsame Selbstverwaltung brachte nicht die anvisierten Ergebnisse. Deshalb musste dies in der Gesundheitsreform 2000 unmittelbar gesetzlich normiert werden.
Auch in anderen Bereichen hat die gemeinsame Selbstverwaltung vielfach über Jahre hinweg gesetzliche Aufgaben konsequent nicht umgesetzt.
Diese wenigen Beispiele belegen die strukturelle Überforderung insbesondere der kassenärztlichen Selbstverwaltung. Die programmatisch von den Ärzten stets beschworene Einigkeit kann die zunehmend härteren Verteilungskämpfe um Honoraranteile zwischen den Ärztegruppen nicht mehr verdecken. Das Monopol KV ist insbesondere im Hinblick auf Vertrags- und Vergütungsstrukturen zumindest in dieser Form nicht mehr zukunftsfähig.
Der Gesetzgeber hat im Gesundheitsreformgesetz 2000 die Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für alle vollstationären und teilstationären Krankenhausleistungen beschlossen. Danach ersetzt das neue Vergütungssystem zum 01.01.2003 die bisherigen Vergütungsregelungen. Die gemeinsame Selbstverwaltung von Spitzenverbänden und der Deutschen Krankenhausgesellschaft hatte bis zum 30.06.2000 bzw. bis zum 31.12.2001 die entsprechende Umsetzungsstruktur zu vereinbaren. Die Selbstverwaltung einigte sich am 27.06.2000 auf eine Vereinbarung.
Jedoch wurde bislang keiner der in der Grundsatzvereinbarung vom 27.06.2000 einvernehmlich von der Selbstverwaltung festgehaltenen Termine realisiert. Dieses Vorgehen der Selbstverwaltung hat dazu geführt, dass der Einführungstermin 2003 unter keinen Umständen mehr eingehalten werden kann. Selbst der Start 2004 steht zunehmend in Frage.
Dies zeigt, dass die bisherigen institutionellen Strukturen des deutschen Gesundheitssystems selbst zu einem Innovations-, Qualitäts- und Effizienzhemmnis geworden sind. Eine Reform des deutschen Gesundheitssystems muss daher im Rahmen einer solidarischen Wettbewerbsordnung die zunehmenden Interessens-, Verteilungs-, Umsetzungs- und Qualitätsblockaden aufbrechen. Dies liegt sowohl im Interesse der Patienten als auch der anderen Akteure im Gesundheitssystem.
2.5 Chancen und Konsequenzen des medizinischen Fortschritts
Auch in Zukunft werden durch den medizinischen Fortschritt die Möglichkeiten zur Verbesserung der Versorgung zunehmen. Allerdings entsprechen die Möglichkeiten des wissenschaftlichen Standards nur unzureichend der Umsetzung in die Behandlung der Patienten.
Gleichzeitig muss die Unterscheidung zwischen echten Innovationen und Pseudoinnovationen stärker als bisher durchgesetzt werden. Arzneimittel, die im Vergleich zu ihren bereits vor-
[Seite der Druckausg.: 9]
handenen Alternativen nur einen minimalen Zusatznutzen aufweisen, aber deutlich mehr kosten, sind keine echten Innovationen. Der medizinische Zusatznutzen von Innovationen muss stärker als bisher vergleichend bewertet werden.
In Deutschland fehlt, im Gegensatz zu England, Australien und anderen Ländern, ein nationales Institut für die Gewährleistung einer rationalen Arzneimitteltherapie. Nur durch ein solches unabhängiges Institut kann geprüft werden, ob der Nutzen neuer Arzneimittel für die Übernahme in die Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen ausreichend sicher belegt ist. Die undifferenzierte Übernahme von Pseudoinnovationen mit unvertretbar hohen Kosten behindert die Entwicklung echter Innovationen. Hersteller, die sich auf echte Innovationen spezialisiert haben, werden benachteiligt. Für sie fehlt ein Verfahren, welches angemessene Wettbewerbsbedingungen bietet. Dies schadet auch dem Standort Deutschland.
Gleiches gilt für medizintechnische Innovationen in der ambulanten und stationären Versorgung. Nur durch eine konsequente Anwendung der Prinzipien der evidenzbasierten Medizin, des Health Technology Assessments und der Gesundheitsökonomie lässt sich das Potential des technischen Fortschritts voll nutzen. Die notwendigen Bewertungen müssen sich an vernünftigen Kosten-Nutzen-Grundsätzen und Qualitätsstandards orientieren und in verbindlicher Form für alle an diesem Wettbewerb teilnehmenden Anbieter und Krankenkassen umgesetzt werden.
2.6 Herausforderungen des demografischen Wandels
Deutschland wird älter. Der Anteil der über 60-Jährigen wird bis zum Jahr 2040 von heute 20% auf ein Drittel ansteigen, während der Anteil der 20-60-Jährigen von rd. 58% auf 50% sinkt. Das Erwerbstätigenpotential wird im gleichen Zeitraum von 37 auf 24 Millionen Menschen abnehmen. Diese Veränderung der Alterspyramide wird Konsequenzen für das Volumen der Gesundheitsleistungen mit sich bringen und die Einnahmeseite der GKV durch das Verschieben der Verhältnisse von Beitragseinnahmen durch eine geringe Erwerbsbevölkerung und erhöhte Ausgaben belasten.
Die durchschnittlichen Ausgaben je Versicherten nehmen mit dem Alter zu. Dieses altersabhängige Ausgabenprofil ist im Zeitablauf zunehmend steiler geworden, d.h. die Ausgaben für die medizinische Versorgung der älteren Bevölkerung sind pro Person schneller gestiegen als die Ausgaben im Durchschnitt.
Die deutlich höheren Zuwachsraten bei den Ausgaben für die medizinische Versorgung der älteren Bevölkerungsgruppen sind im Zusammenhang mit einer überdurchschnittlich starken Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, aber auch in Verbindung mit einer zunehmend aufwendigeren Versorgung in diesen Altersgruppen zu sehen. Es sind jedoch nicht primär High-Tech-Leistungen, die den Ausgabenanstieg im Alter erklären.
[Seite der Druckausg.: 10]
Die Ausgaben im Rentenalter in der stationären Versorgung spielen eine besonders große Rolle: Sie liegen je Mitglied in der KVdR um das 2,8fache über den Krankenhausausgaben je AKV-Mitglied.
Die Gleichung: "Mehr alte Menschen, höhere Ausgaben für stationäre Versorgung" ist dennoch zu undifferenziert, da bei einer älter werdenden Bevölkerung die Notwendigkeit von medizinischen Leistungen nicht unbedingt ansteigen muss, wenn in den nächsten Jahren auf der Grundlage einer neuen Gesundheitspolitik die Prävention gestärkt wird. Entscheidend ist nicht das durchschnittliche Alter der Bevölkerung, sondern der durchschnittliche Gesundheitszustand.
Gerade bei chronischen Erkrankungen älterer Menschen sind in der Zwischenzeit optimierte Einstellungsmöglichkeiten durch eine weiterentwickelte Pharmakotherapie möglich, die bei den typischen im Alter auftretenden Erkrankungen (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Gelenkerkrankungen usw.) eine effiziente Versorgung ermöglichen. Voraussetzung ist aber auch hier der rationale Umgang mit Arzneimitteln, eine adäquate Indikationsstellung und die Sicherung der Prozessqualität im Sinne einer evidence-based-medicine in der ambulanten Versorgung.
Wir werden die Konsequenzen des demografischen Wandels für das Gesundheitssystem nur dann bei kalkulierbaren Kosten und Beiträgen bewältigen können, wenn Prävention, Qualitätsstandards und effizienter Arzneimitteleinsatz im System durch Strukturmaßnahmen möglich werden. Dies nutzt auch den alten Patienten.
2. 7 Kostenentwicklung des deutschen Gesundheitswesens
In Deutschland wurden 1998 rd. 413 Mrd. DM für medizinische Produkte und Dienstleistungen des Gesundheitswesens ausgegeben; dies waren 10,9 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Im langfristigen Trend sind die Gesundheitsausgaben damit überdurchschnittlich gestiegen – so betrug der Anteil am BIP 1970 nur 5,7 %. Allerdings ist der Anteil seit Beginn der Kostendämpfungsgesetze (1977) bis zur Wiedervereinigung im wesentlichen konstant bei rd. 8 bis 8,5 % geblieben. Infolge der Wiedervereinigung erfolgte Anfang der neunziger Jahre ein erheblicher Schub.
Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung sind bis Anfang der neunziger Jahre etwas schneller als die Gesundheitsausgaben insgesamt gewachsen. In den letzten Jahren sind sie nur noch langsamer als die übrigen Gesundheitsausgaben gestiegen. Dabei verlief das Wachstum seit Ende der siebziger Jahre weitgehend parallel zur Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes. Dennoch stieg der durchschnittliche Beitragssatz weiter an: von 8,2 % in 1970 über 11,4 % (1980) und 12,5 % (1990) auf 13,6 % (2000).
[Seite der Druckausg.: 11]
3. Innovation und solidarischer Ausgleich – die Politik seit 1998
Die Neuorientierung der Gesundheitspolitik der gegenwärtigen Bundesregierung ist mit dem Solidaritäts-Stärkungsgesetz und der Gesundheitsreform 2000 eingeleitet worden. Durch die Rückkehr zum Sachleistungsprinzip bei der Zahnbehandlung ist der Schutz der Patienten vor Ansprüchen der Leistungserbringer umfassend gewährleistet. Auch unsoziale Leistungsausgrenzungen (Einschränkungen des Zahnersatzes für Kinder und Jugendliche) wurden zurückgenommen.
Nach den Grundsätzen "Prävention vor Kuration" und "Rehabilitation vor Frühverrentung und Pflege" hat der Gesetzgeber für die Versicherten sowie Patienten Grundlagen für effektivere Versorgungsstrukturen geschaffen. Die Förderung von Selbsthilfegruppen hat einen neuen Stellenwert erhalten, denn die Selbsthilfe dient in vielfältiger und wirksamer Weise als Ergänzung professioneller Gesundheitsdienstleistungen.
Durch das neue Gesetz zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) wurden die Rechte der Versicherten gestärkt und deren Leistungsansprüche verbessert, Rehabilitationsleistungen können u.a. Krankenhausleistungen nicht mehr ersetzen. Die ambulante Rehabilitation soll zudem die wohnortnahe Betreuung im Sinne der Patienten sichern.
Im Sinne einer optimalen Versorgung ist die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zu intensivieren. Die bisherige starre Aufgabenteilung zwischen der ambulanten und stationären Versorgung ist aufgebrochen worden. Integrierte, sektorübergreifende Versorgungsformen zwischen Haus- und Fachärzten, zwischen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungserbringern und zwischen ambulantem und stationärem Sektor können die Versorgungssituation und die Behandlungsabläufe verbessern.
Die Grundlagen für eine Verbesserung der Qualität der medizinischen Versorgung wurden konzipiert. Sie wurden erreicht durch Qualitätssicherung, die Bewertung von Kosten und Wirtschaftlichkeit medizinischer Technologien und der verbesserten Nutzung des Medizinischen Dienstes.
Dieses Qualitätssicherungsgebot gilt für alle Leistungsbereiche. Erstmals wurde auch für Krankenhausleistungen ein Gremium geschaffen, das etablierte und neue medizinische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden daraufhin überprüft, ob sie für eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung erforderlich sind.
Ziel der Reform des Risikostrukturausgleiches ist es, die Morbidität der Patienten bei den Ausgleichszahlungen zwischen den Krankenkassen zu berücksichtigten.
Disease Management Programme für ausgewählte "Volkskrankheiten" bilden ab 2002 eine wichtige Basis für weitere Qualitätsverbesserungen in der Patientenversorgung, insbesondere bei der Versorgung chronisch kranker Menschen. Krankenkassen, die derartige Programme für ihre Versicherten anbieten, erhalten über den Risikostrukturausgleich einen Ausgleich. Damit wird
[Seite der Druckausg.: 12]
erstmals berücksichtigt, dass Krankenkassen, die sich gezielt um eine Verbesserung der Versorgung ihrer chronisch Kranken bemühen, keine finanziellen Nachteile haben, sondern im Vergleich zum Status Quo deutlich besser gestellt werden.
Eine deutliche Stärkung des Solidarprinzips soll dann zum 1. Januar 2007 erfolgen. In die Berechnung des Risikostrukturausgleiches sollen verstärkt Faktoren der Morbidität aufgenommen werden. Den Krankenkassen wird es dann nicht mehr möglich sein, durch Selektion von gesunden Versicherten Beitrags- und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, da gesunde und kranke Versicherte im Risikostrukturausgleich unterschiedlich berücksichtigt werden.
Mit der schrittweisen Einführung eines diagnose-orientierten Fallpauschalensystems ab 2003 bis 2007 wird in Krankenhäusern die Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Qualität gefördert. Mit dem Fallpauschalensystem erfolgt die Zuordnung der Mittel entsprechend der Leistungen ("Geld folgt der Leistung"). Die Fallpauschalen werden die im internationalen Vergleich zu hohen Verweildauern in Deutschland weiter verkürzen.
Die Transparenz des neuen Entgeltsystems vereinfacht den Vergleich von Krankenhausleistungen für alle Beteiligten. Krankenhäuser können von den guten Lösungen anderer Krankenhäuser lernen (Benchmarking/Orientierungswerte). Patienten wird die Wahl eines Krankenhauses erleichtert, da die Qualität – die zudem durch finanzielle Anreize gefördert wird - insbesondere bei hochspezialisierten Leistungen leichter identifizierbar ist.
(Veröffentlichung von Daten: Akkreditierung)
4 Prinzipien einer solidarischen Gesundheitspolitik
4.1 Solidarische Strukturen sichern
Es gibt keine Notwendigkeit für einen grundlegenden Systemwechsel in Richtung einer Privatisierung des Gesundheitsrisikos. Ein solches System wäre weder kostengünstiger, wie internationale Erfahrungen zeigen, noch böte es eine qualitativ bessere Versorgung. Die paritätische Finanzierung ist ein Element von Solidarität und hat sich im Grundsatz bewährt. Solidarität heißt, auch weiterhin die finanzielle Leistungsfähigkeit bei der Beitragsbemessung zur gesetzlichen Krankenversicherung zu berücksichtigen, Familien sowie sozial Schwache zu entlasten und einen gleichen Zugang zu medizinisch notwendigen Leistungen zu gewährleisten.
Eine solidarische Gesundheitspolitik muss auch weiterhin jedem, unabhängig von Alter, Einkommen, Familienstand und Lebenslage, den Zugang zu medizinisch notwendigen und angemessenen Leistungen garantieren. Dies schließt die Teilnahme am qualitätsgesicherten Fortschritt ein.
[Seite der Druckausg.: 13]
4.2 Selbstbestimmung und Eigenverantwortung stärken
Bereits mit der Gesundheitsreform 2000 ist der Anspruch des Patienten auf objektive Information und Mitsprache verbessert worden. Eine moderne Gesundheitspolitik orientiert sich am Leitbild eines informierten und mündigen Patienten. Versicherer und Leistungserbringer im Gesundheitswesen müssen sich in Zukunft verstärkt an Wünschen, Bedürfnissen und Interessen ihrer "Kunden" orientieren und sie in Entscheidungen einbeziehen. Sie haben auch die Pflicht, eine nicht-interessengeleitete Information von Patienten und Versicherten durch unabhängige Institutionen sicherzustellen. Dem Leitbild des mündigen Patienten entspricht es auch, ihm in Zukunft mehr Wahlmöglichkeiten bei der Art und Weise wie die medizinischen Leistungen erbracht werden, einzuräumen. Die Bereitschaft und die Fähigkeit der Patienten zur Selbsthilfe muss zukünftig bei der Erstellung von Behandlungsleitlinien stärker berücksichtigt werden. Der Schutz der Patienten vor Behandlungsfehlern und Nebenwirkungen von Arzneimitteln ist u. a. auch durch veränderte Haftungsregelungen zu verbessern.
4.3 Versorgung für alle und Finanzsicherheit erhalten
Eine angemessene gesundheitliche Versorgung ist auch weiterhin für jeden zu garantieren, der sie benötigt. Dieser Anspruch muss unabhängig vom Einkommen, der individuellen Leistungsfähigkeit und dem individuellen Krankheitsrisiko bestehen. Dieser Anspruch darf nicht von der Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung abhängig gemacht werden. Dies bedeutet zugleich, dass Beitragssatzstabilität zwar ein wichtiges Ziel der Gesundheitspolitik ist, aber ohne dass dadurch die notwendige gesundheitliche Versorgung des Einzelnen in Frage gestellt wird.
4.4 Den Fortschritt medizinisch bewerten und seine Chancen nutzen
Der medizinische Fortschritt ist ein Beitrag zu einer verbesserten medizinischen Versorgung des Einzelnen. Er muss weiterhin durch Forschung und Entwicklung im Bereich der Medizin gefördert werden. Dabei müssen die Interessen der Versicherten an wirksamer Prävention, verbesserten Therapien und angemessener Versorgung im Vordergrund stehen. Wir brauchen von ökonomischen Interessen unabhängige Institutionen, die Innovationen am Maßstab allgemein akzeptierter Kriterien bewerten und sie in die Fortschreibung von Behandlungsleitlinien aufnehmen. Echte Fortschritte dürfen den Patienten aus ethischen Gründen nicht verweigert werden. Der therapeutische Nutzen muss vor einer allgemeinen Anwendung jedoch zweifelsfrei belegt sein. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt für weniger als die Hälfte der medizinischen Leistungen der Fall, die heute routinemäßig erbracht werden.
[Seite der Druckausg.: 14]
4.5 Effizienz und Qualität verbessern
Eine Gesundheitspolitik, die den Versicherten und den Patienten in den Mittelpunkt stellt, muss dafür Sorge tragen, dass Effizienz und Qualität medizinischer Leistungen ständig verbessert werden. Die Patienten haben das Recht, eine gesicherte Qualität medizinischer Leistungen zu erhalten. Das gegenwärtige System der "Therapiefreiheit" muss sich an eindeutigen Qualitätskriterien orientieren. Dies ist sowohl im Sinne der Ärzte wie der Patienten. Deshalb sind die notwendigen institutionellen Reformen einzuleiten, um einerseits mehr Wettbewerb bei Krankenkassen und Anbietern von Gesundheitsleistungen zu schaffen und andererseits durch unabhängige Institutionen hohe Qualitätsstandards und die Einhaltung der Wettbewerbsregeln durch Aufsichtsinstitutionen zu sichern.
4.6 Prävention stärken
Eine moderne Gesundheitspolitik setzt auf den Vorrang der Prävention. Zahlreiche Studien belegen, dass durch systematische Präventionsprogramme die Entstehung chronischer Krankheiten verhindert oder hinauszögert und damit Behandlungskosten eingespart werden können. Prävention ist dabei eine Aufgabe, an der sich neben den unmittelbaren Akteuren des Gesundheitswesens auch öffentliche Institutionen auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebene beteiligen müssen. Auch im Bereich der Prävention ist Qualitätssicherung auf der Basis einer systematischen Auswertung der Programme unverzichtbar. Prävention trägt dazu bei, auch sozial Benachteiligten gleiche Gesundheitschancen zu ermöglichen.
4.7 Die Qualifizierung im Gesundheitsbereich verbessern
Für den Gesundheitsbereich gilt stärker noch als für andere Bereiche der Gesellschaft, dass das verfügbare Wissen durch die Informations- und Kommunikationstechnologien immer schneller wächst. Dies stellt wachsende Anforderungen an die im Gesundheitswesen Tätigen. Sie müssen die Bereitschaft zu lebensbegleitendem Lernen mitbringen. Gleichzeitig müssen die institutionellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass entsprechende Weiterqualifizierungs- und Weiterbildungsangebote verstärkt wahrgenommen werden können. Auch hierzu kann eine Verstärkung des Wettbewerbs im Gesundheitswesen einen wesentlichen Beitrag leisten.
[Seite der Druckausg.: 15]
5. GKV 2010 – Eckpunkte und Instrumente einer Strukturreform des Gesundheitssystems
Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz und dem Gesundheitsreformgesetz 2000 sind wichtige Weichenstellungen für die Neuorientierung des Gesundheitswesens eingeleitet worden:
- Mit der Einführung der Krankenkassenwahlfreiheit ist die Voraussetzung für eine wettbewerbliche Steuerung der Gesundheitsversorgung geschaffen worden.
- Mit der integrierten Versorgung sind die Chancen verbessert worden, die Nachteile aus den abgeschotteten Versorgungsbereichen zu überwinden.
- Mit der Einführung einer Positivliste ist eine wesentliche Voraussetzung für eine rationale Arzneimitteltherapie beschlossen worden.
Auf diesen Eckpunkten muss eine neue Gesundheitsreform aufsetzen und vor allem auf die Wettbewerbs-, die Qualitäts-, Präventions- und Steuerungsdefizite des deutschen Gesundheitssystems abstellen.
5.1 Eine moderne, solidarische Wettbewerbsordnung aufbauen
Im Mittelpunkt einer neuen Gesundheitsreform muss der Aufbau einer modernen, solidarischen Wettbewerbsordnung stehen. Das Prinzip der solidarischen Ausrichtung des Gesundheitswesens bleibt richtig – die Solidarität zwischen Gesund und Krank, Jung und Alt, Einkommensstark und Einkommensschwach, Kinderlosen und Familien mit Kindern muss erhalten bleiben.
Fest steht aber auch: Die bisherigen Möglichkeiten des Wettbewerbs werden kaum zur Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung genutzt. Krankenkassen, aber auch Ärzte, Krankenhäuser und die übrigen Erbringer von Gesundheitsleistungen sind heute zu sehr durch starre Vorschriften eingeschränkt. Insbesondere sind die Krankenkassen in zu vielen Bereichen zu gemeinsam und einheitlich zu treffenden Entscheidungen verpflichtet, und es ist vorgeschrieben, mit wem sie auf der Seite der Leistungserbringer Verträge abschließen müssen.
Damit ist der Wettbewerb, der durch das GSG eingeleitet worden ist, auf halber Strecke stehen geblieben. Es fehlen die notwendigen Instrumente in den Beziehungen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern, damit sich die wirtschaftliche und qualitätsgesicherte Versorgung im Wettbewerb herausbilden kann. Umgekehrt haben auch einzelne Leistungserbringer oder Gruppen von Leistungserbringern kaum Chancen, sich durch besondere Leistungsfähigkeit oder besondere Wirtschaftlichkeit zu profilieren und so einen größeren Marktanteil in der Versorgung der Versicherten an sich zu binden.
[Seite der Druckausg.: 16]
Die Regeln, die heute gemeinsames und einheitliches Handeln vorschreiben, müssen revidiert werden. Eine wettbewerbliche Öffnung ist erforderlich, damit sich Innovationen in Qualität und Wirtschaftlichkeit durchsetzen können.
Dabei darf Wettbewerb gerade im Gesundheitswesen kein Selbstzweck sein. Er soll vielmehr eine immer bessere Versorgung mit Diensten und Gütern im Krankheitsfall gewährleisten, indem er Kassen und Leistungserbringer dazu zwingt,
- die im Rahmen der GKV vorgesehenen Gesundheitsleistungen nach Art und Qualität so bereit zu stellen, dass sie den Patientenwünschen entsprechen;
- die Angebote des Gesundheitssystems effizient einzusetzen und die Gesundheits-
- leistungen möglichst wirksam und kostengünstig zu erbringen;
- medizinische, technische und ökonomische Innovationen einzuführen und dadurch die Patienten qualitativ immer besser und effizienter zu versorgen;
- die eingesetzten Ressourcen leistungsgerecht zu entlohnen und sie flexibel an medizinische, medizintechnische, ökonomische und politische Datenänderungen anzupassen.
Ein so verstandener Wettbewerb lässt keine unangreifbaren Marktpositionen, Angebotsstrukturen, Produktionsverfahren oder Besitzstände zu.
Notwendig ist ein neuer GKV-Ordnungsrahmen mit einem allgemeinen, dauerhaften Öffnungsgebot für alle Krankenkassen.
Dies hat Konsequenzen
- für die Organisation der GKV,
- für das Verbänderecht und die Selbstverwaltungsorganisation,
- für die Gründung von Krankenkassen,
- für die Fusion von Krankenkassen,
- für die Finanzierung der Verwaltungskosten.
Ein von Solidarität und Wettbewerb geprägter Ordnungsrahmen hat sowohl Konsequenzen für die Krankenkassen wie die Leistungserbringer.
Insgesamt bedarf der gesamte erste Abschnitt des 6. Kapitels des SGB V einer Revision. Die erhöhten Anforderungen an die Einzelkassen erfordern eine weitere Professionalisierung im Kassenmanagement und eine Aufgabenkonzentration der Selbstverwaltung auf tatsächliche Kernaufgaben.
Dies gilt auch für die Zwangsmitgliedschaft aller Vertragsärzte in den KVen. Diese können allenfalls formale Voraussetzungen zur Teilnahme an der GKV-Versorgung prüfen. Die Sicherstellung der Versorgung ist durch die Erfüllung gesetzlich normierter Vorgaben durch die Krankenkassen zu garantieren. Krankenkassen wie Leistungserbringer sollten ihre jeweils
[Seite der Druckausg.: 17]
gemeinsamen Interessen auf Landes- und Bundesebene durch die Bildung von Dachverbänden organisieren.
Ein neuer Wettbewerbsrahmen führt auch zu veränderten Inhalten und Formen staatlicher Aufsicht. Staatlicher Aufsicht sollte als wesentliche Aufgabenstellung zukünftig die Funktion zukommen, den einheitlichen Wettbewerbsrahmen zu sichern. Die Sicherung der potentiellen Vorteile wettbewerblichen Verhaltens durch die Krankenkassen für die Versicherten ist die zentrale Zukunftsaufgabe der Staatsaufsicht.
Zu einer solidarischen Wettbewerbsordnung gehören:
- Ein einheitlicher Leistungskatalog
Um zu vermeiden, dass der Wettbewerb sich auf die Frage konzentriert, in welcher Form möglichst vieler "guter Risiken", d.h. junge und gesunde Versicherte für eine Krankenkasse gewonnen werden können, muss es neben einem morbiditätsorientierten und leistungsgerechten Risikostrukturausgleich auch einen einheitlichen Leistungskatalog geben. Ein sinnvoller Wettbewerb muss sich auf die Frage konzentrieren, welche Qualität und welche Kosten-Nutzen-Relation eine bedarfsgerechte Versorgung für alle Versicherten haben muss. Vermieden werden muss ein Wettbewerb, in dem sich die Versorgung nicht mehr am medizinisch notwendigen Bedarf, sondern an der Zahlungsfähigkeit der Versicherten oder ihrer Attraktivität für die Krankenkassen orientiert. Nicht die Frage, welche Leistungen von den Krankenkassen finanziert werden, sondern von wem und wie die Leistungen erbracht werden, sollte Gegenstand des neuen Wettbewerbs sein. - Ein Übergang des Sicherstellungsauftrags auf die Krankenkassen
Der Sicherstellungsauftrag sollte in der Verantwortlichkeit der Krankenkassen liegen. Wie in jedem wettbewerblichen System muss die Leistung von demjenigen garantiert werden, der auch die Verantwortung für die Kosten trägt. Zwischen den Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. den Krankenhäusern können gegenwärtig keine echten Verhandlungen stattfinden, da es weder für den Anbieter noch für den Nachfrager Alternativen gibt. Eine Krankenkasse wird vom Versicherten mit seinen Beiträgen verpflichtet, eine bedarfsgerechte Versorgung zu garantieren. Dieser Verantwortung entledigt sich die Krankenkasse heute durch die pauschale Weitergabe dieses Auftrags an einen Monopolanbieter. - Ein Fortfall des Kontrahierungszwangs gegenüber Leistungserbringern und Krankenkassen
Voraussetzung für jede Form von Wettbewerb ist ein funktionierender Markt. Kein Markt kann funktionieren, in dem jeder Nachfrager gesetzlich verpflichtet ist, mit jedem Anbieter zu kooperieren. Dies bedeutet für den Nachfrager, dass er auch Leistungen einkaufen muss, von denen er weiß, dass sie seinen qualitativen Anforderungen nicht entsprechen. Dennoch müssen die Krankenkassen auch mit diesen Einrichtungen Verträge schließen, die keine gesicherte Versorgungsqualität bieten. Umgekehrt werden die Leistungserbringer gezwungen, auch Leistungen zu erbringen, die sie betriebswirtschaftlich nicht darstellen
[Seite der Druckausg.: 18]
- Eine Rückführung einheitlicher und gemeinsamer Verträge
Der Markt führt dann zu mehr Effizienz, wenn er Anbietern mit hoher Qualität und einer guten Kosten-Nutzen-Relation Vorteile ermöglicht. Diese Vorteile entstehen zu Lasten derer, die eine entsprechende Qualität nicht anbieten können. In der jetzigen Wettbewerbsordnung der gesetzlichen Krankenversicherung wird aber genau dieser Effekt des Wettbewerbs ausgeschaltet, da die Verträge grundsätzlich einheitlich und gemeinsam für alle Krankenkassen und alle Leistungserbringer gestaltet werden müssen. Dies führt zu einer Situation, in der sich die besonders hochwertige Vertragserfüllung nicht lohnt. Wenn der Sicherstellungsauftrag durch die Krankenkassen übernommen wird, darf es für die Leistungserbringer keine Pflicht geben, einen Einheitsvertrag aller Krankenkassen erfüllen zu müssen. Umgekehrt kann es einer Krankenkasse und den Patienten nicht zugemutet werden, über den Bedarf hinaus oder in Fällen inakzeptabler Qualität dennoch einheitlich Verträge abschließen zu müssen.
können. Dies führt dazu, dass die Leistungen unterhalb des notwendigen fachlichen Qualitätsstandards erbracht werden müssen.
- Eine Weiterentwicklung des Leistungskatalogs
Die Prüfung des Leistungskatalogs auf Bedarfsgerechtigkeit kann weder den Krankenkassen noch den Leistungserbringern aufgetragen werden. Für Versichertengruppen, die als Mitglieder nicht attraktiv sind (z.B. ältere Versicherte oder chronisch Kranke), haben die Krankenkassen ein Interesse, den Leistungskatalog nicht über das unvermeidbare Maß auszudehnen. Die Prüfung neuer Verfahren für die Aufnahme in den Leistungskatalog bzw. die Prüfung bereits etablierter Verfahren im Lichte des technischen Fortschritts muss unabhängig geregelt und klar definiert und zugeordnet sein. Dazu sollte auf wissenschaftlichen Sachverstand und dafür eingerichtete Institutionen zurückgegriffen werden, wie dies in England z.B. durch das National Institute of Clinical Excellence (NICE) getan wird. Gegenwärtig übernehmen diese Aufgabe die gemeinsamen Ausschüsse der Spitzenverbände. Wettbewerbsregulation muss frei von Interessenskonflikten sein, ein Management der Interessenskonflikte alleine reicht nicht aus.
5.2 Qualitätssicherung als Instrument einer modernen Gesundheitspolitik
Sowohl die Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Leistungskatalogs als auch die Definition von Qualitätsstandards dürfen in einem wettbewerblichen Gesundheitssystem dem Markt nicht vollständig überlassen werden.
Insbesondere für sozial schwache Gruppen, für chronisch Kranke und für ältere Menschen muss auch in einer wettbewerblichen Gesundheitsversorgung die Qualität der Versorgung sichergestellt und weiterentwickelt werden. Wo solche Qualitätsmängel auftreten, muss der Wettbewerb durch die Vorgabe von Qualitätsstandards entsprechend gestaltet werden.
[Seite der Druckausg.: 19]
Dies ist Aufgabe der staatlichen Aufsicht hinsichtlich des Sicherstellungsauftrags der Krankenkassen. Institutionen, die die Aufgabe der Qualitätssicherung und –weiterentwicklung übernehmen, dürfen nicht selbst Teil des Wettbewerbs sein oder von am Wettbewerb teilnehmenden Institutionen getragen werden oder abhängig sein.
Selbstverständlich ist jeder einzelne Leistungserbringer zur ständigen internen Qualitätssicherung verpflichtet. Für viele medizinische Probleme gibt es eine aufwendige und eine weniger aufwendige Versorgung, die sich in ihrer Kosten-Nutzen-Relation häufig sehr stark unterscheiden.
Daher sollten ähnlich wie in den Vereinigten Staaten, Canada, Großbritannien, Schweden, Finnland, Norwegen, Italien, Australien und in den Niederlanden Institutionen geschaffen werden, die Vorgaben für einen Qualitätswettbewerb in der Medizin geben.
Dazu sollte von dieser Institution in wichtigen Bereichen der Qualitätsstandard definiert werden, der für eine bedarfsgerechte Versorgung notwendig ist. Dies kann durch die Entwicklung oder Übernahme wissenschaftlich gesicherter Leitlinien (evidenzbasierte Leitlinien) geschehen. Die Institutionen sollten wie Verbraucherschutzeinrichtungen arbeiten, die die Interessen von Patienten und von Beitragszahlern hinsichtlich einer angemessenen und qualitätsorientierten Versorgung vertreten.
Der Aufbau einer solchen Institution ist besonders wichtig im Bereich der Arzneimittelversorgung, wo Kosten-Nutzen-Relationen bei alten und neuen Arzneimitteln überprüft werden müssen, bevor sie flächendeckend und ohne Einschränkung in die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt werden können.
Im Bereich der Arzneimittel sind eindeutige Regelungen und Instrumente vorzusehen:
- Zulassung neuer Medikamente in die GKV, ggf. auch nur befristet
- Endgültige Aufnahme in den Leistungskatalog der GKV nach Zulassung auf der Basis von Langzeitstudien
- Arzneimittelpositivliste
- Aufbau eines pharmaökonomischen Bewertungssystems
- Zulassung von Versandhandel, wettbewerbliche Preisgestaltung
- Zulassung von Krankenhausapotheken, auch bei der Versorgung ambulant behandelter Patienten.
Die Prüfung der Effizienz eines Arzneimittels führt dazu, dass Scheininnovationen und Produkte, die minimal besser und erheblich teurer als ihre Alternativen sind, langsamer und zu geringeren Kosten in das Gesundheitssystem einziehen, während sich der Prozess bei echten Innovationen und Arzneimitteln mit guter Wirtschaftlichkeit beschleunigt.
[Seite der Druckausg.: 20]
5.3 Bedarfsgerechte und effiziente Versorgungsstrukturen entwickeln
Oberstes Ziel muss dabei die Neuausrichtung der Strukturen auf die Belange der Patienten sein. Es gilt, Behandlungsabläufe über die hergebrachten Sektoren des traditionellen Gesundheitssystems hinweg medizinisch zu definieren und in Kooperationen zwischen ambulant tätigen Ärzten, Krankenhäusern, Reha- und Pflegeeinrichtungen anzubieten.
Diese Gesundheitsanbieter werden deshalb künftig Behandlungen von Beginn der Diagnose bis zum Abschluss der Betreuung gemeinsam organisieren und anbieten und damit die bisherigen Grenzen der Sektoren des Gesundheitssystems überwinden.
Entscheidend ist, dass der Wettbewerb über Qualität und Preis erfolgt. Gruppen von Anbietern konkurrieren mit anderen Gruppen von Anbietern. Nicht der Umfang der Leistungen soll Differenzierungsmerkmal im neuen System sein, sondern die Art der Leistungserbringung. Das Prinzip des umfassenden Gesundheitsschutzes kann so in einer solidarisch finanzierten Krankenversicherung gesichert werden.
Die Krankenkassen müssen ihren Versicherten den gesetzlich garantierten Leistungsumfang sichern, indem sie entsprechende Verträge mit Gesundheitsdienstleistern abschließen. Jene Kassen, die eine solche Garantie nicht abgeben können, da sie geeignete Verträge mit Leistungsanbietern nicht vorweisen können, dürfen in festgelegten Regionen, keine Versicherungsleistungen anbieten und kontrahieren. Definierte Notfallbehandlungen müssen auch künftig in allen Gesundheitseinrichtungen erhalten und von den Krankenkassen finanziert werden.
Anbietergruppen oder Gesundheitsunternehmen sollen die Möglichkeit erhalten, den Krankenkassen künftig genau beschriebene Behandlungskonzepte für ambulante, stationäre etc. Versorgung anzubieten. Es soll sich dabei um eine umfassende Dienstleistung vom Beginn bis zum Ende oder für einen festgelegten Zeitraum der Behandlung handeln.
Die Qualität wird durch staatlich festgelegte Normen bestimmt, die sich sowohl auf die Dienstleistungen als auch auf die Dienstleister bezieht. Dienstleistungen müssen beispielsweise definierte Mindestanforderungen für Behandlungskomponenten, Erfolgsquoten und Gewährleistungsverpflichtungen beinhalten. Dienstleister müssen z. B. jährliche Mindestmengen pro Behandlung erbringen und regional ein festgelegtes Mindestsortiment anbieten.
Die vertraglichen Vereinbarungen zwischen einzelnen Anbietern oder Anbietergruppen und Krankenkassen oder Krankenkassengruppen enthalten neben den Leistungs- und Qualitätsfestlegungen insbesondere auch Preisfestsetzungen. Durch vereinbarte Rabattstaffeln lassen sich Effizienzgewinne auf die Krankenkassen und Beitragszahler übertragen.
Der Staat bezieht die Sicherstellungsgarantie künftig konsequent auf die Patientenbedarfe. Er schafft deshalb eine gesetzliche Ordnung, die dieser Zielrichtung folgt. Er schützt damit nicht mehr die Existenz der Anbieter, sondern sichert einen fairen Wettbewerb. Durch geeignete Rahmenbedingungen kann der Wettbewerb folgende Strukturen schaffen:
[Seite der Druckausg.: 21]
- Patienten werden in einer Versorgungspyramide betreut, die die Lösung eines Patientenproblems auf der jeweils effizientesten Stufe des Versorgungssystems bewirkt. Dazu gehören:
- hausärztliche Versorgung
- fachärztliche Versorgung flächendeckend außerhalb des Krankenhauses
- fachärztliche Versorgung ambulant, aber krankenhausabhängig
- stationäre Krankenhausversorgung.
- Hausärztliche Versorgung wird auch in Zukunft vorwiegend in Einzel- oder Gemeinschaftspraxen krankenhausunabhängig erbracht werden. Hausärzte werden neben der derzeit üblichen Basisbetreuung der Patienten die Lotsenfunktion im System und den Kanon der Grundversorgung im Rahmen des Disease-Managements beherrschen. Hausärztliche Versorgung kann durch die Krankenkassen in Form von Verträgen nach einheitlichen Mindestqualitäts- und Höchstpreis-Standards sichergestellt werden.
- Fachärztliche Leistungen, die z.B. teuere Investitionen in Technik oder know how voraussetzen, werden in Zukunft häufig in räumlicher und personeller Einheit mit den Fachärzten am Krankenhaus erbracht werden.
- Krankenhäuser werden in die Lage versetzt, sowohl stationäre Behandlung als auch fachärztlich ambulante Behandlungen anzubieten.
- Ambulante und stationäre Rehabilitation wird in effizienter Weise mit der akut stationären Versorgung verzahnt.
5.4 Präventive Instrumente einer modernen Gesundheitspolitik ausbauen
Eine vorausschauende Gesundheitspolitik braucht Präventionsmaßnahmen bei Volkskrankheiten. Primärprävention dient dem Patienten, baut soziale Unterschiede bei den Gesundheitserwartungen ab und trägt zur langfristigen Finanzierbarkeit der GKV bei.
Notwendig sind verbindliche Verpflichtungen und Instrumente für eine vorausschauende Präventionspolitik, die sich auch an sozial Benachteiligte richtet.
Durch die Ernährung, das Bewegungsverhalten und den Tabakkonsum wird die Häufigkeit von Herzinfarkten, Herzschwäche, Schlaganfällen, Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Demenz und bestimmten Krebsarten gleichzeitig beeinflusst.
Bei der Entwicklung eines rationalen Gesundheitssystem muss der Bekämpfung dieser Risikofaktoren eine hohe Bedeutung zukommen. Der Erfolg solcher Programme lässt sich durch internationale Erfahrungen belegen. So hat zum Beispiel ein übergreifendes Herz- und Kreislaufpräventionsprogramm in Finnland innerhalb von 20 Jahren fast eine Halbierung der Zahl der neuen Herzinfarkte verursachen können.
[Seite der Druckausg.: 22]
Aufgrund der langen Vorlaufzeit für die Wirkung solcher Programme muss jetzt eine Verlagerung der Prioritäten hin zur Prävention erfolgen, wenn man den Herausforderungen, z.B. des demografischen Wandels erfolgreich begegnen will. Die wichtigsten notwendigen Initiativen sind
- ein nationales Herz- und Kreislaufpräventionsprogramm,
- ein Anti-Tabakprogramm
- ein Früherkennungsprogramm für Krebs, insbesondere ein qualitätsgesichertes nationales Mammographiescreeningprogramm für Brustkrebs.
5.5 Moderne und flexible Steuerungsinstrumente entwickeln
Im Wettbewerb der Leistungserbringer und im Wettbewerb der Krankenkassen werden sich bedarfsgerechte und effiziente Versorgungsstrukturen entwickeln. Die Krankenkassen müssen dazu in ihren Verträgen mit den Krankenhäusern, Ärzten und übrigen Leistungserbringern Steuerungsinstrumente einsetzen, die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung zum Durchbruch verhelfen.
Gegenwärtig werden die Steuerungsinstrumente in der Gesundheitsversorgung größtenteils vom Gesetzgeber detailliert vorgegeben. Dies ist umso entbehrlicher, je wettbewerbsorientierter die gesundheitliche Versorgung ausgerichtet wird; also so viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig.
Bis die stärker wettbewerbliche Orientierung des Gesundheitswesens greift, kann die Gesundheitspolitik nicht vollständig auf bisherige Steuerungsinstrumente verzichten. Insbesondere ist kurzfristig ein Verzicht auf die Budgetierung als Instrument nicht möglich. Die sektorale Budgetierung sollte durch ein sektorübergreifendes Globalbudget ersetzt werden.
Das Parlament hat aus gesamtgesellschaftlicher Verantwortung heraus die Aufgabe, den Umfang der sozialstaatlich finanzierten Gesundheitsversorgung zu bestimmen. Zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die die Politik wahrnehmen muss, gehört auch die Bestimmung des Umfanges des Leistungskataloges der Krankenkassen. Die Gesundheitspolitik muss fortlaufend kritisch überprüfen und entscheiden, was sozialstaatlich finanziert werden soll.
Die Bestimmung konkreter medizinischer Methoden und Verfahren, die die Krankenkassen sicherstellen sollen, ist hingegen nicht Aufgabe der Politik. Vielmehr sollte eine staatliche Agentur mit der Überprüfung beauftragt werden, welche Verfahren ihren Nutzen und ihre Wirtschaftlichkeit bewiesen haben, so dass eine solidarische Finanzierung vertretbar ist.
[Seite der Druckausg.: 23]
5.6 Transparenz und differenzierte Nutzung der unterschiedlichen Angebote im Gesundheitswesen erhöhen
Ein Gesundheitswesen, das die Patientenversorgung im Wettbewerb regelt, bedarf einer modernen Gesundheitsberichterstattung und einer systematischen Versorgungsforschung. Beide Instrumente müssen regional und überregional nutzbare Daten für Patienten, Versicherte, Krankenversicherungen, Leistungserbringer und Politik zur Verfügung stellen.
Anhand der Daten muss es möglich sein, Aussagen über Quantität und Qualität von Leistungen zu treffen. Es muss überprüfbar sein, ob der Versicherte tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt das medizinische Versorgungssystem bei Bedarf erreicht, an die richtige Stelle bzw. Ebene des Systems gelangt und dort effizient versorgt wird. Nur bei bestmöglicher Transparenz können die Akteure im Gesundheitswesen begründete Entscheidungen treffen.
Die Gesundheitsberichterstattung mit ihren Daten muss
- dem Patienten erlauben, sich selbst ein Bild von der Qualität und der Leistungsfähigkeit zu machen,
- den Kassen ermöglichen, kassenspezifische, wettbewerbliche Analysen und Versorgungsanalysen ihrer Versicherten zu erstellen,
- Leistungserbringern Auswertungen zur Quantität und Qualität ihrer Leistungen zu Verfügung zu stellen, um Vergleiche untereinander im Rahmen einer Wettbewerbsordnung machen zu können,
- der Politik auf allen Ebenen Analysen über den medizinischen Versorgungsbedarf der Bevölkerung bereit zu stellen.
Für eine qualifizierte Gesundheitsberichterstattung muss zudem Raum bestehen, eigene Auswertungen zu fertigen und darüber öffentlich zu berichten. Diese Veröffentlichung und Bewertung von Daten darf keinen Weisungen unterliegen.
Die Ausgestaltung der Krankenversicherungskarte muss auf freiwilliger Basis auf die heutigen technischen Möglichkeiten angepasst werden. Das dient der Vermeidung von Doppeluntersuchungen, Unverträglichkeiten in der Arzneimittelversorgung sowie der Verbesserung und Dokumentation von Behandlungsabläufen.
5.7 Solidarische Elemente im Gesundheitssystem verbreitern
Wettbewerb steht in einem Spannungsverhältnis zur Solidarität. Krankenkassen und Leistungserbringer, die dem Wettbewerb ausgesetzt sind, haben möglicherweise ein starkes Interesse daran, sich der solidarischen Verpflichtungen zu entledigen. Notwendig ist daher ein Ordnungsrahmen, der Solidarität sichert.
[Seite der Druckausg.: 24]
Eine wesentliche Rolle in diesem Ordnungsrahmen spielt der jetzt gesetzlich neu geregelte Risikostrukturausgleich. Er muss morbiditätsorientiert weiterentwickelt werden, damit die Krankenkassen sich auch dauerhaft um (insbesondere: chronisch) Kranke versicherte bemühen. Gerade, wenn die Krankenkassen mehr Wettbewerbsinstrumente als bisher erhalten sollen, ist es erforderlich, den Risikostrukturausgleich weiter zu entwickeln.
Die Versichertenstrukturen der Krankenkassen sind sehr unterschiedlich. Seit Einführung der Kassenwahlfreiheit haben sie sich zudem auseinander entwickelt. Aber auch wenn sich die Strukturen stärker angleichen sollten, bleibt der Risikostrukturausgleich auf Dauer erforderlich. Sonst entstehen für die Krankenkassen rasch wieder falsche Anreize.
Zur Sicherung und Verbreiterung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung gehört auch eine Weiterentwicklung ihrer Finanzierungsgrundlagen. Immer mehr Versicherungspflichtige haben nennenswerte Einkünfte auch aus anderen Einkunftsarten als ihrem Arbeitseinkommen. Diese Einkünfte sind bislang nicht beitragspflichtig. Die Höhe des Einkommens, nicht die Frage aus welchen Einkunftsarten dies kommt, sollte über die Höhe der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung entscheiden. Eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage bzw. die Abkoppelung der Versicherungspflichtgrenze von den Löhnen ist daher sachgerecht und entspricht dem Prinzip der Finanzierung nach der Leistungsfähigkeit.
Andere Einkunftsarten in die Beitragspflicht einzubeziehen, bedeutet nicht automatisch mehr Geld für die Gesundheitsversorgung. Vielmehr ermöglicht eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen bei gleichen Leistungsausgaben eine Senkung des Beitragssatzes. Damit wird auch eine Entlastung des Faktors Arbeit und der Lohnzusatzkosten ermöglicht. Auch wirtschaftspolitisch macht daher ein Einbezug anderer Einkunftsarten in die Beitragsbemessung Sinn.
Die heutige Grenzziehung bei der Versicherungspflicht der Arbeitnehmer ist willkürlich. Die Versicherungspflichtgrenze führt dazu, dass finanzstarke Versicherte sich der Solidargemeinschaft GKV entziehen können. Richtig ist, dass die privat Versicherten im Krankheitsfall überproportionale Finanzierungsbeiträge leisten. Richtig ist aber auch, dass die Kalkulation der Prämien in der PKV nach dem Kapitaldeckungsverfahren einen Beitrag zur Entlastung der Wirkungen der demografischen Entwicklung leisten. Gleichwohl ist eine Überprüfung der Versicherungspflichtgrenze notwendig. Alternativ sollte auch geprüft werden, ob und wie die Privatversicherten hinsichtlich ihres deutlich höheren Einkommens in den Risikostrukturausgleich der GKV einbezogen werden können. Festzuhalten bleibt aber, dass eine solidarische (Zwangs)Versicherung eine Beitragsbemessungsgrenze erfordert, um den solidarischen Ausgleich zu begrenzen, um den Beitrag nicht zu einer Steuer werden zu lassen.
Zur mittel- und langfristigen Sicherung der Finanzierungsbasis der GKV einerseits und zur Wiedergewinnung einer durchgängigen sozialen Symmetrie andererseits sind Strukturentscheidungen unerlässlich. Die Prinzipien der Leistungsfähigkeit und Beitragsgerechtigkeit in einem sozialen Krankenversicherungssystem sind den sozio-ökonomischen Bedingungen des 21. Jahrhunderts entsprechend neu zu definieren. Mit entsprechenden Maßnahmen kann nicht
[Seite der Druckausg.: 25]
nur der Anstieg der Beitragssätze in der GKV gestoppt werden, sondern können die Beitragssätze sinken.
Der Einstieg ist mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 15. März 2000 zur notwendigen Gleichstellung der Rentner bei der Beitragsbemessung gemacht. Der seit dem Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) 1993 umfassende Einkommensbegriff der freiwillig versicherten Rentner wird auch auf pflichtversicherte Rentner ausgedehnt. Damit wird sowohl eine der Leistungsfähigkeit als auch dem Gebot der Generationengerechtigkeit angemessene Finanzierung erreicht.
Die Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenze in der GKV sollte überprüft werden.
Letztlich ist zu prüfen, in welchem Umfang der versicherte Personenkreis in der GKV mittelfristig auszudehnen ist. Sonderrechte für einzelne Gruppen von Erwerbstätigen, sich der Solidarität der GKV zu entziehen, sind kaum begründbar und bieten keine Antworten auf die Herausforderungen einer solidarisch finanzierten, zukunftsorientierten Gesundheitspolitik.
Durch die GKV werden teilweise seit Jahrzehnten verschiedene Leistungssegmente finanziert, die mit dem für die GKV konstitutiven Solidarprinzip, dem internen sozialen Ausgleich innerhalb der Versichertengemeinschaft, nicht begründet werden können. Bei diesen Leistungen handelt es sich um primär sozial- und/oder familienpolitisch motivierte Ausgaben. Diese krankenversicherungsfernen Leistungen bedienen unabhängig vom Versicherungsfall Krankheit gesamtgesellschaftlich zu bearbeitende Aufgabenstellungen.
Das Gesamtvolumen der durch die GKV finanzierten krankenversicherungsfernen Leistungen beträgt derzeit jährlich rund 4 Mrd. DM. Die Leistungen und ihre Finanzierung müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Hierdurch wird nicht zuletzt ein Beitrag zu Transparenz und aufgabenbezogener Zuordnung der Finanzverantwortung in unserem Sozialstaat geleistet.
5.8 Beschäftigungschancen im Gesundheitssystem nutzen, Qualifizierung und Fortbildung verbindlich regeln
Das Gesundheitswesen ist ein an Bedeutung zunehmender Wirtschaftsfaktor mit hohem Wachstumspotential. Rund 413 Mrd. DM fließen in diesen Sektor. Den größten Anteil daran hat weiterhin die GKV, die mit 232 Mrd. DM mehr als die Hälfte der Ausgaben für Gesundheit umsetzt. Auf die PKV entfallen 32 Mrd. DM und in der gleichen Größenordnung bewegen sich die direkten Ausgaben der privaten Haushalte für Gesundheit mit 45,5 Mrd. DM (Stand 1998).
Das Gesundheitswesen sichert die Beschäftigung von rund 2,2 Millionen Menschen. Rund 20% der im Gesundheitswesen Tätigen sind ÄrztInnen, ZahnärztInnen und ApothekerInnen. Mit über 900 000 Beschäftigten stellen Krankenschwestern und Krankenpfleger fast die Hälfte der Mitarbeiter des Gesundheitssektors. Vielfach gehen sie unter schwierigen Bedingungen bei hoher physischer, psychischer und zeitlicher Belastung ihrer Arbeit nach.
[Seite der Druckausg.: 26]
Die Verbesserung dieser Arbeitsbedingungen muss ebenfalls Ziel von Strukturreformen im Gesundheitswesen sein. Die Effizienzgewinne durch am Wettbewerbsgedanken orientierte Strukturreformen müssen auch dazu genutzt werden, die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu verbessern. Dies dient den Beschäftigten ebenso wie den Patienten.
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt im Gesundheitswesen wird in den nächsten Jahren beschleunigt weitergehen. Das stellt neue Anforderungen an alle Beschäftigten im Gesundheitswesen. Die Qualität der erbrachten Leistungen kann nur so gut sein, wie das vorhandene Qualifikationsniveau. Daher müssen neben einer soliden Erstausbildung verbindliche Anforderungen an eine obligatorische Weiterbildung für alle im Gesundheitswesen Tätigen festgelegt werden. Dieses Prinzip des lebensbegleitenden Lernens sollte im Rahmen einer Weiterbildungsordnung im Gesundheitsbereich erfolgen.
6. Zukunft gewinnen durch Modernisierung und soziale Verantwortung
Gesundheit ist die Voraussetzung für eine freies und erfülltes Leben eines jeden Menschen. Die Gesundheitspolitik ist deshalb eine der zentralen Aufgaben des Staates. Das deutsche Gesundheitssystem hat über lange Zeit einen weltweit anerkannt hohen Maßstab in der Versorgung von Kranken gesetzt. Durch seine heutigen Strukturen und eine quasi monopolisierte Erbringung von Versicherungs- und Versorgungsleistungen hat sich das System jedoch zunehmend selbst blockiert. Trotz hoher Aufwendungen der Versicherten und einer herausragenden Forschungsleistung erreicht das System als ganzes oftmals nur noch ein mittelmäßiges Leistungsniveau.
Der Schlüssel zu einer Verbesserung der Versorgung der Patienten kann nicht in der Einschränkung von Leistungen oder einer Erhöhung der Versicherungsbeiträge liegen. Er liegt vielmehr in der Nutzung der immensen Effizienzressourcen, die im System enthalten sind. Die Einführung eines "solidarischen Wettbewerbs" im Gesundheitssystem ist deshalb der richtige Weg, den Menschen in Deutschland jene Versorgung zu garantieren, die sie aufgrund ihrer Versicherungsbeiträge und des medizinischen Wissenstandes verdient haben.
Den Rahmen für eine solidarische Wettbewerbsordnung im Gesundheitswesen zu schaffen, bedeutet, einen kontrollierten Wettbewerb um Qualität und Preis zwischen den verschiedenen Gruppen von Anbietern von Gesundheitsleistungen einzuführen. Dabei wird nicht der Umfang der Leistungen, sondern die Art, wie diese Leistungen erbracht werden, der entscheidende Faktor des solidarischen Wettbewerbs sein. Auf diese Weise kann das Prinzip des umfassenden Gesundheitsschutzes im Rahmen eines solidarisch finanzierten Krankenversicherungswesens gesichert werden.
Marktwirtschaft und soziale Sicherung miteinander verbinden – dieses Prinzip hat Deutschland zu einer der stabilsten und angesehensten Wirtschaftsordnungen der Welt gemacht. Es ist Zeit, diese Prinzipien nun auch im deutschen Gesundheitswesen zu nutzen. Zum Wohle der Patienten, zum Wohle der vielen Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, und nicht
[Seite der Druckausg.: 27]
zuletzt zum Wohle des Gemeinwesens, das die Lasten der bestehenden Selbstblockade mitzutragen hat.
Modernisierung und soziale Verantwortung – diese beiden Prinzipien gehören zusammen, wenn die Menschen den notwendigen Wandel akzeptieren sollen. Das vorgelegte Papier zeigt den Weg, wie die Zukunft des deutschen Gesundheitssystems in sozialer Verantwortung gestaltet werden kann.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | August 2002