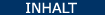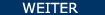![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
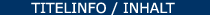
TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 1-2 = Titel]
[Seite der Druckausg.: 3-4 = Inhalt]
[Seite der Druckausg.: 5 ]
Vorbemerkung
In den letzten Jahren sind verstärkte Zuwanderungen aus dem Osten und Südosten Europas in die Bundesrepublik Deutschland zu beobachten. Dabei spielen die politischen Veränderungen in Europa, die sich z.B. auch in der Vereinigung Deutschlands niedergeschlagen haben, eine entscheidende Rolle. Der einheitliche Block im Osten Europas hat sich mehr oder weniger aufgelöst - wie z.B. an der Auflösung des Warschauer Paktes und des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) ablesbar -, gleichzeitig befinden sich die politischen und ökonomischen Systeme Osteuropas in einem Prozeß der Liberalisierung. Die Schaffung von Reisefreiheit und die Öffnung der Grenzen der osteuropäischen Staaten bilden die Voraussetzung für die neuen Migrationsbewegungen in Richtung Westen. Andererseits ist auf den Fortgang des politischen und wirtschaftlichen Integrationsprozesses in der Europäischen Gemeinschaft hinzuweisen, der sich einerseits in einer gewissen Abschottungstendenz gegenüber weiterer Zuwanderung von außen, z.B. durch eine gemeinsame Visa- und Flüchtlingspolitik, aber auch in der Vollendung des Binnenmarktes 1992 niederschlägt.
Die aktuelle Diskussion über neue Zuwanderungsbewegungen insbesondere aus Osteuropa wird jedoch durch die Eindrücke von einigen spektakulären Entwicklungen wie z.B. dem "Polenmarkt" in Berlin, Straßenverkäufern, ungeregelten Camps geprägt. Dadurch leidet die systematische Wahrnehmung der tatsächlichen Entwicklung und die Diskussion von inhaltlichen Konzepten gegenüber dieser Migrationbewegung. Es erschien uns daher wichtig, daß E. Hönekopp in seinem Beitrag zunächst die Fakten zum Umfang und zur Struktur dieser neuen Wanderungsbewegungen darstellt. Ebenso sind die in Herkunfts- und Zielländern begründeten Ursachen herausgearbeitet worden, um daran Überlegungen für zukünftige Tendenzen einer Ost-West-Wanderung anzuknüpfen. Die zur Zeit neuesten Daten belegen, daß 1989 ein positiver Zuwanderungssaldo von 320.000 Ausländern vorgelegen hat. Dazu kommen 644.000 Deutsche bzw. Personen deutscher Abstammung (Aussiedler), so daß im Saldo 1989 fast eine Million Menschen nach Deutschland zugewandert sind. Trotz dieser Zuwanderungsbewegungen ist der zahlenmäßige Anteil der Bevölkerung aus den osteuropäischen Staaten mit 6,6% an der gesamten Ausländerbevölkerung der BRD noch gering. Die Mehrzahl der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland stammt aus den Hauptanwerbeländern (Italien,
[Seite der Druckausg.: 6 ]
Griechenland, Spanien, Portugal, Jugoslawien, Türkei). Ihr Anteil liegt bei 67 % (1989) Die Anteile der ausländischen Arbeitnehmer, die aufgrund von Regierungsabkommen in die ehemalige DDR gekommen und nach der Wende dort geblichen sind, sind dagegen verschwindend gering. Generell läßt sich zeigen, daß zwar die Zuwanderung aus Osteuropa angestiegen ist, sie jedoch nicht die Größenordnung erreicht hat, die die Intensität der öffentlichen Diskussion rechtfertigen würde. Nicht alle Aspekte der Migrationsbewegungen dürften sich jedoch in den amtlichen Daten widerspiegeln: Saisonarbeit, Ferienarbeit Pendlerströme in grenznahen Räumen, Schwarzarbeit sind hier ebenso zu nennen, wie die Weiterwanderung der Migranten in andere Staaten.
Zukünftige Zuwanderungen aus Osteuropa werden nur in einem sehr geringen Maße von demographischen Fakten in den osteuropäischen Ländern abhängig sein. Der notwendige Umstrukturierungsprozeß von Produktions- und Beschäftigungsstrukturen wird jedoch nach vorsichtigen Schätzungen für 1991 zu einer Arbeitslosigkeit von 6-10 % in den osteuropäischen Ländern führen. Es kann vermutet werden, daß diese Arbeitslosigkeit bis Mitte der 90er Jahre ansteigen wird. Andererseits werden infolge der demographischen Entwicklung sowohl die Zahl der Bevölkerung als auch die Zahl der Erwerbspersonen in Westeuropa sinken. Dadurch wird ein gewisser Sog auf Arbeitskräfte außerhalb Westeuropas ausgehen. Gleichzeitig dürfte sich in Zukunft die Konkurrenz um derartige Arbeitsplätze verstärken.
An dieser Stelle erhebt sich die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Ausländerpolitik bzw. ihrem Ausländergesetz gerüstet ist, um sinnvolle Konzeptionen gegenüber Zuwanderungsbewegungen zu entwickeln. Dabei ist nicht nur an Begrenzung der Wanderungen zu denken. Denn wie oben geschildert dürfte es sogar im Interesse der BRD liegen, eine Zuwanderung von Er-werbsoersonen zuzulassen, wenn die demographische Entwicklung zu empfindlichen Lücken im Arbeitskräfteangebot führt. Außenpolitische Überlegungen legen es außerdem nahe, den Eindruck einer "Festung Europa" zu vermeiden. Eine Gefahr liegt m.E. nicht in der Talsache von Wanderungsbewegungen als solchen sondern darin, daß bei Beibehaltung der bisherigen Ausländerpolitik trotz ihres Abwehrcharakters eine ungeplante und damit nicht steuerbare Zuwanderung einsetzen könnte. Die jetzt wieder stark entflammte Diskussion über die Zahl der Asylbewerber dürfte m.E. deshalb so kontrovers geführt werden, weil die Öffentlichkeit zu Recht konstatiert, daß die Bundesregierung keine
[Seite der Druckausg.: 7 ]
Gesamtkonzeption zur Migration hat. Die 1955 begonnene Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer hatte sich weitgehend nur an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes ausgerichtet, die Konsequenzen des Familiennachzugs wurden anfangs nicht beachtet. Hier offenbarten sich die sozialen Defizite der damals verfolgten Ausländerpolitik: Menschenwürdige Wohnquartiere, Schulen, Kindergärten und eine angemessene medizinische Versorgung fehlten. Von der deutschen Öffentlichkeit wurden jedoch die Ausländer vielfach zu "Sündenböcken" für diese Infrastrukturmängel gemacht, anstatt die Ursachen in einer verfehlten Ausländerpolitik zu sehen.
Der Beitrag von K.H. Rosen gibt Aufschluß über den Verlauf der Ausländerpolitik in der alten Bundesrepublik seit 1965. Er kommt ebenfalls zu dem Schluß, daß anstelle der bisherigen an Abwehr orientierten Modelle eine konstruktive Konzeption für eine übergreifende Wanderungspolitik dringend erforderlich ist. Dieses umfassende Migrationskonzept sollte alle Migranten, also z.B. auch Flüchtlinge, Aussiedler, EG-Angehörige und Ausländer aus Drittländern miteinbeziehen. K.H. Rosen stellt in diesem Zusammenhang die vom SPD-Präsidium zustimmend zur Kenntnis genommenen "Thesen zu einem ganzheitlichen Konzept für Zuwanderungspolitik" mit kommentierenden Erläuterungen dar. Dort wird betont, daß sich allein mit einer nationalen Politik die Zuwanderungsprobleme nicht lösen lassen. Benötigt wird ein europäisches Konzept, das die Einwanderung regelt. Eine vorausschauende Politik muß sich vor allen Dingen darum bemühen, die Ursachen zu beeinflussen, die Menschen dazu treiben, ihre Heimat zu verlassen. Wanderungen aus wirtschaftlicher oder politischer Not müssen durch entsprechende außen- und entwicklungspolitische Maßnahmen verhindert werden. Für die in Deutschland lebenden Ausländer muß eine Politik betrieben werden, die ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Rechts-, Sozial- und Wirtschaftssystem ermöglicht. Eine offene moderne Gesellschaft ist es sich auch schuldig, den ethnischen Minderheiten ihre kulturellen Eigenheiten zu belassen. Diese Aussagen gelten sowohl für die Ausländer in den alten Bundesländern als auch für die Ausländer in den neuen Bundesländern, die zur Zeit besonders von ausländerfeindlichen Äußerungen, Verhaltensweisen und Angriffen betroffen sind.
Wichtig ist, nochmals zu betonen, daß eine Einwanderungspolitik ergriffen werden muß, die den Zugang zum Aufnahmeland Deutschland regelt, aber den hier lebenden Ausländern die Integration, nicht die Assimilation anbietet. In den
[Seite der Druckausg.: 8 ]
oben zitierten "Thesen zu einem ganzheitlichen Konzept für Zuwanderungspolitik" wird Integration definiert als "Prozeß des Fortschritts, der die soziale Marginalisierung von Zuwanderern verhindert oder dieser entgegenwirkt". Die gesellschaftliche Legitimierung wird dort aus dem in Westeuropa anerkannten Grundsatz der Solidarität mit den Armen, ihre politische Legitimierung aus dem Grundsatz der Gleichberechtigung und die wirtschaftliche Rechtfertigung aus den Vorteilen, die die Gesellschaft daraus hat, daß alle Mitglieder im Arbeitsleben stehen, abgeleitet. Durch diese Aussagen wird der Integrationsansatz unterstützt.
Die Diskussion in den allen Bundesländern in den 80er Jahren um die Stellung der Ausländer in der deutschen Gesellschaft hat dazu geführt, daß gesellschaftspolitische Gruppen wie Gewerkschaften, Kirchen, Bürgerinitiativen und politische Parteien wie die SPD ein neues Ausländergesetz für notwendig erachtet haben. Insbesondere wurde gefordert, von den vielen Ermessensentscheidungen im Ausländergesetz von 1965 abzugehen, die de facto Einwanderungssituation in der damaligen Bundesrepublik anzuerkennen und die Rechtssicherheit für langjährig hier lebende Ausländer - vor allem aus Nicht-EG-Staaten - zu erhöhen. Die de facto Einwanderungssituation läßt sich an den Daten zur Zahl und Struktur der ausländischen Wohnbevölkerung ablesen: Verstärkter Familiennachzug seit den 70er Jahren, steigende Aufenthaltsdauer, drei Viertel der ausländischen Kinder unter 16 Jahren sind hier geboren und aufgewachsen. Obwohl m.E. Ende der 80er Jahre zwischen Bundesregierung, Opposition und gesellschaftspolitischen Gruppen ein Konsens bestand, daß ein neues Ausländergesetz erlassen werden sollte, gab es hinsichtlich der Formulierungen und der Details heftige Differenzen. Der Referentenentwurf für ein neues Ausländergesetz von 1988 wurde niemals offiziell vorgestellt, aber in Teilen von den Medien publiziert. Nach einer heftigen und kritischen Diskussion in der Öffentlichkeit wurde dieser Entwurf dem Bundeskabinett gar nicht vorgelegt. Nachdem ein neuer Bundesminister des Inneren berufen worden war, veröffentlichte er 1989 einen weiteren Referentenentwurf für die Neuregelung des Ausländerrechts. In Anhörungen haben Kirchen, Gewerkschaften, Verbände und andere Organisationen zu diesem Entwurf ihre - meist kritischen - Stellungnahmen dargelegt. Die SPD-Bundestagsfraktion hat Ende 1989 dem Parlament ihren Entwurf für ein Ausländergesetz zugeleitet. Nach mehreren Überarbeitungen legte die CDU/CSU/FDP-Regierung der Bundesrepublik Deutschland jedoch einen Gesetzentwurf für ein neues Ausländergesetz vor, der Mitte
[Seite der Druckausg.: 9 ]
1990 vom Parlament angenommen worden ist. Nach der Vereinigung besitzt dieses neue Ausländergesetz nun Geltung sowohl für die alten als auch für die neuen Bundesländer. Die Kritik, daß die Integrationszusage der Bundesregierung an die länger hier lebenden Ausländer und die damit verbundene Rechtssicherheit durch viele restriktive Voraussetzungen und Einzelbestimmungen wieder in Frage gestellt wird, muß jedoch aufrecht erhalten werden. In dem Beitrag von E. de Haan finden sich viele Belege für diese Aussage. Auch das neue Gesetz von 1990/1991 sieht Ausländer als potentielle Gefahr und trägt kaum Züge einer neuen Partnerschaft zwischen Ausländern und Einheimischen.
Da das heute für die gesamte Bundesrepublik Deutschland geltende Ausländergesetz vor der Vereinigung im Oktober 1990 beraten und abschließend formuliert worden ist, orientierte es sich - naturgemäß - lediglich an der Situation der Ausländer in den alten Bundesländern. Seine Anwendung in den neuen Bundesländern wird der sozialen Situation der dort lebenden Ausländer in keiner Weise gerecht. Sogar ausländische Arbeitnehmer im Regierungsabkommen zwischen der ehemaligen DDR und Vietnam, die sich mehr als fünf und weniger als acht Jahre in der DDR aufgehalten hatten, können nach dem neuen Ausländergesetz lediglich eine "Aufenthaltsgenehmigung" erhalten. Viele Einzelschicksale der Ausländer können nicht angemessen berücksichtigt werden.
E. de Haan weist in seinem Beitrag auf die Textfülle des Ausländergesetzes hin, die auch den Erläuterungsbedarf vergrößert hat. Heute müssen die Ausländerbehörden im Einzelfall Gesetz und Verordnungen ohne lenkende Verwaltungsvorschriften anwenden, da das Gesetzgebungsverfahren mit großer Schnelligkeit vorangetrieben worden ist. Rechtsansprüche und nach wie vor viele Ermessensentscheidungen werden vorläufig nach den "Anwendungshinweisen" bearbeitet, die vom Bundesinnenminister formuliert werden. Aus den Ausführungen zu dem neuen Ausländergesetz läßt sich sehr deutlich die Verzahnung zur bisherigen Ausländerpolitik ablesen.
Ausländerpolitik und Ausländergesetz bestimmen die Rahmenbedingungen des Lebens der Ausländer in Deutschland. Ihre Festlegungen und gesetzlichen Bestimmungen werden von den Einheimischen zur Legitimierung ihrer Haltung gegenüber Ausländern herangezogen. Das heißt, sie beeinflussen mit, ob die Einheimischen gegenüber Ausländern eher mit Akzeptanz und Toleranz oder mit Abwehr und Ausländerfeindlichkeit reagieren. Dieser Zusammenhang zeigt
[Seite der Druckausg.: 10 ]
sich z. Zt. besonders deutlich in den neuen Bundesländern. Die Diskussionsbeiträge von N.T. Cu und E. Muchanga geben hierfür eindrucksvolle Beispiele.
Der Frage der Ausländerfeindlichkeit - ihren Ursachen und den Möglichkeiten ihrer Bekämpfung - wird in einer Reihe von Beiträgen nachgegangen. Sicherlich ist es besonders erschreckend zu hören, daß die Ausländerfeindlichkeit in den neuen Bundesländern gemäß empirischer Studien sehr hoch ist. Etwa ein Viertel der befragten Deutschen in den fünf neuen Bundesländern sind deutlich ablehnend gegen Ausländer eingestellt. Nur ein Fünftel ist als Befürworter einer aktiven Integrationspolitik anzusehen und mehr als die Hälfte der Befragten war in ihrer Haltung gegenüber Ausländern ambivalent. Aber die Menschen in den alten Bundesländern haben keinen Anlaß, diese Tatsachen selbstgefällig zur Kenntnis zu nehmen. Denn auch in der alten Bundesrepublik gibt es die Parole "Ausländer raus". I. Runge geht darauf ein, daß autoritäre Erziehung die Feindseligkeit gegen Menschen mit anderen Grundhaltungen und Lebensweisen untermauert. Dieser Erziehungsstil war in der DDR an der Tagesordnung. Der Mangel an demokratischer Tradition scheint ihr eher der Grund für Ausländerhaß zu sein als Arbeitslosigkeit, Wohnraummangel und die allgemeine Unsicherheit der Menschen im Osten. S. Gugutschkow kennzeichnet dagegen die gegenwärtigen wirtschaftlichen Probleme in den neuen Bundesländern als eine Ursache für die Fremdenfeindlichkeit. Diese Probleme führen zu Arbeitslosigkeit oder Angst davor und verunsichern einen Großteil der Bevölkerung in bezug auf ihre persönlichen Zukunftsperspektiven. Eine nicht weniger wichtige Ursache für die Ausländerfeindlichkeit ist für S. Gugutschkow jedoch in der verfehlten Ausländerpolitik unter dem SED-Regime zu sehen. Diese Politik hat den Aufenthalt ausländischer Arbeitnehmer strikt befristet, hat sie wohnungsmäßig ghettoisiert, sie zu einem Leben ohne Familie verurteilt und kaum Kontakte zur deutschen Bevölkerung zugelassen. Daher waren in der ehemaligen DDR keine Voraussetzungen für ein gegenseitiges Kennenlernen und die Entwicklung von Toleranz gegenüber Fremden gegeben. U. Ueberschär kommt bei ihrer Analyse von Tageszeitungen in den neuen Bundesländern zu dem Schluß, daß Ausländerfeindlichkeit ebenfalls oft in Verbindung mit rechtsradikalen Denkmustern und Organisationsformen steht.
Ansätze zur wirksamen Bekämpfung der Ausländerfeindlichkeit sind auf der Tagung in Leipzig bewußt im Hinblick auf die alten und neuen Bundesländer
[Seite der Druckausg.: 11 ]
diskutiert worden. Übereinstimmung bestand, daß der Arbeit von Ausländerbeauftragten, von Selbstorganisationen der Ausländer sowie deutsch-ausländischen Vereinen hier eine besondere Bedeutung zukommt und daß diese Personen/Institutionen viel dazu beitragen können, das Zusammenleben von Ausländern und Deutschen im Sinne des o.g. Integrationsansatzes zu gestalten. Besonders betont wurden darüber hinaus die Möglichkeiten von Gewerkschaften und von Medien, zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit beizutragen. Hier sind die Beiträge von S. Müller und U. Ueberschär anzuführen. Die IG Metall sieht in der direkten Zusammenarbeit mit den ausländischen Arbeitnehmern eine der zentralen Aufgaben der Integration und damit auch eine Chance zum Abbau von Vorurteilen und Ängsten. S. Müller weist in diesem Zusammenhang ebenfalls auf die Notwendigkeit der Neuorientierung der Ausländerpolitik hin. Außerdem vertritt er ebenso wie K.H. Rosen und S. Gugutschkow die Meinung, daß für die Gestaltung des positiven Zusammenlebens von Deutschen und Ausländern die Schaffung entsprechender Strukturen notwendig ist. S. Müller berichtet, daß in der IG Metall mit den Ausländerausschüssen ein Instrument geschaffen wurde, das es ermöglicht, die Interessen der ausländischen Arbeitnehmer in der Gesamtpolitik der Organisation zu berücksichtigen. S. Gugutschkow nennt Strukturen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene als Voraussetzung, beim Abbau von Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhaß erfolgreich sein zu können. Er bezieht sich hierbei z.B. auf das Amt von kommunalen Ausländerbeauftragten. Hinsichtlich fehlender Strukturen betont K.H. Rosen, daß es an der Zeit sei, ein staatliches Amt für Wanderungsfragen und Integration, einen Beirat für Wanderung unter Beteiligung der gesellschaftlichen Gruppen und der Selbsthilfeeinrichtungen der Zuwanderer sowie schließlich ein Europäisches Amt für Migration zu schaffen.
In zahlreichen Beiträgen auf der Tagung wurde betont, daß der Berichterstattung in den Medien eine Schlüsselstellung zukommt. Die Medien beeinflussen die öffentliche Meinung nicht nur durch die Auswahl der Themen, sondern insbesondere durch die Art der Darstellung. Diese Rolle der Medien sollte noch stärker als bisher dazu genutzt werden, Ausländerfeindlichkeit anzuprangern und zu bekämpfen. Allerdings ist hier ein sehr differenziertes Vorgehen notwendig. U. Ueberschär stellte die Ergebnisse und Schlußfolgerungen aus der Analyse der Berichte zur Ausländerthematik in verschiedenen Tageszeitungen der neuen Bundesländer dar. Ausgehend von diesen Erkenntnissen fordert sie, daß politische Parteien eine eindeutigere Position zu Fragen der Aus-
[Seite der Druckausg.: 12 ]
länderpolitik einnehmen und in den Medien deutlich machen. Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Initiativgruppen usw. sollten verstärkt die Möglichkeit erhalten, ihre Programme und ihre praktische Ausländerarbeit der Öffentlichkeit vorzustellen. Über positive Beispiele des Zusammenlebens von Ausländern und Deutschen sollte häufiger in den Medien berichtet werden. Informationen zur Geschichte von Ausländern in Deutschland, aber auch von Deutschen im Ausland könnten ebenfalls hilfreich sein.
Das Fazit der Diskussion war, daß Maßnahmen und Methoden zur Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhaß außerordentlich vielgestaltig sind und differenziert genutzt werden müssen. So unterschiedlich die Maßnahmen und Methoden sind, so verschieden sind auch die Partner, die sich für diese Aufgabe zusammenfinden. Die Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung zu dieser Thematik in Leipzig sollte mithelfen, auf die komplexen Zusammenhänge von Migrationsbewegungen - Ausländerpolitik - Ausländerrecht - Reaktionen von. Einheimischen - Ausländerfeindlichkeit hinzuweisen. Die Veröffentlichung dieses Tagungsbandes soll dazu dienen, Ansätze zur Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit einer größeren Öffentlichkeit sichtbar zu machen und zur Zusammenarbeit von verschiedenen Personengruppen und Institutionen mit dieser Zielsetzung aufzufordern.
Mein Dank gilt den Referenten der Tagung, die ihre Beiträge in sehr kurzer Zeit für die Publikation zur Verfügung gestellt haben, sowie meinen Kollegen Günther Schultze und Brigitte Juchems. Günther Schultze war für die Konzeption der Tagung, Tagungs- und Diskussionsleitung verantwortlich. Er hat außerdem die Redaktion der vorliegenden Broschüre übernommen. Vorbereitung der Tagung, Tagungssekretariat sowie die Erstellung der Broschüre lagen in der Verantwortung von Brigitte Juchems. Beide sind Mitarbeiter der Abteilung Arbeitsund Sozialforschung des Forschungsinstitutes der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Bonn, August 1991 |
Dr. Ursula Mehrländer |
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Mai 2001