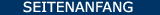![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 67 ]
4. Umsetzung, Weiterentwicklung und Rahmenbedingungen von Integrationspolitiken
4.1 Vorkehrungen zur Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationspolitiken
Im allgemeinen kann davon ausgegangen werden, daß die Wirksamkeit von Integrationspolitiken zunimmt, wenn diese konsequent umgesetzt werden und darüber hinaus auch in systematischer Weise überprüft wird, ob und in welchem Maße Programme und Maßnahmen realisiert werden und wie sie weiterentwickelt werden können. Für diese Erfordernisse der Implementation und Evaluierung (Wollmann 1991) müssen von daher besondere Vorkehrungen getroffen werden, und zwar im Bereich spezieller und allgemeiner Integrationspolitiken. Im folgenden werden einige Beispiele erläutert, die in erster Linie auf die Gestaltung des Zusammenlebens von Einheimischen und Zugewanderten bezogen sind, darüber hinaus aber auch für die gesamtgesellschaftliche Integration Bedeutung haben.
Relevant sind in dieser Hinsicht zum einen spezielle Institutionen und Organisationen, die über entsprechende Kompetenzen, ausreichende sachliche Voraussetzungen und qualifiziertes Personal verfügen. Hierbei kann es sich um staatliche oder halb-staatliche Institutionen auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene, um Ombudsstellen, lokale Einrichtungen und/oder nicht-staatliche Organisationen handeln. In dieser Hinsicht bestehen in den westeuropäischen Ländern unterschiedliche Ansätze und Erfahrungen. [Fn.121: Vgl. u.a. Zegers de Beijl 1995; Schulte 1995; Forbes 1995; Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Ausländer 1996. Die vergleichende Betrachtungsweise kann und soll dazu beitragen, die spezifischen Ausprägungen der jeweiligen Institutionen und Organisationen in den einzelnen Ländern zu erkennen, die damit verbundenen Vor- und Nachteile einzuschätzen und wechselseitige Lernprozesse zu fördern, wobei allerdings unvermittelte Übertragungen vermieden werden sollten.]
So ist z.B. im Vereinigten Königreich auf nationaler Ebene die durch das Race-Relations-Act von 1976 errichtete Commission for Racial Equality (CRE) von besonderer Bedeutung. Hierbei handelt es sich um eine staatliche Behörde, deren Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Integrations- und Antidiskriminierungspolitik liegt. Sie soll insbesondere auf den Abbau von Diskriminierung hinwirken, Chancengleichheit und gute Beziehungen zwischen Personen unterschiedlicher „rassischer" Gruppen fördern, die Umsetzung des Gesetzes beobachten und Vorschläge für dessen Revision machen, im Bereich der „Rassenbeziehungen" Forschungen durchführen und unterstützen. Verhaltensrichtlinien für die Praxis entwickeln, Organisationen unterstützen, die Anti-Rassismus- und Anti-Diskriminierungsarbeit leisten, und im Falle von Anzeigen und Aufrufen mit diskriminierendem Charakter intervenieren. Zur Erfüllung dieser Aufgaben verfügt die CRE über bestimmte Kompetenzen. In den Fällen, in denen ein begründeter Diskriminierungsverdacht vorliegt, kann sie Individuen bei Klagen unterstützen, als Kläger auftreten und formelle Untersuchungen durchführen. Die CRE wirkt auch bei der statistischen Erfassung der Erwerbstätigen und bei der Beobachtung der Folgen von Entscheidungen im Bereich der Rekrutierung, Auswahl, Förderung und Entlassungen von Arbeitskräften mit. Die von der CRE gesammelten statistischen Daten können bei Prozessen als Beweismaterial verwendet werden.
In den Niederlanden gibt es eine breites Netz von Einrichtungen und Organisationen, die - im Rahmen der hier praktizierten „Minderheitenpolitik" - eine kontinuierliche Antidis-
[Seite der Druckausg.: 68 ]
kriminierungsarbeit auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene leisten. Diese Einrichtungen werden vor allem von Vertretern der Minderheitengruppen und der einheimischen Bevölkerung sowie von Experten und Mitgliedern anderer gesellschaftlicher Gruppen getragen; sie sind in der Regel unabhängig, werden jedoch vielfach von staatlicher Seite finanziell unterstützt. Zu ihren Hauptaufgaben gehört es, Diskriminierungsfälle zu bearbeiten und zu untersuchen, die Tätigkeit rassistischer Gruppierungen zu beobachten, Organisationen und private Initiativen mit antirassistischer Zielsetzung zu unterstützen, Behörden über Maßnahmen und Möglichkeiten für effektive Vorgehensweisen gegen Rassismus zu beraten, die Öffentlichkeit zu unterrichten und Untersuchungen durchzuführen, um strukturelle Formen von Diskriminierung offen zu legen.
Zu den in der Bundesrepublik bestehenden Einrichtungen, die sich mit der Umsetzung, Überprüfung und Bewertung von Integrationspolitiken auseinandersetzen, gehören vor allem die Ausländerbeauftragten auf der Ebene von Bund, Ländern und Gemeinden. Während das Amt der Ausländerbeauftragten des Bundes bisher auf einem Kabinettsbeschluß beruhte, wird es in der ab 1.11.1997 geltenden Fassung des Ausländergesetzes - wenn auch in Form einer „Kann"-Vorschrift - erstmals gesetzlich verankert. Es wird beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung eingerichtet und soll mit den für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Personal- und Sachmitteln ausgestattet werden. Zu den Aufgaben der Ausländerbeauftragten gehört es danach,
- „ die Integration der dauerhaft im Bundesgebiet ansässigen ausländischen Bevölkerung zu fördern und insbesondere die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung ihrer Integrationspolitik zu unterstützen sowie für die Weiterentwicklung der Integrationspolitik auch im europäischen Rahmen Anregungen zu geben;
- die Voraussetzungen für ein möglichst spannungsfreies Zusammenleben zwischen Ausländern und Deutschen sowie unterschiedlichen Gruppen von Ausländern weiterzuentwickeln, Verständnis füreinander zu fördern und Fremdenfeindlichkeit entgegenzuwirken;
- nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlungen, soweit sie Ausländer betreffen, entgegenzuwirken;
- den Belangen der im Bundesgebiet befindlichen Ausländer zu einer angemessenen Berücksichtigung zu verhelfen;
- über die gesetzlichen Möglichkeiten der Einbürgerung zu informieren;
- auf die Wahrung der Freizügigkeitsrechte der im Bundesgebiet lebenden Unionsbürger zu achten und zu deren weiterer Ausgestaltung Vorschläge zu machen;
- Initiativen zur Integration der dauerhaft im Bundesgebiet ansässigen ausländischen Bevölkerung auch bei den Ländern und kommunalen Gebietskörperschaften sowie bei den gesellschaftlichen Gruppen anzuregen und zu unterstützen;
- die Zuwanderung ins Bundesgebiet und in die Europäische Union sowie die Entwicklung der Zuwanderung in anderen Staaten zu beobachten;
- in den Aufgabenbereichen der Nummern 1 bis 8 mit den Stellen der Gemeinden, Länder, anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Union selbst, die gleiche oder ähnliche Aufgaben haben wie die Beauftragte, zusammenzuarbeiten;
- die Öffentlichkeit zu den in den Nummern 1 bis 9 genannten Aufgabenbereichen zu informieren."
[Fn.122: Vgl. Gesetz zur Änderung ausländer- und asylrechtlicher Vorschriften vom 29. Oktober 1997 (BGBI. l, S. 2584ff.), insbesondere Art. 1, Ziffer 21 ff. In der ab 1. November 1997 geltenden Fassung des Ausländergesetzes handelt es sich um die §§ 91a-c (Rittstieg 1997, S. 50f.).]
Zur Umsetzung dieser Aufgaben werden der Beauftragten gewisse Beteiligungs-, Vorschlags- und Interventionsrechte eingeräumt und die Bundesministerien zur Unterstützung der Ausländerbeauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet. Darüber
[Seite der Druckausg.: 69 ]
hinaus ist vorgesehen, daß die Beauftragte dem Deutschen Bundestag mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über die Lage der Ausländer in Deutschland erstattet. Im Vergleich mit der bisherigen Situation stellen diese gesetzlichen Vorschriften eine nicht unwesentliche Verbesserung dar. Die Einrichtungen der Ausländerbeauftragten könnten allerdings eine noch größere Bedeutung erlangen, wenn ihnen auf Bund-, Länder- und Gemeindeebene die politische Gestaltung des Bereichs „Migration und Integration" übertragen würde und/oder ihre Aufgaben im Bereich von Antidiskriminierungsmaßnahmen mit denen der Dienststellen der Frauen- und Behindertenbeauftragten abgestimmt oder diese verschiedenen Einrichtungen zu Ämtern für Gleichberechtigung und Menschenrechte zusammengefaßt würden (vgl. z.B. Rittstieg/Rowe 1992, S. 87ff.). Zudem gibt es seit einigen Jahren in einzelnen Kommunen und Regionen Einrichtungen für Antidiskriminierungs-, Gleichstellungs- und Integrationspolitiken oder Bestrebungen, derartige oder ähnliche Einrichtungen zu schaffen. Hierbei kommt dem „Amt für multikulturelle Angelegenheiten" der Stadt Frankfurt am Main unter quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten die (bisher) größte Bedeutung zu.
[Fn.123: Vgl. Wolf-Almanasreh 1993; Stadt Frankfurt am Main. Amt für multikulturelle Angelegenheiten 1996. Zu Einrichtungen bzw. Ansätzen in anderen Städten und Regionen vgl. z.B. Landeshauptstadt Hannover 1995, Heinold 1995, Pollmann 1995 und Ausländerbeauftragte des Bundes, der Länder und der Gemeinden 1996. In diesem Zusammenhang sind auch Ausländerbeiräte, sofern sie demokratisch legitimiert sind und über ausreichende Kompetenzen und Ausstattungen verfügen, relevant wie auch die Regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, die vor allem in Nordrhein-Westfalen und in den neuen Bundesländern arbeiten. Deren pädagogische, politische und kulturelle Aktivitäten sind auf die Gewaltprävention vor allem in Schulen und deren Umfeld gerichtet, wobei als Aufgaben die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und die Integration von Ausländern im Vordergrund stehen.]
Schließlich können auch bestimmte innovative Reformen innerhalb der Verwaltung, insbesondere im Bereich der Ausländerbehörden zu einer adäquateren Bewältigung von Problemen und Konflikten, die z.B. zwischen Mitarbeitern und Klienten dieser Einrichtungen bestehen, beitragen.
[Fn.124: Vgl. dazu beispielhaft die in der Ausländerbehörde von Duisburg durchgeführten Reformen, die von Brandt/Maschke (1997) unter dem Gesichtspunkt „Weniger Konflikte durch mehr 'Kundenorientierung'" interpretiert werden.]
Auch bezogen auf die Europäische Union gibt es Ansätze und Vorschläge, die darauf abzielen, die institutionellen Voraussetzungen für eine wirksamere Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und Intoleranz und damit die Bedingungen für ein gleichberechtigtes und friedliches multikulturelles Zusammenleben zu verbessern. So wurde u.a. vom Europäischen Parlament und der „Startlinie" an die Adresse der EU-Kommission gefordert,
- die Beseitigung von Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion oder nationaler, sozialer oder ethnischer Herkunft und die Förderung harmonischer Beziehungen zwischen solchen Personen oder Personengruppen als Aufgabe der Gemeinschaft zu betrachten und in diesem Sinne den Gründungsvertrag der Europäischen Gemeinschaft zu ergänzen sowie eine Gemeinschaftsrichtlinie über Rassendiskriminierung zu verabschieden, die sich sowohl auf die Gemeinschaftsbürger wie die in der Gemeinschaft ansässigen Staatsangehörigen dritter Länder bezieht.
- über die Phänomene und Ursachen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus systematisch Informationen zu sammeln und kontinuierlich öffentlich zu berichten,
- Konzeptionen zur Bekämpfung der strukturellen Ursachen von Ausländerfeindlichkeit und Rassismus zu entwickeln,
[Seite der Druckausg.: 70 ]
- die Bekämpfung von Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit in den Zuständigkeitsbereich eines Kommissionsmitglieds einzubeziehen,
- die Kooperation und den Austausch mit unabhängigen Organisationen zu intensivieren, die bereits auf diesem Gebiet tätig sind,
- Initiativen zu unterstützen, die sich mit der Sammlung von Informationen und Erfahrungen beschäftigen und um den Aufbau von Netzwerken auf europäischer Ebene bemühen,
- die Aufmerksamkeit und die Sensibilität der Öffentlichkeit und bei Entscheidungsträgern zu fördern, und
- über Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahmen regelmäßig und umfassend zu berichten. [Fn.125: Vgl. Die Ausländerbeauftragte des Senats von Berlin 1994, S. 61ff. Zum „Europäischen Jahr gegen Rassismus 1997" vgl. Interkultureller Rat 1997 und Europäische Kommission 1997.]
Zudem gibt es seit einiger Zeit Vorschläge und Bemühungen, die darauf gerichtet sind, auf Gemeinschaftsebene eine „Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" einzurichten.
[Fn.126: Vgl. den „Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Einrichtung einer Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" (Europäische Kommission 1997, S. 123ff.).]
Diese Stelle soll Ausmaß und Entwicklung der Phänomene und Erscheinungsformen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus untersuchen, deren Ursachen, Folgen und Auswirkungen analysieren und sich mit Beispielen und Möglichkeiten der praktischen Bekämpfung dieser Phänomene befassen. Mit Hilfe der gewonnenen Informationen soll die Entwicklung von Gegenmaßnahmen und -aktionen auf den Ebenen der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedstaaten gefördert werden. Nicht zuletzt im Hinblick auf das „Europäische Jahr gegen Rassismus" soll damit auch bewiesen werden,
„daß die Gemeinschaftsorgane durch eine enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Bürger maßgeblich dabei unterstützen können, sich für den Schutz der Menschenrechte und den Aufbau einer besseren, gerechteren Gesellschaft einzusetzen, in der die unterschiedlichen Gruppen, aus denen sie besteht, in Frieden, gegenseitigem Respekt und ohne Furcht leben können" (Europäische Kommission 1997, S. 8).
Für die Konzipierung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationspolitiken sind nun allerdings nicht nur bestehende, veränderte oder neu zu schaffende Institutionen und Organisationen von Bedeutung, sondern auch gesellschaftspolitische Initiativen und Aktivitäten. Beispielhaft sind in dieser Hinsicht die vielfältigen Initiativen und Aktivitäten, die sich insbesondere als Reaktion auf die Zunahme rassistisch motivierter Gewaltanschläge auf Immigranten und Angehörige anderer Minderheiten in den vergangenen Jahren in den westeuropäischen Ländern auf verschiedenen Ebenen entwickelt haben.
[Fn.127: Einen regelmäßigen Überblick über die vielfältigen Initiativen und Aktivitäten vermittelt der Informationsdienst „Forum Buntes Deutschland" 1992ff., der von der Gruppe „Aktion COURAGE e.V. - SOS Rassismus" seit 1992 in Bonn herausgegeben wird. Vgl. auch Informationsdienst zur Ausländerarbeit 1/1994.]
Hierzu gehören die „Zivilcourage" von Einzelpersonen, die Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit von Initiativgruppen und Organisationen, Protestdemonstrationen und Lichterketten, „Runde Tische" mit Vertretern der Bevölkerung, der gesellschaftlichen Gruppen und der Parteien, Antirassismus- und Flüchtlingstage sowie Ausländer- bzw. Interkulturelle Wochen, Erklärungen von gesellschaftlichen Verbänden und politischen Parteien, Entschließungen und Aufrufe von politischen Institutionen
[Fn.128: Vgl. z.B. Europäische Kommission 1997.] sowie Maßnah-
[Seite der Druckausg.: 71 ]
men zur Bekämpfung von Gewalt, bei denen staatliche und nichtstaatliche Stellen eng zusammenwirken
[Fn.129: Vgl. den Überblick in Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Ausländer 1995, S. 77ff.]
Im Hinblick auf die Problem- und Konfliktbewältigung und die Integration haben diese verschiedenen Initiativen und Aktivitäten vor allem deswegen Bedeutung, weil sie dazu beitragen,
- den Personen, die von Diskriminierung und Gewalt bedroht oder betroffen sind, Schutz, Beratung und Hilfe zu bieten,
- gegen Fälle von Diskriminierung zu protestieren und darüber Diskussionsprozesse zu initiieren,
- öffentliche Signale gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus zu setzen,
- für die Realisierung eines gleichberechtigten und multikulturellen Zusammenlebens von Mehrheit und Minderheiten einzutreten,
- die positive Funktion der Immigranten für die ökonomische, soziale und kulturelle Entwicklung der westeuropäischen Länder hervorzuheben,
- die Lösung von Konfliktfällen (auch) auf dem Wege von Kontakten, Gesprächen und Vermittlungen zu ermöglichen,
- demokratische und antirassistische Bewußtseinsformen und Verhaltensweisen im Alltag zu verankern,
- die Kooperation und Netzwerke zwischen antirassistischen Initiativen und Gruppen zu fördern, und
- Einfluß auf politische Organisationen, Institutionen und Medien auszuüben und deren Zusammenarbeit in diesem Bereich zu verbessern.
Auch wenn diese verschiedenen Initiativen und Aktivitäten in den westeuropäischen Einwanderungsgesellschaften mit verschiedenen Problemen und erheblichen Widerständen konfrontiert sind, so stellen sie doch insgesamt einen Ausdruck einer zivilen, demokratischen und integrativen politischen Kultur und einen Beitrag zu deren Weiterentwicklung dar.
4.2 Der Basiskonsens als Rahmen und Grenze autonomer Entfaltung und Konfliktaustragung
Zu den charakteristischen Merkmalen pluralistischer Demokratien und multikultureller Gesellschaften gehören das Recht auf autonome Entfaltung von Individuen und Gruppen und der offene Charakter des gesellschaftspolitischen Prozesses. Das „Gemeinwohl" ist somit nicht eine im Vorhinein festgelegte Konstante, sondern eine ständig neu zu bewältigende Aufgabe und das Ergebnis einer permanenten politischen Auseinandersetzung. Kontroversen und Konflikte zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Kräften werden von daher grundsätzlich als legitim betrachtet. Damit diese nicht zur Desintegration des Gemeinwesens führen, müssen allerdings bestimmte Rahmenbedingungen und Grenzen des Dissenses festgelegt werden. [Fn.130: Die Festlegung von Grenzen des Dissenses ist nach Bobbio in jedem gesellschaftlichen System vorhanden: „Ebensowenig wie es kein System gibt, in dem der Dissens nicht trotz aller von oben verhängten Einschränkungen durchschiene, gibt es kein System, in dem der Dissens nicht eingeschränkt würde, trotz aller Erklärungen über die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit etc. Die Wirklichkeit kennt keine Idealtypen, sondern nur verschiedene Annäherungen an den einen oder anderen Typ." (Bobbio 1988c, S. 62)]
[Seite der Druckausg.: 72 ]
Ein zentrales Mittel hierzu besteht in der Anerkennung eines Minimalkonsenses durch alle gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Akteure.
[Fn.131: Dabei handelt es sich in erster Linie um das, was Basso als „induzierten Konsensus" bezeichnet und von dem „spontanen Konsensus" unterschieden hat. Während es bei dem zweiten Typus um die „natürliche" Zustimmungsbereitschaft gehe, die sich der „immanenten Logik des Systems" verdanke, resultiere der ersten Typus aus vielfältigen Mitteln und Prozessen der (bewußten) politischen Beeinflussung (Basso 1975, S. 18ff.).]
Grundlegende Aufgabe dieses Konsenses ist es, als verbindlicher Rahmen für gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen zu fungieren, bei deren Austragung Formen der physischen Gewalt auszuschließen und den Bestand sowie die Entwicklung der rechtsstaatlichen und sozialen Demokratie im gesellschaftspolitischen und sozio-kulturellen Bereich zu garantieren. Im Unterschied zum politisch kontroversen Sektor soll sich der nicht-kontroverse Bereich nur auf politische Grundsatzfragen beziehen. Dazu zählen zum einen formale Elemente, insbesondere rechtsstaatliche und demokratische Verfahrensregeln, zum anderen inhaltliche Elemente, vor allem bestimmte Grundwerte oder sog. regulative Ideen.
[Fn.132: Nach Smolicz muß die multikulturelle Gesellschaft, um einen Konsens zu erreichen, gewisse „überethnische oder geteilte Werte" besitzen, die für alle Gruppen akzeptabel sind. Solche Werte überstiegen und ergänzten die mehr individuellen Werte jeder Gruppe. Dabei sei nicht so sehr der Ursprung dieser Werte wichtig, sondern ihre endgültige Anerkennung als übergreifendes Kernstück durch die ganze Gesellschaft: „In einer Gesellschaft, die auf Konsens aufgebaut ist, setzt das Beharren auf kulturellem Pluralismus die Existenz einer gewissen kulturellen Basis verinnerlichter Werte voraus. Weiterentwickelt können sie die Art von Einheit liefern, die unentbehrlich für einen modernen Staat ist, während sie gleichzeitig ein Aufblühen kultureller Mannigfaltigkeit gestatten, das (...) eine Garantie für intellektuelles Wachstum und Kreativität ist." (Smolicz 1982, S. 45f.)]
Diese Prinzipien sind in den westlichen Demokratien in der Regel in den politischen Traditionen und Kulturen der jeweiligen Länder und/oder in deren Verfassungen verankert.
[Fn.133: Als Reaktion auf die Erfahrungen der Weimarer Republik, in der die Gegner der Demokratie diese (auch) mit den Mitteln der Demokratie bekämpfen und schließlich beseitigen konnten, wurden im Grundgesetz der Bundesrepublik die zentralen Bestandteile der demokratischen Ordnung rechtlich fixiert und überdies als unänderbar erklärt (Art. 79 Abs. 3 GG). Zusätzlich wurden besondere Bestimmungen zur Bekämpfung des Mißbrauchs der Freiheit verankert, zu denen insbesondere die Bestimmungen über die Verwirkung von Grundrechten (Art. 18 GG) und über das Verbot von Parteien und Vereinigungen gehören, die nach ihren Zielen und nach ihrer Tätigkeit darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen (Art. 21 Abs. 2 GG). Für diese Einrichtungen ist die Bezeichnung „streitbare" oder „wehrhafte" Demokratie üblich geworden. Diese soll dazu beitragen, „daß der für die Demokratie unentbehrliche Grundkonsens erhalten bleibt und demokratische Rechte nicht zur Zerstörung der Demokratie mißbraucht werden können" (Schindler 1990, S. 493ff.). Zu weiteren Elementen der „streitbaren Demokratie" in der Bundesrepublik gehören der nachrichtendienstliche Verfassungsschutz, die präventive Unterbindung oder Ausschaltung verfassungsgegnerischer Verlautbarungen aus dem Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß (z.B. Einschränkungen des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses), die strafrechtliche Verfolgung strafbarer Handlungen gegen die politische Grundordnung, in der Ausnahmesituation die Aktualisierung des Rechts auf Widerstand gemäß Art. 20 Abs. 4 GG, die Verwirkung von Grundrechten und die Hervorhebung der beamtenrechtlichen Verfassungstreuepflicht (Radikalenerlaß) (vgl. Schmidt 1995, S. 941 f.).]
Die Bestimmung eines derartigen Basiskonsenses ist nun in einem demokratischen System, das durch ökonomische, soziale, politische und kulturelle Heterogenität gekennzeichnet ist, keine Selbstverständlichkeit, sondern ein (Grenz-)Problem.
[Fn.134: Bobbio bezeichnet von daher die Frage des Umgang mit der „Dialektik" von Konsensus und Dissens als „Feuerprobe für ein demokratisches System" (Bobbio 1988c, S. 61 f.). Zu aktuellen Schwierigkeiten der Konsensdefinition angesichts „neuer Unübersichtlichkeiten" vgl. Denninger 1994, S. 677.]
Das, was als Basiskonsens gelten soll, ist nämlich keine konstante Wertordnung, die den geschichtlichen Prozessen und gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen enthoben ist, sondern steht in einem historischen und gesellschaftlichen Zusammenhang und unterliegt von daher in einer heterogenen Gesellschaft selbst den Einflußnahmen unterschiedlicher Akteure. Dies impliziert zugleich, daß jede Konsensvorstellung „offen und versteckt getroffene Entscheidungen (erfordert), deren gesellschaftliche Konsequenzen überdacht
[Seite der Druckausg.: 73 ]
und angegeben sein wollen." (Narr 1969, S. 31) Aufgrund dieser Beeinflussung durch Macht- und Herrschaftsinteressen kann der Basiskonsens durchaus auch widersprüchliche und dynamische Elemente enthalten, die jeweils neu reflektiert, interpretiert und gegeneinander abgewogen werden müssen.
[Fn.135: Konträre Konsensauffassungen haben in der Geschichte der Bundesrepublik in verschiedenen Zusammenhängen Bedeutung und Aktualität erlangt, so vor allem in den Auseinandersetzungen über die „Offenheit" der Wirtschaftsverfassung, in den Diskussionen über die Bedeutung des Begriffs der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung" und des Prinzips der „kämpferischen" und „abwehrbereiten" Demokratie für die Bestimmung der Grenzen von Freiheit und Pluralismus und in der Kontroverse über den Charakter und die Grenzen des „Wissenschaftspluralismus". In diesen Zusammenhang gehört auch die Diskussion über das Verhältnis von Konsens und Kontroversen in der politischen Bildung (Schiele/Schneider 1996).]
Die Bestimmung des Verhältnisses von nicht-kontroversem und kontroversem Sektor ist nicht zuletzt deswegen von besonderer Relevanz, weil die Fragen, die dem Konsensbereich zugerechnet werden, der politischen Willensbildung und der Gestaltungsfreiheit des demokratischen Gesetzgebers weitgehend entzogen sind. Hierdurch entstehen Spannungen zwischen den Postulaten der Offenheit und Vielfältigkeit der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen einerseits und Tendenzen zu deren Begrenzung andererseits.
Vor diesem Hintergrund gehen Festlegungen eines Basiskonsenses durchaus auch mit Gefahren einher, zu denen vor allem die folgenden gehören:
- Erstarrung: Ein rechtlich festgeschriebener Grundkonsens (insbesondere in der Form der „Ewigkeitsklausel" des Art. 79 Abs. 3 GG) kann den Eindruck erwecken, die Verfassung bilde eine geschlossene Wertordnung, an der bis in Details alle wichtigen Fragen meßbar sein sollen, und es kann sich die Meinung verbreiten, daß es um das sorgfältige Bewahren eines gesicherten Rechtszustandes gehe. Dies kann die Innovationsfähigkeit der Gesellschaft, die Fähigkeit, neue Impulse und Akzentverschiebungen im Wertbewußtsein hervorzubringen, behindern und geschichtlich notwendiges Alternativdenken erschweren (Schindler 1990, S. 491 f.).
- Verkehrung von Zweck und Mittel: Die Regelungen der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung" sollen nach Denninger nicht bestimmte Inhalte der Politik, sondern Struktur und Form des politischen Prozesses selbst schützen. Von zentraler Bedeutung sei in diesem Zusammenhang
„die Erhaltung der Offenheit und Freiheitlichkeit des demokratischen Meinungs- und Willensbildungsprozesses von der 'Volkswillensbildung' in den Parteien - und vorher - bis zur 'Staatswillensbildung' in allen drei Gewalten. Der Akzent ist dabei auf pluralistische Freiheit (d.h. auch Minderheitenschutz, Toleranz) und demokratische (Chancen)-Gleichheit gleichermaßen verteilt." (Denninger 1994, S. 695f.; im Original Hervorhebungen)
[Fn.136: „Deshalb, aber auch nur deshalb wehrt die freiheitliche Demokratie totalitäre Ideologien und Bestrebungen ab, die jene Offenheit der 'Gemeinwohlsuche' durch einen absoluten Wahrheits- und Herrschaftsanspruch ersetzen und in seinem Namen die vielfältige Freiheit der Bürger vernichten wollen. Sie wehrt jene auch dann ab, wenn die Verfechter solcher Ideologien zwar die formalen Verfahrensweisen parlamentarischer Demokratie (...) verbal anerkennen, in ihren Zielsetzungen aber antipluralistisch auftreten. Sie wird zur 'streitbaren', 'wehrhaften' Demokratie." (Denninger 1994, S. 715) Diese Aussagen haben auch für die Abwehr aller Ausprägungen von „fundamentalistischen" und „nationalistischen" Ideologien und Bestrebungen Gültigkeit (vgl. Hoffmann 1992, S. 157).]Dieser Zweck wird aber durch Staats- und Verfassungsschutzmaßnahmen gefährdet, die die „streitbaren" Stoßrichtung der Demokratie so ausweiten, daß der „offene" und „freiheitliche" Charakter der politischen Auseinandersetzung selbst beschnitten wird. Die Richtung des politischen Prozesses wird dann nicht mehr bestimmt durch die Meinungs- und Willensbildung aller Bürger, maßgebend werden vielmehr nur noch die Vorgaben und Entscheidungen von gesellschaftspolitischen Eliten, die die In-
[Seite der Druckausg.: 74 ]
terpretationsherrschaft über die rechtlichen und gesellschaftlichen Normen innehaben und somit die Grenzen des Basiskonsenses abstecken sowie zwischen Demokraten unterschiedlicher „Güteklassen" differenzieren (können). In dieser Ausprägung geht die „streitbare Demokratie" mit der „Gefahr einer antipluralistischen Introversion und Verhärtung des Grundkonsenses" einher (Denninger 1994, S. 715f.).
- Ausgrenzung unter Gesichtspunkten der politischen Opportunität: Mit der Definition eines Konsenses sind Entscheidungen über die Grenzen der Toleranz verbunden. Bei diesen Grenzziehungen handelt es sich nicht nur um Formen einer wissenschaftlich oder politisch orientierten Kritik, sondern um Entscheidungen mit verbindlichem Charakter über die Zulässigkeit bzw. Nichtzulässigkeit von bestimmten Verhaltensweisen oder sogar Einstellungen. Darauf verweist die Formel „Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit". Mit dieser Formel ist allerdings das zentrale Problem jeder Art von „streitbarer Demokratie" nur formuliert, aber nicht gelöst (Denninger 1994, S. 679). Zum einen können nämlich die Grenzen enger oder weiter gezogen werden. Im Gegensatz zu dem genannten Prinzip, das eher für eine restriktivere Interpretation steht, sprechen die Grundsätze „Freiheit ist immer nur Freiheit des anders Denkenden" (Luxemburg 1968, S. 134) und „Im Zweifel für die Freiheit" (Schneider 1988) eher für eine weitere Auslegung der politischen Spielräume. Zudem besteht die Möglichkeit bzw. Gefahr, daß Ausgrenzungen unter Gesichtspunkten der politischen Opportunität vorgenommen werden. [Fn.137: Ein Beispiel für derartige Tendenzen ist die in der Geschichte der Bundesrepublik erfolgte politische Instrumentalisierung der verfassungsrechtlichen Bestimmungen der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung" gegen „Radikale" bzw. „Verfassungsfeinde" im öffentlichen Dienst (Schindler 1990, S. 495f.; vgl. dazu insgesamt auch Denninger 1976). Ähnlich ausgrenzende Tendenzen enthalten national-konservativ geprägte Vorstellungen, in denen die „nationale Identität" der „Deutschen" als maßgebender Konsensinhalt definiert und „fremde" Kulturen und „Multikulturalität" als „Bedrohung" und damit „nicht vereinbar" definiert werden (vgl. oben). Nach Hufen gehen von diesem Konzept, in dem der Staat zur ethnischen „Schicksalsgemeinschaft" verklärt und damit auf das Staatsvolk als Abstammungsgemeinschaft reduziert wird, für die interne Friedenssicherung „kontraproduktive" Wirkungen aus. Das Bestreben, Nation, Kultur, Volk und Staat in möglichst homogener Weise auf einem einheitlichen Staatsgebiet zusammenzuführen, biete den Völkern nur scheinbar Sicherheit, Nähe und „Wir-Gefühl", habe aber letztlich ethnische und kulturelle Säuberungen, Bürgerkrieg und Flüchtlingsströme, in Ansätzen auch bereits wieder Religionskriege zur Konsequenz: „Auch in der Bundesrepublik der Gegenwart wird die Gefahr ethnischer Überfremdung subtil beschworen oder deutlich ausgesprochen. Verschwiegen wird dabei, daß es nicht das Zusammenleben ethnisch differenter Gruppen als solches ist, das Krisen erzeugt, sondern gerade der ethnische Nationalismus und Egoismus, der die Probleme jenes Zusammenlebens unlösbar macht. So kann es gerade der Nationalstaat in der Definition des 19. Jahrhunderts sein, der das Integrationspotential von Staat und Verfassung gefährdet, wenn er seine eigene Identität durch Ausgrenzung nationaler und kultureller Minderheiten gewinnt und damit für den gesellschaftlichen Konfliktfall leicht erkennbare Haßobjekte und Sündenböcke bereitstellt." (Hufen 1994, S. 116f.)]
Soll die Bestimmung des Basiskonsenses den Anforderungen einer rechtsstaatlichen Demokratie genügen, so ist zwar zunächst davon auszugehen, daß ein Schutz der demokratischen Verfassung unabdingbar ist, diese aber zugleich die zu schützenden Verfahrensregeln und Grundwerte enthält und somit Beschneidungen von Grundrechten zum Schutze der Verfassung diese Rechte selbst beschneiden. Nur „im klaren Bewußtsein der Unentrinnbarkeit dieses Zirkels" (Denninger 1994, S. 680) können die für alle politischen, sozialen und kulturellen Akteure verbindlichen Elemente des Basiskonsenses bestimmt werden. Letztlich entscheidender Maßstab für die Definition des Basiskonsenses und der Bestimmung von Grenzen der Toleranz müssen verfassungsrechtlich verankerte Prinzipien, insbesondere das Prinzip der Menschenwürde, die Menschenrechte sowie die Grundsätze der rechtsstaatlichen und sozialen Demokratie sein. Diese Prinzipien gelten allgemein, d.h. für Angehörige der Minderheit wie der Mehrheit und können unter Gesichtspunkten der multikulturellen Einwanderungsgesellschaft als „interkulturelles Minimum" bzw. als rechtliche Grundlage einer „ethnisch neutralen Republik" (Hoffmann
[Seite der Druckausg.: 75 ]
1992, S. 149) angesehen werden. Sie enthalten sowohl eine inhaltliche als auch eine prozedurale Seite:
„Die inhaltliche läßt sich mit der unbedingten Achtung der Menschenwürde, die prozedurale Seite mit der Wahrung demokratischer Spielregeln und der unbedingten Beachtung der Friedenspflicht bei der Austragung auch fundamentaler Konflikte umreißen." (Hufen 1994, S. 1213)
Damit werden Grenzen der autonomen Entfaltung und der Toleranz gegenüber all denjenigen Positionen abgesteckt, die diese Prinzipien nicht respektieren. Dies gilt zum einen für die Angehörigen der Minderheiten. Unvereinbar sind damit z.B. die gewaltsamen Beschneidungen und die damit einhergehenden Körperverletzungen, die schwarzafrikanische Immigranten in Frankreich unter Berufung auf kulturelle Traditionen an jungen Mädchen vorgenommen haben oder noch vornehmen [Fn.138: Ungeheuer (1991) sieht in den Klitoris-Beschneidungen den Tatbestand der vorsätzlichen schweren Körperverletzung erfüllt und spricht in diesem Zusammenhang von einem „Konflikt zwischen kultureller Tradition und Menschenrechtsverletzung". Vgl. dazu auch die von Finkielkraut erhobene Forderung, „daß alle Bräuche, die die Grundrechte der Person verhöhnen - auch die, deren Wurzeln weit in die Geschichte zurückreichen - als ungesetzlich erachtet werden" (Finkielkraut 1989, S. 114).], der Mordaufruf gegen den britischen Schriftsteller indischer Herkunft Salman Rushdie (vgl. dazu ausführlich Baringhorst 1991, S. 329ff.) sowie alle fundamentalistisch orientierten Bestrebungen, die eigene Position mit Hilfe politischer Mittel für die Gesamtgesellschaft verbindlich zu machen und auf diese Weise den offenen und pluralistischen Charakter des politischen Prozesses zu beseitigen.
Die in dem Basiskonsens enthaltenen Regeln und regulativen Ideen beanspruchen aber auch Geltung gegenüber den Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft. Sie verpflichten zum Schutz der Würde der Angehörigen der Minderheitenbevölkerung, insbesondere auch vor rassistischen oder diskriminierenden Angriffen auf deren ethnische, religiöse und kulturelle Identität. Hufen hat dies im Rahmen seiner Überlegungen zur kulturintegrativen Kraft der Verfassung in der folgenden Weise beschrieben:
„Wer einen Menschen angreift, weil er nicht zu einer bestimmten Volksgemeinschaft gehört oder von anderer Herkunft und Rasse ist als die Mehrheit, stellt sich selbst außerhalb der Verfassungsordnung und kann für diese Angriffe auch nicht die Freiheiten in Anspruch nehmen, die das Grundgesetz gewährt. So sehr durch Meinungsfreiheit und andere Grundrechte auch die Auseinandersetzung über Probleme des Asylrechts, über Fragen des Zusammenlebens mit Angehörigen fremder Kulturkreise usw. ermöglicht und geschützt sind, so sehr gerade diese Verfassungsordnung ein offenes Ansprechen von Problemen und möglichen Lösungen gewährleisten will, so deutlich muß doch sein, daß der Angriff auf die Identität der Minderheit selbst, der Appell an dumpfe Überfremdungsängste und das Schüren von Haß gegen den Grundkonsens der Verfassung verstößt. Feindseligkeit gegenüber anderen Menschen und Kulturen wegen deren Andersartigkeit ist Feindseligkeit gegen die Verfassung selbst. Verfassungsfeind in diesem Sinne ist nicht nur der Straftäter und Brandstifter. Verfassungsfeinde sind auch die politischen Brandstifter, die z.B. mit der Rede von der 'durchrassten' Gesellschaft oder der dümmlichen Vereinfachung von Kriminalstatistiken ('multikriminelle Gesellschaft') das Zusammenleben der Kulturen als solches angreifen oder auch 'Verständnis' für Haß und Aggressionen zeigen, bei denen die einzig angemessene Reaktion der deutliche Hinweis auf die Borniertheit solcher Ängste oder der Einsatz des Strafrechts wäre." (Hufen 1994, S. 124)
[Fn.139: Der von Hufen verwendete Begriff des „Verfassungsfeindes" ist allerdings selbst problematisch, da er nicht verfassungsrechtlich verankert ist und großen Spielraum für politische Instrumentalisierungen bietet.]
Auch gegen Gruppen, die die Basis der gegenseitigen Anerkennung der Menschenwürde verlassen, sind nach Hufen die Mittel der abwehrbereiten Demokratie einzusetzen. Das Parteienprivileg schütze dann zwar vor einem Verbot und verbotsähnlichen Maßnahmen durch die Exekutive, gewähre aber kein Recht, öffentliche Medien im Wahl-
[Seite der Druckausg.: 76 ]
kampf zur Verbreitung menschenfeindlicher Pamphlete einzusetzen: „Weder Parteienfreiheit noch Chancengleichheit im Wahlkampf schaffen ein Recht zum öffentlichen Angriff auf die Menschenwürde, der Basis der gesamten Rechtsordnung überhaupt." (Hufen 1994, S. 125f.)
Allerdings sind auch bei Einhaltung dieser Anforderungen Probleme, Konflikte und Kontroversen bei den jeweiligen Konsensbestimmungen und Grenzziehungen nicht ausgeschlossen. Dies ergibt sich zum einen aus der Tatsache, daß die Prinzipien, die den Kern des Basiskonsenses ausmachen (sollen), einen hohen Abstraktionsgrad aufweisen und somit sowohl rechtliche Interpretations- als auch politische Gestaltungsspielräume enthalten.
[Fn.140: Als aktuelle Beispiele können dafür die Kontroversen über das „Kreuz im Klassenzimmer" und über die Frage genannt werden, ob es sich bei Sitzblockaden um eine Form von Gewalt bzw. Nötigung oder um einen Ausdruck der Demonstrationsfreiheit handelt.]
Zudem sind die Grenzen zwischen dem kontroversen und dem nicht-kontroversen Sektor fließend.
[Fn.141: Die „Demarkationslinie" zwischen diesen beiden Sektoren liegt nach Fraenkel nicht ein für allemal fest; sie hat vielmehr dynamischen Charakter, da sie „ständigen Verschiebungen unterworfen (ist), in denen sich jeweils politisch hochbedeutsame Wandlungen des Gemeinschaftsbewußtseins reflektieren" (Fraenkel 1991c, S. 249).]
Dies verweist zum einen auf den labilen und dynamischen Charakter eines derartigen Konsenses, zum anderen auf die Notwendigkeit, demokratische Verfahrensregeln zu schaffen, zu sichern und weiter zu entwickeln, mit deren Hilfe dessen jeweilige Ausgestaltung in öffentlicher und rationaler Weise reflektiert, diskutiert und überprüft werden kann. Schließlich ist auch zu berücksichtigen, daß sich die „Wehrhaftigkeit" der Demokratie gegenüber „extremen" oder „fundamentalistischen" Positionen nicht ausschließlich auf den Einsatz von rechtlichen Mittel reduzieren darf, sondern sich auch und vor allem auf die politische und geistige Ebene beziehen muß und dabei auch die jeweiligen gesellschaftspolitischen Hintergründe, Ursachen und Zusammenhänge reflektiert werden sollten:
„Insgesamt ist es dem demokratischen Verfassungsstaat zu wünschen, daß er die geistige Auseinandersetzung mit fundamentalistischen Positionen sucht und sich zunächst auf die Bekämpfung der zum Fundamentalismus führenden Ursachen der Angst versteht (...) Die Untersuchung hat gezeigt, daß das Instrument des Rechts Mittel zur Bewältigung der Herausforderung des Fundamentalismus, aber auch bewußte Freiräume für fundamentalistische Positionen bereitstellt. Diese sind Ergebnisse eines historischen Fundamentalkonsenses, dessen Grundlage auf Demokratie, Aufklärung, Säkularisation, Toleranz und Pluralismus beruhen und aktueller sind denn je zuvor. Weder das Recht noch der historische Kompromiß allein können aber der fundamentalistischen Herausforderung der Rechtsgemeinschaft begegnen. Letztlich wirksamster Schutz vor den negativen Folgen des Fundamentalismus ist es daher, wenn Verfassung, Gesetze und nicht zuletzt auch die Repräsentanten des Staates dazu beitragen, daß die Ursachen der Angst, daß Entfremdung und Hilflosigkeit gegenüber unübersehbaren Entwicklungen der Macht erst gar nicht entstehen. Die Dezentralität der Herrschaftsausübung, Subsidiarität, Selbstverwaltung, Kontrolle der Verwaltung und Einsehbarkeit der Verwaltungsverfahren erhalten so einen - im besten Sinne - fundamentalen Stellenwert. Dagegen ist es ein Nährboden für fundamentalistische Versuchungen, wenn Politik und Medien, statt zu offener Darstellung von Komplexität und Vielfalt beizutragen, ihrerseits Zuflucht zu den ganz einfachen Erklärungen nehmen." (Hufen 1992, S. 472ff.)
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Januar 2001