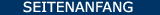![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 152 (Fortsetzung)]
A. Braun: Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren; es sieht ja so aus, als ob sich die Sonne doch ausnahmsweise mal blicken lassen will. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nacht. Wir sind relativ vollzählig und nach dem Motto „es wird sich ja rumsprechen" fangen wir an. Herzlich willkommen Frau Dr. Jani; Sie stellen sich wie üblich in dem Reigen vor, und dann gehen wir in das Thema, nämlich in die Situation in Frankreich.
H. Jani: Auch ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und hoffe mit Herrn Braun, daß die Sonne tatsächlich durchkommt. - Folgendes zu meiner Person: Ich bin seit langem und noch für kurze Zeit Forschungsleiter in einem französischen Zentrum für Sozialgerontologie, welches, abgesehen von der Forschung, in den Bereichen Fortbildung und Information tätig ist; und dafür gibt es eine umfangreiche Fachbibliothek und eine Videothek. Eigentlich müßte ich dies in der Vergangenheitsform sagen, denn aus finanziellen Gründen wird dieses Zentrum wahrscheinlich ab Ende des Jahres nur noch in sehr reduzierter Form bestehen bleiben. Insofern finde ich es nicht mehr so interessant, das Zentrum näher vorzustellen. Ich benutze die Gelegenheit, um schon etwas vorher das Feld zu räumen und nicht nur in den Ruhestand zu gehen, sondern hauptsächlich, um mich selbständig zu machen
Nun zum Thema: Einleitend werde ich einige Grunddaten über Frankreich darstellen, wobei es kaum Zahlen sind, sondern mehr eine Grundübersicht, damit Sie die Zusammenhänge besser verstehen können; leider stimmt immer noch, daß aufgrund der Sprachbarriere Deutschland wenig über Frankreich weiß und Frankreich wenig über Deutschland - jedenfalls auf dem Gebiet der Gerontologie. Danach möchte ich Ihnen unsere vielgelobte „PSD" - die prestation spécifique de dépendance - vorstellen, d.h. die französische Pflegebeihilfe. Anschließend werde ich kurz auf die Reform der bisherigen und die heutige Altenpolitik Frankreichs eingehen, und zum Abschluß würde ich gern etwas zur Qualität und Qualitätssicherung auf dem Gebiet der Sozialgerontologie in Frankreich sagen.
[Seite der Druckausg.: 153]
Grunddaten zur französischen Situation
Es gibt rund 11 Millionen Renten- und Pensionsempfänger; wobei wir diese beiden (deutschen) Kategorien nicht kennen, und ich deshalb nachfolgend auch nur von Rentnern bzw. Renten sprechen werde. 96 % der Altenbevölkerung (65 Jahre und darüber) leben in Privathaushalten, das heißt außerhalb der Institutionen und Heime.
Vorrangig in der Altenpolitik gilt seit den 60er Jahren in Frankreich das sozialpolitische Prinzip des Verbleibens zuhause, auch in hohem Alter. Dieses Prinzip steht europaweit auf den sozialpolitischen Flaggen; wer es jedoch umsetzen soll, steht nicht dabei. Wir wissen aber, daß allgemein die sowohl gesellschaftliche als auch insbesondere politische Erwartung dahinter steht, die Familie solle es kostenlos übernehmen - in Deutschland hat sich die Situation dank der Pflegeversicherung etwas geändert, obwohl diese Erwartung auch in das deutsche Pflegegesetz eingegangen ist. Die skandinavischen Länder bilden eine Ausnahme.
Diese hohen Ansprüche an die Familie im Bereich der Altenhilfe werden sicherlich weiterhin bestehen - und nicht nur in Frankreich, bedenkt man, daß etwa 70 bis 80 % der Hilfe- und Pflegebedürftigen zuhause von der Familie oder anderen informellen Helfern betreut werden; nur in geringem Umfang stehen ihnen Hausdienste zur Verfügung. Aufgrund der Finanzierungsprobleme stehen Haushaltshilfen in Frankreich vorrangig denjenigen zur Verfügung, die alleine und weit entfernt von ihrer Familie leben.
- Die Haushaltshilfe - die aide ménagère - steht in Frankreich als klassischer Hausdienst seit Ende der 50er Jahre an erster Stelle. Dank seiner konzeptionellen Vorrangstellung in allen nationalen Altenplänen seit Ende der 60er Jahre wurde dieser Dienst am stärksten ausgebaut und ist seit Jahrzehnten, wenn nicht bedarfs- so doch immerhin flächendeckend. Etwa 6 % der Altenbevölkerung (65 Jahre und darüber) haben eine Haushaltshilfe, wenn auch meistens nur höchstens 20 Stunden pro Monat, d.h. nicht einmal eine Stunde täglich. Unter den Hochbetagten (80 Jahre und darüber) sind es 13 %. Diese relativ niedrigen Anteile bezeugen nicht nur, daß keine Bedarfsdeckung vorliegt; sie sind auch Zeugen des sich ständig verbessernden, allgemeinen Ge
[Seite der Druckausg.: 154]

-
P>sundheitszustand der alten Menschen. (Darum sterben wir ja auch viel später.) 1996 beliefen sich die öffentlichen Ausgaben für die Haushaltshilfe auf 1,6 Milliarden DM. Sie wird hauptsächlich von der allgemeinen, für alle Arbeitnehmer obligatorischen, staatlichen Alterskasse
[ Sécurité sociale, branche vieillesse.] und in geringerem Umfang von der Sozialhilfe getragen. Die Inanspruchnahme einer Haushaltshilfe impliziert ausnahmslos einkommensgestaffelte Selbstbeteiligung (5 % bis 100 % des gesetzlichen Stundensatzes
[ Etwa 25 DM ist im Herbst 1999 der Stundensatz im Pariser Raum, in anderen Departements liegt er etwas niedriger.]).
- Die häuslichen Kranken- und Pflegedienste stehen an zweiter Stelle; im Gegensatz zur Haushaltshilfe besteht darauf ein rechtlihcer Anspruch. Etwas 1% der Altergruppe 65 und darüber nehmen sie in An-
[Seite der Druckausg.: 155]
spruch. Sie werden ausschließlich von der staatlichen Krankenkasse finanziert [ Sécurité sociale, branche maladie. Wie die Alterskasse ist sie für alle Arbeitnehmer obligatorisch.].
- Es gibt viele weitere Hausdienste, wie z.B. Essen auf Rädern, wobei Frankreich im Gegensatz zu Deutschland diesen Dienst immer eher unterprivilegiert hat, weil man davon ausgeht, Einholen, Vorbereiten und Kochen sollten lieber von und mit der Haushaltshilfe erledigt werden; weil man davon ausgeht, daß es sonst in vielen Fällen zu einer gewissen Faulheit führt, legt man eben auch heute noch Wert darauf, daß die Leute wenigsten zum Einholen, wenn sie es können, oder zum Essen rausgehen, so daß wir also stärker die Mittagstische entwickelt haben. Relativ weit verbreitet sind in Frankreich die Notrufanlagen
[ Es besteht eine steigende Tendenz zugunsten von Systemen, die über die rein technische Anlage hinaus die „soziale Dimension" einschließen. Statistiken der Hausalarm-Anbieter zeigen, dass etwa nur 8 % der Anrufe gravierende Ursachen haben und der Notdienste bedürfen. Die technische Anlage wird auch als Instrument sozialer Integration benutzt.]. - Tageszentren und -kliniken gibt es im Unterschied zu Deutschland verschwindend wenige.
Schließlich möchte ich die Pflegefamilien - accueil familial - anführen, weil es sie in dieser gesetzlich abgesicherten Form in Deutschland nicht gibt: Accueil familial basiert auf einem Vertrag zwischen dem alten Menschen und der Pflegeperson (die kein Verwandter sein darf), darin steht wieviel Geld die Familie bekommt. Es wird jeweils auf der Departementsebene festgelegt, wieviel diese Person bekommen kann; das ist normalerweise der garantierte Mindestlohn. Dieser Vertrag muß jährlich erneuert werden. Privatpersonen nehmen ein bis zwei alte Menschen (mit Sondergenehmigung drei) gegen Bezahlung zu sich und betreuen sie. Dem Conseil général, der politischen Entscheidungsinstanz auf Departementebene, obliegt die Aufsichtspflicht.
- Was den Heimsektor betrifft, haben wir insgesamt gut 650 000 Betten, inklusive der Wohnheime und der sogenannten Kleinsteinheiten.
[Seite der Druckausg.: 156]
Letztere unterschieden uns schon lange von Deutschland: sie entstehen dort erst neuerdings, in Frankreich gab es die ersten Mini-Heime Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Etwa 12 Personen leben in einer familienähnlichen Gemeinschaft mit professioneller Betreuung; es können gesonderte Heimabteilungen oder autonome Strukturen sein. Tendenziell sind es eher spezifische Einrichtungen für Altersdemente. Die evangelische Fachhochschule Freiburg, das KDA und Pflegen & Wohnen in Hamburg setzen sich zunehmend für dieses französische Modell des cantou ein. Für Frankreich, sagen Sie vielleicht, nicht erstaunlich: hier geht es um den Tisch im weitesten Sinne, das heißt ums Essen, Kochen, Gemüseputzen, Tischdecken, Geschirrspülen etc. , wobei dahinter mehr als die französische Freude am Essen steht; es wird davon ausgegangen, daß die Befriedigung des elementaren Bedürfnisses sich zu ernähren mit Gruppenaktivität verbunden, dem Leben Sinn geben kann, denn man tut es für sich selbst und für die Mitbewohner. Hinzu kommt, daß diejenigen, die das geschaffen haben, davon ausgegangen sind, daß es hauptsächlich Frauen sind, die dort leben und daß die hausfraulichen Grund-Tätigkeiten den Dementen am langsamsten verloren gehen.
Zu den Hilfe- und Pflegebedürftigen kurz eine Angabe. In Frankreich wurde kürzlich endlich die erste große Repräsentativerhebung durchgeführt (als Sonderteil der letzten Volkszählung, im Frühjahr 1999); augenblicklich laufen die ersten Ergebnisse ein. Demnach leben 74 % sämtlicher Heimbewohner (inkl. Kinderheime etc.) in altersspezifischen Einrichtungen, und daraus ergibt sich, daß die Heimbewohner zu 74 % mindestens 60 Jahre alt sind; 12 % sind behinderte Erwachsene, 10 % sind in der Psychiatrie untergebracht, 7 % sind behinderte Kinder. Bezüglich der altersspezifischen Heime war es zumindest für die Gerontologen kaum überraschend [ Aus den vorangehenden Volkszählungen war bereits manches hinsichtlich der Heimbewohner- und der Heimtypenstruktur bekannt. Das war nicht der Fall für die Behinderten und auch nicht für die Langzeitpatienten der Psychiatrie, sodaß man dort nun auch mehr wissen wird.].
[Seite der Druckausg.: 157]
Die PSD oder die französische Pflegebeihilfe
Das Gesetz ist im Januar 1997 in Kraft getreten, d.h. es findet seit nunmehr gut zwei Jahren Anwendung. Mir ist es besonders in Deutschland ein Anliegen, die französische Pflegebeihilfe vorzustellen, weil ich viel Kritik über die deutsche Pflegeversicherung höre und lese, die auch sicherlich berechtigt ist. Aber ich habe dabei auch immer das Empfinden, man sei sich in Deutschland - vielleicht infolge der reichhaltigen Kritik - wenig ihres hohen Niveaus bewußt. Das der französischen Pflegebeihilfe liegt weitaus niedriger und meine nachfolgenden Ausführungen werden Ihnen eine andere Vergleichsbasis geben (auch wenn Referenzen bevorzugt nicht unten, sondern oben liegen sollen).
- Der monatliche Höchstbetrag beläuft sich auf etwa 1.284 DM (4.300 FF) - es geht hier also um ganz andere Summen als bei der deutschen Pflegeversicherung. Laut der ersten Bilanz liegt der effektive Durchschnittsbetrag unter 1000 DM pro Monat, und er ist niedriger als der der bisherigen allocation compensatrice, eine Beihilfe, die durch die PSD abgelöst wurde. Die maximale Leistungshöhe, wie allgemein sämtliche Regelungen des Gesetzes, gilt auf nationaler Ebene (im Gegensatz zur abgelösten allocation compensatrice, die ausschließlich auf der Departementebene festgelegt wurde und damit von den finanziellen Disponibilitäten der Departements abhängig war). Insofern beinhaltet die PSD mehr soziale Gerechtigkeit.
- Grundsätzlich ist die PSD eine Sachleistung, jedoch kann sie ausnahmsweise als Geldleistung bezogen werden, sofern ein Angehöriger (oder ein anderer Nahestehender) die Betreuungs- bzw. Pflegeperson ist; darüber wollte der Gesetzgeber die Garantie verankern, daß die Gelder auch tatsächlich für die Hilfen verwendet werden, auch wenn damit für den alten Menschen geringere Wahlfreiheit verbunden ist.
- Die Beurteilung des Hilfebedarfs und die Einstufung werden anhand eines Rasters - der grille AGIRR
[Autonomie gérontologique - Groupes iso-ressources.] , die sich in einer experimentellen Phase bewährt hatte - vom sozialen Dienst festgestellt; theoretisch
[Seite der Druckausg.: 158]
einem Team von mindestens zwei Personen, die jeweils die medizinische und die soziale Seite vertreten; inwieweit das tatsächlich eingehalten wird, ist fraglich. Dasselbe gilt (mindestens für das erste Jahr nach der Einführung) hinsichtlich der Kompetenzen des Teams. Das Personal wurde zwar dafür geschult, aber die Zeit dafür war zu kurz und die Schulungskurse waren vielfach unzulänglich. Allgemein fehlte es aufgrund politischer Dringlichkeit aber an guter Vorbereitung: Der PSD war die PED vorausgegangen, eine experimentelle, während eines Jahres in 12 Departements angewendete Pflegebeihilfe. Diese war insgesamt großzügiger und die damit verbundenen Messungen des Zufriedenheitsgrades der Empfänger waren eher positiv. Bevor jedoch diese Ergebnisse ausgewertet waren, und ohne daß es je zu einer öffentlichen Debatte kam, wurde in den Sommermonaten schnell ein Gesetzentwurf erarbeitet, vorgelegt und im Herbst verabschiedet, wobei offensichtlich nur wenige Parlamentarier gute Kenntnisse darüber hatten, worum es ging und sich insbesondere nicht der Tragweite des Gesetzes bewußt waren. Die Auswirkungen der politischen Überraschungseffekte bekamen dann die sozialen Dienste als erste zu spüren. Der seitdem eingetretene Regierungswechsel brachte Klarheit und Zweifel; Martine Aubry, die Sozialministerin, beabsichtigt, 2000 eine Reform der PSD durchzuführen.
Im Gegensatz zur deutschen Pflegeversicherung gibt es also keinen Fragebogen, der vom Antragsteller (bzw. dem pflegenden Angehörigen) auszufüllen ist: der soziale Dienst befragt den Antragsteller in seiner Wohnung, bevorzugt in Gegenwart der informellen Hauptpflegeperson, und füllt das Raster den Antworten entsprechend aus. Auf der Basis der Ergebnisse wird nach der Einstufung der obligatorische Hilfsplan (gesetzlich innerhalb von zwei Monaten) erstellt und damit auch das entsprechende Geldvolumen festgelegt.
A. Braun: Wir haben das ja mal verglichen mit der Einstufung nach dem deutschen Pflege-Versicherungs-Gesetz und konnten feststellen, das diese grille AGIRR weniger medizinisch-krankenpflegerisch ausgerichtet ist, sondern sich stärker an Lebenssituationen orientiert wie z.B. der verbliebenen Mobilität, dem Grad der sozialen Integration etc.
[Seite der Druckausg.: 159]
H. Jani: Ja, sie geht weitaus mehr in die österreichische Richtung, von der wir gestern hörten, daß die Finalität, also das Ziel, nicht der Grund ausschlaggebend ist. Die grille AGIRR interessiert sich nicht für die medizinischen Aspekte und Gründe, sondern dafür, ob der Antragsteller bestimmte lebensnotwendige Tätigkeiten alleine erledigen kann oder nicht. Um das festzustellen, ist kein Arzt notwendig: entweder kann man etwas oder man kann es nicht mehr, und wenn man es nicht mehr kann, dann braucht man Hilfe.
Mittels des Rasters wird für zahlreiche Bereiche des täglichen Lebens [ Körperhygiene, Be- und Entkleiden, Toilettengang, Kommunikations- und Orientierungskapazitäten, Kochen, Essen, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Freizeitbeschäftigungen, Gehen in/außerhalb der Wohnung, Verwalten von Geld oder Zeit etc.] zum einen der Grad der Selbständigkeit festgestellt, mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten (der jeweilige Akt wird: alleine, gänzlich, gewöhnlich und richtig - teilweise - nicht durchgeführt) und zum anderen die bestehenden Hilfen (für den jeweiligen Akt wird benötigt: keinerlei - teilweise - totale Hilfe). Aus diesen Daten erfolgt die Kategorisierung in sechs Pflegestufen (GIR I bis GIR VI); auch wie in Deutschland setzt selbst die niedrigste Stufe einen hohen Grad der Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit voraus.
Auch die Zugangskriterien weisen wesentliche Unterschiede im Vergleich zur deutschen Pflegeversicherung auf: Da es sich um eine Beihilfe statt um eine Versicherungsleistung handelt, ist der Zugang - jedoch nicht die Leistungshöhe - einkommensabhängig: das monatliche Grenzeinkommen beträgt für Einzelpersonen etwa 2.300 DM (7.700 FF)
[ Gegenüber etwa DM 2.800 (9.329 FF) in der experimentellen Phase.] und knapp 2.600 DM (8.600 FF) für Ehepaare
[ Die Einkommensgrenze für Ehepaare gilt auch dann, wenn nur einer von beiden Antragsteller ist.].
Da es sich um Altenpolitik handelt, ist die Beihilfe altersabhängig: der Empfänger muß das 60. Lebensjahr erreicht haben. Und da diese Beihilfe bewußt der Sozialhilfe unterstellt wurde, unterliegen die Leistungen der Rückzahlungspflicht. Sie kennen die Problematik aus der deutschen Debatte, denn Deutschland und Frankreich gehören in der EU zu den wenigen Ländern, die die gesetzliche
[Seite der Druckausg.: 160]
Unterhaltspflicht kennen, welche die einkommensschwachen älteren Menschen häufig darin hindert, in irgendeiner Form, die Sozialhilfe zu beanspruchen. Die Rückzahlungspflicht gilt für alle Erben inkl. Ehepartner und direkte Abkommen. Im Falle der PSD ist der Zugriff der Sozialhilfe auf die Familie allerdings dahingehend eingeschränkt, daß die Rückzahlungen erstens auf den Erbnachlaß des PSD-Empfängers und zweitens auf eine bestimmte Summe des Erbes begrenzt sind, und zwar sofern die Erbmasse mehr als etwa 90.000 DM (300.000 FF) [Gegenüber etwa 75.000 DM (250.000 FF) in der experimentellen Phase.] beträgt. Lebte jedoch der PSD-Empfänger in einem Heim, können die Erben diese Klausel nicht geltend machen: für sie besteht die Rückzahlungspflicht ab dem ersten geerbten Franc. Die Rückzahlungspflicht gab es in der experimentellen Phase nicht. Im Gegensatz zur damaligen öffentlichen Diskussion um das Pflegegesetz in Deutschland wird die Anbindung an die Sozialhilfe und die damit verbundene Rückzahlungspflicht erstaunlicherweise von der französischen Öffentlichkeit recht wenig kritisiert; kritisiert wird sie hauptsächlich in gerontologischen Fachkreisen - und allerdings zunehmend auch in den Reihen der Politik. Es ist aber fraglich, ob Mme Aubry trotz ihrer Kritik im Rahmen ihrer angesagten PSD-Reform die Beihilfe von der Sozialhilfe abkoppeln wird - wohl insbesondere, weil dann die grundsätzliche Debatte geführt werden müßte, das Pflegerisiko wie in Deutschland als zusätzliche Säule in das soziale System aufzunehmen.
Hinsichtlich der Rückzahlungspflicht muß allerdings auch festgehalten werden, daß sie nicht ganz so dramatisch ist, wie es sich zunächst anhört; aufgrund der relativ niedrigen Einkommenshöchstgrenze gehören die Bezieher der PSD zur Schicht der einkommensschwachen Rentner, sodaß die Wahrscheinlichkeit großer zu vererbender Vermögen relativ klein ist. Das Drama liegt woanders, nämlich in der Einkommenshöchstgrenze.
Anzahl und Profil der PSD-Empfänger. Laut vorliegender erster Bilanz gab es am 30. Juni diesen Jahres 106 000 Empfänger [Das entspricht 71 % der gestellten Anträge.] , was wirklich sehr wenig ist. Sie verteilen sich zu gleichen Teilen auf die Heimbewohner und die in Privathaushalten Lebenden. Circa 90 sind mindestens 75 Jahre alt.
[Seite der Druckausg.: 161]
Bezogen auf die Altersgruppe 75 Jahre und darüber variiert der Anteil der Empfänger je nach Departement zwischen 0,6 und 6 . Es ist also sehr, sehr wenig. Und das ist natürlich auch gewollt. Selbstverständlich handelt es sich hauptsächlich um Frauen (80 ); denn nicht nur ohnehin mehrheitlich in dieser Altersgruppe sind Frauen im Alter auch früher und zahlreicher pflegeabhängig als Männer, und sie haben niedrigere Einkommen. Die Aufteilung nach der Einstufung - nachfolgend in der Tabelle in drei Pflegestufen zusammengefaßt - zeigt, daß der Anteil der Stufe mit höchstem Bedarf in Heimen annähernd um das Dreifache höher liegt als unter den Empfängern in Privathaushalten, und umgekehrt dort der Anteil der Kategorie der geringsten Bedürfnisse knapp doppelt so hoch ist. Die mittlere Stufe ist in etwa zu gleichen Teilen vertreten
PSD-Empfänger nach Pflegestufen zum 30.6.1999; in %
|
Stufe |
zuhause |
im Heim |
insgesamt |
|
höchste |
8 |
22 |
15 |
|
mittlere |
44 |
51 |
47 |
|
niedrige |
48 |
27 |
38 |
|
Total |
100 |
100 |
100 |
[Quelle: DREES, Catherine Borrel, 1999, S.3, Tabelle 02]
Die monatlichen Durchschnittsbeträge, die für die Hilfen im Rahmen der PSD gezahlt wurden - auch das ist interessant im Vergleich zu Deutschland - sind folgende: etwa 1200 Mark für die höchste Pflegestufe, etwa 1000 DM für die mittlere und etwa 900 DM für die niedrigste. Interessant ist, daß bei den großen gesundheitlichen Unterschieden von einer Stufe zur anderen die finanziellen Unterschiede relativ gering sind. Diese Beträge decken nicht die effektiven Kosten, ebenso wie sie nicht den effektiven Hilfebedarf decken.
Etwas anderes Interessantes läßt sich aus den Statistiken ablesen, nämlich daß die Männer unter den PSD-Empfängern im Vergleich zu den Frauen recht jung sind: Unter den Zuhause-Lebenden sind 28 der Männer keine
[Seite der Druckausg.: 162]
75 Jahre alt, während es unter den Frauen nur 15 sind (jeweils 18 und 6 in Heimen); der Ausgleich läuft ausschließlich über die Hochaltrigen: nur gut ein Drittel der Männer, jedoch gut die Hälfte der Frauen sind mindestens 85 Jahre alt. Mit anderen Worten zeigen diese Zahlen, daß unter den männlichen PSD-Empfängern, die zuhause leben, keine Altersabhängigkeit besteht, während für die weiblichen die herkömmliche Tatsache gilt, daß mit steigendem Alter auch die Anteile steigen, herkömmlich, weil Hilfe- und Pflegebedürftigkeit mit dem Alter steigen und weil - das ist das Drama der Altenhilfe - gerade Frauen länger leben als Männer, aber bei schlechterer Gesundheit sind. Steht hinter diesen Zahlen, daß Frauen erst bei hoher Hilfs- und Pflegebedürftigkeit - und infolgedessen erst in hohem Alter - auf die Beihilfe zurückgreifen, u.a. weil sie sensibler auf die Rückzahlungspflicht reagieren?
PSD-Empfänger nach Wohnsituation, Alter und Geschlecht, 30.6.1999;
in %
|
60 – 74 Jahre |
75 – 84 Jahre |
³ 85 Jahre |
Total |
|
|
Zuhause-Lebende | ||||
|
Männer |
28 |
36 |
36 |
100 |
|
Frauen |
15 |
32 |
53 |
100 |
|
insgesamt |
18 |
33 |
49 |
100 |
|
Heimbewohner | ||||
|
Männer |
18 |
32 |
50 |
100 |
|
Frauen |
6 |
23 |
71 |
100 |
|
insgesamt |
8 |
24 |
68 |
100 |
|
Beide Bereiche | ||||
|
Männer |
18 |
35 |
41 |
100 |
|
Frauen |
10 |
28 |
62 |
100 |
|
insgesamt |
13 |
29 |
58 |
100 |
[Quelle: DREES, Catherine Borrel, 1999, S.3, Tabelle 04]
[Seite der Druckausg.: 163]
Reform der Altenpolitik
Sie wissen, daß Frankreich 1982/1983 die sogenannte Regionalisierung (oder Dezentralisierung) einführte, welche die politischen Kompetenzen insbesondere auf dem Gebiet der Sozialpolitik von der Zentralregierung auf die Departements übertragen hat. Infolgedessen hat die Zentralregierung auch auf die Altenpolitik relativ wenig Einfluß. Sie hat sie natürlich über die Gesetzgebung, und sie kann auch weiterhin (z.B. über die Finanzierung) starke Orientierungsimpulse geben. U.a. infolge der Kritik an der PSD seitens der Sozialministerin Martine Aubry sucht die Regierung eine Neuorientierung der Altenpolitik hinsichtlich der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. In diesem Rahmen beauftragte Lionel Jospin, Premierminister, Paulette Guinchard-Kunstler, Abgeordnete des Doubs [Departement in Ostfrankreich, an der Schweizer Grenze.], mit einer Expertise über die heutige Situation der französischen Altenpolitik. Ihr vor einigen Monaten veröffentlichter Bericht ist eine objektive, harte Kritik an der heutigen Situation; er beginnt mit der Feststellung, entgegen den Aussagen der politischen Entscheidungsinstanzen haben Altenpflege und -betreuung nie Priorität gehabt. So berechtigt diese Feststellung auch sein mag, wirft sie dennoch die grundsätzliche Frage auf, ob staatliche Altenpolitik in einem Land, in dem die Altenbevölkerung keine unterprivilegierte Gruppe mehr darstellt, überhaupt Priorität haben soll. Tatsache ist, daß die „relative Priorität", die Frankreich seiner Altenpolitik seit Anfang der 60er und bis über die 80er Jahre hinaus eingeräumt hat, nicht mehr besteht. Das ist politisch gesehen vielleicht auch nicht falsch, weil es inzwischen neue Gruppen von sozial Schlechtergestellten gibt, z.B. Jugendliche oder ältere Langzeitarbeitslose, die als Gruppe ein weitaus höheres Risiko laufen als die älteren Menschen, die im Laufe der letzten 30 Jahre viele Rechte erhielten, die global gesehen relativ gut dastehen. Und man sollte nicht vergessen, daß die Alten- bzw. Rentnerbevölkerung heute die einzige soziale Gruppe mit sicherem Einkommen ist, denn sie ist nicht mehr den Risiken des heutigen Arbeitsmarktes ausgesetzt.
Mme Guinchard-Kunstler stellt in ihrer Expertise 43 Änderungsvorschläge vor. An erster Stelle steht der Abbau der Vielzahl der Instanzen in der Altersdomäne und der Vielzahl der Finanzierer. Nicht nur Deutschland hat
[Seite der Druckausg.: 164]
einen riesigen, schwerfälligen Verwaltungsaufbau; in Frankreich spiegelt sich das insbesondere auf dem Gebiet der Finanzierung wider. Ziel ist, eine gerechtere und eine solidarischere Altenhilfe und –pflege aufzubauen. In diesen Bereich gehört auch der Vorschlag der Harmonisierung der Heimtarife. Ein weiterer Vorschlag betrifft die Hausdienste: sie sollen komplementärer und koordinierter zusammenarbeiten, zugunsten einer individualisierten, globalen Altenhilfe, deren Mittelpunkt tatsächlich der alte Mensch und sein Hilfe- und Pflegebedarf bilden soll. Außerdem sollen Qualitätsansprüche im Vordergrund stehen. Hier sind die nicht-professionellen Pflegepersonen gemeint, um der Tendenz entgegen zu wirken, die sozialgerontologisch ausgebildeten Haushaltshilfen durch Personen aus dem Arbeitslosenreservoir zu ersetzen (diese Tendenz spiegelt das Übergreifen nicht-gerontologischer Sichtweise wider, d.h. es ist Arbeitsmarkt- und Kostendämpfungspolitik). In diesen Bereich gehört auch der Vorschlag, die Supervision des Personals zu forcieren. Was den Heimbereich anbetrifft, gehen Mme Guinchard-Kunstlers Wünsche und Vorschläge insbesondere in Richtung einer adäquaten Betreuung der Altersdementen; das betrifft die Architektur, die Finanzierung, die Vermehrung kleiner Betreuungseinheiten.
Im Hintergrund der 43 Vorschläge steht allgegenwärtig die Reform der PSD; der Regierungswunsch - wenigstens seitens der Sozialministerin - war, sich der deutschen Pflegeversicherung zu nähern, wobei man jedoch heute absolut nicht mehr bereit ist, sie zur fünften Versicherungssäule umzuformen: die PSD soll in der Sozialhilfe verankert bleiben. Hingegen soll die Einkommensgrenze abgeschafft werden, eine eindeutige Verbesserung in Richtung größerer sozialer Gerechtigkeit. Es gibt eine Reihe von Gremien und weiteren Gutachten, die sich für eine stärkere Anlehnung an die deutsche Pflegeversicherung einsetzen und insbesondere fordern, das Pflegerisiko als fünfte Säule in das Sozialsystem aufzunehmen, um es versicherungsrechtlich abzusichern, d.h. von der Sozialhilfe zu trennen. Zu den augenblicklichen Problemen gehört meines Erachtens, daß anscheinend die Finanzierungsdebatte noch nicht begonnen hat; laut wird nur hie und da die Befürchtung, die Franzosen würden wieder massiv auf die Straße gehen sowie die Sozialabgaben erneut erhöht werden.
[Seite der Druckausg.: 165]
Qualität und Qualitätssicherung
Die Problematik der Qualität - der Lebensqualität - in Heimen beunruhigt zunehmend Politiker und Öffentlichkeit, d.h. die Forderungen und Ideen hinsichtlich Lebensqualität sind dabei, den Elfenbeinturm der „wissenden Gerontologen" und der Theorien zu verlassen. Dafür gibt es viele Gründe; hier die vier, die mir am wichtigsten erscheinen:
- Die jüngeren Alten werden allmählich sehr viel fordernder, insbesondere was die Heimqualität anbetrifft.
- Es gibt den sogen. Schoepflin-Bericht, der Anfang der 90er Jahre von der Planungsinstanz der Regierung erstellt wurde [ Le Plan ist die Regierungsinstanz, die die Fünfjahrespläne der Sozialpolitik erstellt. Dafür werden Fachberichte erarbeitet, der hier zitierte Bericht wurde unter der Leitung von P. Schoepflin erarbeitet. ] und zahlreiche Qualitätskriterien beschreibt, die weit über die materiellen oder architektonischen Aspekte hinausgehen.
- Der Ab- bzw. Umbau der letzten hospices - ich denke der Ausdruck „Armenhäuser" kommt der Realität am nächsten, diese haben also nichts mit der Hospizbewegung, der Sterbebegleitung zu tun, mit den Hospizen, die Sie gestern im Film gesehen haben - der gesetzlich bis Ende 1975 hätte abgeschlossen sein müssen. Diese Institutionen mussten alle aufnehmen - das entsprechende Gesetz stammt von Napoleon - alle, die auf der Straße liegen: Alte, Invaliden, Geisteskranke, Alkoholiker, Bettler usw., und alle waren früher unterschiedslos zusammen in Schlafsälen untergebracht, und es herrschten kasernenmäßige Reglementierungen.
- Im Rahmen dieser Reform ist sehr viel Positives auf dem Gebiet der Heimqualität geschehen, weil der Staat sich z.B. über Ausschreibungen und Architektenwettbewerbe sehr stark dafür eingesetzt hatte (die hospices sind ausschließlich staatliche Heime) und daraus sind sehr gute, sehr interessante und innovative Lösungen hervorgegangen.
[Seite der Druckausg.: 166]
- Der private, nicht-kommerzielle Heimsektor bemüht sich seit mehreren Jahren um Qualitätsverbesserung. Das liegt u.a. darin begründet, daß nur sehr gute Heime heute noch Wartelisten kennen und viele Heimbetten inzwischen leer stehen. Der private und der staatliche Heimsektor sind außerdem zunehmend auf der Suche nach Lösungen, die ihren an Demenz erkrankten Bewohnern Lebensqualität bieten.
Es liegen Messinstrumente vor, hauptsächlich aus dem Ausland; auch französische Fachleute haben welche geschaffen, von denen einige auch für das Heimpersonal leicht anzuwenden sind, teilweise in Form von Computerprogrammen. Eines der Probleme ist, daß viele weder über Messinstrumente noch a fortiori über entsprechende Computerprogramme informiert sind. Man kann sagen, daß die Sorge, Qualität zu bieten, zwar sehr verbreitet ist, der Erfolg auf diesem Gebiet aber noch eher recht bescheiden ist - z.B. weil Heimleiter zu isolierter Arbeit tendieren, sie kaum Zugriff zur Fachliteratur haben und unter mangelndem Erfahrungsaustausch leiden. Gelegentlich einer Studie, die wir kürzlich im Pariser Raum über Qualität und Qualitätssicherung in Heimen durchgeführt haben, sagten uns verschiedene Heimleiter, sie wüßten zwar, daß es in der Nähe ein Heim gäbe, das seinem auch ähnlich sei und gut sein solle, aber er kenne nicht einmal den Namen des Leiters. Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß Sorge und Bemühungen um Qualität allgemein in der Altenhilfe allgegenwärtig sind, das Messen von Qualität und Qualitätssicherung hingegen nur in Ausnahmefällen gelingt. Das gilt für alle drei Bereiche, für die Familienbetreuung und –pflege ebenso wie für die stationäre und die ambulante.
Abschließend möchte ich kurz auf eine Studie eingehen, die wir vor 10 Tagen abgeschlossen haben und deren Schwerpunkt außerhalb der Gerontologie liegt. Es ist eine europäische Untersuchung, die in allen EU-Ländern über die öffentlichen sozialen Dienste durchgeführt wurde und folgende drei Zielgruppen hatte: alte abhängige, zuhause allein lebende Menschen, jugendliche Langzeitarbeitslose und geistig behinderte Erwachsene. Wenn ich diese Arbeit hier erwähne, dann, weil die nach verschiedenen Kriterien - Koordination, Arbeitsbedingungen, Qualitätssicherung, user empowerment etc. - analysierten Fallbespiele interessante Unterschiede zwischen denen aus dem gerontologischen Sektor und aus den
[Seite der Druckausg.: 167]
beiden anderen zeigen. Das heißt es ging letztlich bei dieser Ausrichtung, nach der wir die Fallbeispiele auszusuchen hatten, um moderne Unternehmungsführung auf dem sozialen Sektor. Und wenn ich kurz darüber sprechen möchte, dann weil es für mich stark auffallend ist, wie mindestens in Frankreich - die Ergebnisse der anderen Ländern kenne ich noch nicht - wie wenig dynamisch der Altensektor im Vergleich zu den beiden anderen Gebieten ist. Das liegt zum Teil sicherlich daran, daß der Altensektor von den drei untersuchten der älteste ist und zwar sehr dynamische Phasen gekannt hat, allmählich aber in etablierten, bewährten Schemata stecken blieb. Dieser „Nicht-Dynamik" steht starke Dynamik der beiden anderen Sektoren gegenüber. Am auffallendsten ist das hinsichtlich des user-empowerment, hinsichtlich der Zentralposition des „individuellen Projektes" der Betroffenen, um ihre Probleme zu lösen, und hinsichtlich der Selbstbestimmung. Während hier die Betroffenen zu aktiver Teilhabe angehalten werden (das „individuelle Projekt" bedingt einen schriftlichen Vertrag, den der jugendliche Arbeitslose oder der erwachsene geistig Behinderte unterschreibt und bedingt hohe Leistungsanforderungen), besteht auf dem gerontologischen Sektor im Gegenteil die Tendenz zur Entmündigung der Hilfe- und Pflegeabhängigen, und werden derartige Anforderungen nur in Ausnahmefällen gestellt. Meines Erachtens - und damit schließe ich ab - leidet die Altershilfe an der schweren Krankheit, die der britische Gerontologe Prof. Alan Walker als die message of dependency bezeichnet. Ihr Gegenstück, die message of autonomy ist nicht im Spiel. Das heißt, das Helfersyndrom wird unter allen Helfern, ob es professionelle sind oder nicht, hochgeschraubt. Und der andere ist dann das Objekt, das alles empfangen soll und muß, aber geben, davon wird ausgegangen, kann er nicht, dazu ist er absolut unfähig. Wie mir einmal ein junger Blinder, Herr Schäfer, den vielleicht einige von Ihnen aus der sozialgerontologischen Szene kennen und der als Jugendlicher erblindete, sagte, was ihn damals sehr schockiert habe sei, daß seine gesamte Umwelt davon ausging, daß, weil er nun definitiv nicht mehr sehen konnte, er auch nicht einmal mehr fähig war zu entscheiden, ob er heute Mittag Kartoffelsuppe oder Nudeln essen wollte. Und das ist genau das, was die Altenhilfe mit den Alten macht. Sie haben, davon geht man aus - und das ist die message of dependancy - sie könnten nichts mehr entscheiden. Aber wenn ich bettlägerig bin oder wenn ich eine gebrochene Hüfte habe oder gebrechlich bin, kann ich doch sehr wohl über mich entscheiden;
[Seite der Druckausg.: 168]
kann ich noch sehr viel machen, noch sehr viel geben - insbesondere meiner Umwelt und insbesondere meiner Tochter, die mich mehr oder weniger ungern pflegt.
Ich danke Ihnen.
A. Braun: Liebe Frau Jani, wir bedanken uns bei Ihnen für die kompakte Darstellung der Situation in Frankreich. Wir werden dann nach einer kurzen Pause von fünf Minuten zu Nachfragen und zur Diskussion mit Ihnen übergehen.
Renate Klingelhöfer: Klingelhöfer, SPD60+ im Vorstand und im Beirat Hessen Süd. Ich habe mal eine Frage an Sie und zwar betrifft das die Haushaltshilfen. Welche Ausbildung müssen diese Personen haben, wo ist diese Ausbildung angesiedelt und wo stehen diese Personen zur Verfügung? Und jetzt zu dem, was Sie als Letztes gesagt haben, die geistig behinderten alten Menschen: Zum Unterschreiben, sind die dazu in der Lage oder müssen das der Betreuer oder so ein Betreuungsverein machen, der diese Betreuer auch unter seine Fittiche nimmt? Ist das bei Ihnen auch? Danke.
H. Jani: Ja, vielleicht darf ich vor der nächsten Frage etwas gleich korrigieren: es geht nicht um geistig behinderte alte Menschen, sondern um erwachsene geistig Behinderte. Sie sind lt. der gesetzlichen Definition meines Wissens zwischen 20 und 60 Jahre alt; danach gehören sie verwaltungsmäßig dem Altenbereich an.
U. Francke: Ich habe noch eine Frage zu den Cantous. Habe ich es richtig verstanden, sind das Wohngemeinschaften? Wie groß sind die in etwa und wie werden sie finanziert? Danke.
H. Jani: Zur Ausbildung der Haushaltshilfen: Sie findet bei gleichzeitiger Berufsausübung statt, d.h. es ist keine Ausbildung wie die zum Altenpfleger z.B., keine Grundausbildung bevor man den Beruf antritt. Die ungelernten aide ména-gères werden von dem Verein oder dem kommunalen Sozialdienst, in dem sie arbeiten, zur Ausbildung geschickt, die in mehreren Blöcken über eine größere Zeitspanne verteilt erfolgt. Inhaltlich ist sie auf das Erwerben sozialgerontologischer Kenntnissen ausgerichtet und
[Seite der Druckausg.: 169]
nicht dafür bestimmt zu lernen, wie man z.B. kocht oder Fenster putzt. Nach der Ausbildung erhält der Absolvent ein Zertifikat als ausgebildete Alten-Haushalthilfe, was aber keine Auswirkungen auf das Gehalt hat. Es gibt zunehmend Vereine der Hausdienste, die dieses Zertifikat für eine Einstellung zur Vorbedingung machen, weil sie auf berufliche Qualität ihrer Leistungen bedacht sind. „Wo stehen diese Personen zur Verfügung?" Auf dem Arbeitsmarkt; Angebot und Nachfrage werden wie bei anderen Stellen z.B. über Annoncen geregelt. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Gut.
Die geistig behinderten Erwachsenen. Natürlich können sie unterschreiben; das ist eine Aufgabe der Erziehung oder der Hilfen. Bei den erzieherischen Hilfen steht immer das Erlangen größtmöglicher Autonomie im Vordergrund. Wenn sie auch keine Uhrzeit lesen können, weder lesen noch schreiben und vieles nicht lernen können, sie müssen selbständiger werden. Und zu dieser Entwicklung, in die sie geführt werden, gehört, daß sie eines Tages diesen Vertrag unterschreiben können. Und wenn sie nur ein Kreuzchen machen, darum geht es nicht; es geht darum, daß sie selber für sich bürgen müssen. Und der Effekt ist, daß diese Menschen sich dann sagen „Mein Gott, habe ich Fortschritte gemacht! Man hält mich für fähig, heute so einen Plan aufzustellen und zu unterschreiben!" Dadurch werden sie stark motiviert durchzuhalten. Und diese Dynamik, die fehlt dem Altensektor.
Cantou. Im sogenannten Ur-Cantou, d.h. der Form, die ab 1975 in einem Altenheim in Rueil-Malmaison (in der Nähe von Paris) erdacht, angewandt und seitdem weiter entwickelt wurde, leben zwölf Personen pro Cantou zusammen. Daß es zwölf sein sollten, hat die langjährige Erfahrung gezeigt. Diese Anzahl ist in Deutschland bestritten, und zwar insbesondere, weil die Betreuung von ein bis zwei Hausfrauen getragen wird und lt. deutscher Überlegungen dafür eine Zwölfergruppe zu groß ist. In Rueil verfügt heute jeder Cantou über 2,5 Hausfrauenstellen innerhalb 24 Stunden. Zu bestimmten Zeiten, wie z.B. beim Aufstehen und der Morgentoilette, sind sie zu zweit. Georges Caussanel, der Erfinder und Gründer dieser Lebensform für Altersdemente, geht davon aus, daß der Cantou dafür da ist, das zu tun, wozu die Familie nicht (mehr) in der Lage ist, z.B. weil sie „ausgebrannt" ist, und das bedeutet als erstes, daß der bisher oder po-
[Seite der Druckausg.: 170]
tentiell zu pflegende Angehörige nicht mehr mit ihnen zusammenlebt. Aber sie werden mehr als herzlich dazu eingeladen, immer zu kommen und an allem teilzunehmen. Ursprünglich war es so, daß sie sich für eine bestimmte Stundenzahl pro Woche zu ehrenamtlicher Arbeit verpflichten mußten; Zeiten und Tätigkeiten konnten sie selbst bestimmen. Heute sind die Verpflichtungen auf die Teilnahme an den monatlichen Sitzungen beschränkt, in denen sämtliche den Cantou betreffende Entscheidungen gefällt werden - d.h. die Familie ist ausschlaggebende Entscheidungsinstanz.
Die Arbeit wird heute hauptsächlich vom Personal erledigt. Der Familie wird die Arbeit mit dem kranken Angehörigen abgenommen, nicht aber die Verantwortung für ihn. Die aktive Familienbeteiligung - wie auch die Integration der Familie - wird über das Mitverantwortungs- und das Entscheidungskonzept gelöst und erreicht. Insofern ist der Cantou ein echtes Gegenmodell zum traditionellen Heim, wo die Familie ja möglichst am liebsten auf eine Besuchsfunktion mit Blumenstrauß und Händchenhalten beschränkt wird, aber: „bitte nichts kritisieren, denn Ihr versteht ja doch nichts davon". Im Cantou soll konstruktiv kritisiert werden, aber grundsätzliche Meckerei wird ausgeschaltet, weil es um Mittragen der Entscheidungen und der Verantwortung geht, und weil die Familien immer sofort vor der Verantwortung stehen, es so entschieden zu haben. Ihre Mitentscheidung geht weit: wenn z.B. die Räume neu gestrichen werden sollen, entscheiden sie die Farben, ebenso wenn die Möbel ersetzt werden sollen (der große traditionelle Tisch, der das Zentrum des Cantou darstellt, wurde von einer Gruppe durch einen schmalen modernen Tisch in bandförmigem Kreis wie in Konferenzräumen ersetzt, damit mehr Raum zum Gehen entsteht und man sich auch in der Mitte aufhalten kann); sie können die Entlassung einer Hausfrau erwirken.
Zur Finanzierung. Es ist weitaus billiger als Pflegeheime, wie eine Untersuchung über die ökonomischen Hintergründe ergeben hat, für die Interviewer mit Stoppuhren hinter den Hilfskräften herspaziert sind und im Minutentakt über einen längeren Zeitraum die einzelnen Tätigkeiten gemessen haben. Die Meßwerte wurden für die ökonomische Analyse ausgewertet, sodaß man anschließend die Kosten aller Tätigkeiten kannte. - Die Finanzierung ist dieselbe wie für andere Heime, d.h. ein Teil ist staatlich, die allgemeine Pflicht-Krankenkasse, PSD, Sozialhilfe, kommunale Subven-
[Seite der Druckausg.: 171]
tionen etc., ein Teil ist Selbstbeteiligung, eventuell erbringt einen Teil der Sozialfond der Alters-Zusatz-Kassen.
Ursula Pohl: Mein Name ist Pohl, ich komme vom Seniorenbeirat der Stadt Maintal und bin in der Landesseniorenvertretung im Vorstand. Ich wollte gerne mal wissen, wie weit ist es mit der gerontologischen Ausbildung an den Universitäten?
R. Hartmann: Rolf Hartmann, ehrenamtlich tätig in einem Altersheim. Mich würde interessieren, wie in Frankreich die pflegenden Angehörigen behandelt werden. Kriegen die auch finanzielle Unterstützung wie bei uns, kriegen sie Betreuung durch irgendwelche Institutionen?
Reinhold Mayer-Bahlburg: Mayer-Bahlburg vom Diakonischen Werk, ich habe noch eine Frage zur Finanzierung der stationären Einrichtungen. Sie sagten, zum Teil sind es Eigenanteile, zum Teil ist es Finanzierung über die verschiedenen staatlichen Kassen; können diese Heime ihre Pflegesätze selbst festsetzen? Ist es möglich, da auch gewinnträchtig zu arbeiten, z.B. indem man Heime für Besserverdienende anbietet oder ist das sehr stark kontrolliert?
H. Krappatsch: Ich hätte gerne gewußt, ob die hier in Rede stehenden Materien in absehbarer Zeit auch im europäischen Raum, also im Raum der Europäischen Union vereinheitlicht werden. Ich habe schon vor Monaten in Berlin in einer gesundheitspolitischen Diskussion mal die These vertreten gehört, daß man nicht damit rechnen müßte, daß unsere gesundheitspolitischen, rentenpolitischen Regelungen noch weiter angehoben werden könnten, eher müßte man sich in einem mittleren Rahmen bewegen, zumal die portugiesischen und italienischen Verhältnisse auch nicht auf unser Niveau angehoben werden könnten. Eine gewisse Nivellierung wurde dort als Entwicklung vermutet.
Zwischenfrage: Gibt es so etwas ähnliches wie Zivildienst in Frankreich?
H. Jani: Die gerontologische Ausbildung an den Universitäten. Sie ist sehr selten. Lehrstühle für Geriatrie gibt es einige wenige und es gibt einige Universitäten, an denen Gerontologie gelehrt wird. Da ich die genaue Ant-
[Seite der Druckausg.: 172]
wort nicht kenne, möchte ich mich da nicht festlegen. Tatsache ist, und es soll in ganz Europa so sein, daß die geriatrische Ausbildung der allgemeinen Ärzte zu schlecht ist und daß auch sich nur sehr wenige geriatrisch fortbilden. Wenn man bedenkt, daß etwa 80 % der an Altersdemenz erkrankten Menschen nur vom Hausarzt behandelt werden und dieser meist weder von Altersdemenz noch von Geriatrie viel Ahnung hat, dann sieht es ziemlich traurig aus. Wenn ich an die vielen Veröffentlichungen denke; an alles was so geschrieben und auch auf Kongressen gesagt wird, dann gibt es immer wieder jemanden, der auf diese Mängel hinweist, in welchem Land auch immer, aber tatsächlich getan wird dagegen eigentlich wenig. Es gibt auch nur wenige Sonder-Ausbildungskurse. Dieser mangelnden Ausbildung und diesem geringen Interesse steht dann, wie auch in Deutschland, die tiefe Überzeugung so zahlreicher Mediziner gegenüber, sie besäßen die Schlüssel der Wahrheit, was die alten Menschen anbetrifft. Da besteht also eine große Diskrepanz, und ich meine, sie besteht in ganz Europa. Das liegt größtenteils an der Ausbildung; wobei man allerdings, das möchte ich abschließend zu dem Punkt sagen, auch nicht vergessen darf, daß die zukünftigen Ärzte während ihres Studiums ungeheuer viel zu lernen haben, viel mehr noch als vor 20 Jahren. Dennoch sollte man wohl die Allgemein-Ärzte dazu zwingen, Geriatrie und Gerontologie nicht ignorieren zu können, denn aufgrund der demographischen Entwicklung stellen alte Menschen ja hauptsächlich ihr Patientenpotential. Es ist ja auch leider so, daß sogar Heimärzte häufig überhaupt keine oder nur sehr lückenhafte geriatrische Kenntnisse haben. Das zu dem Thema.
Pflegende Angehörige, mein Lieblingsthema; ich werde mich trotzdem kurz fassen. Auch in Frankreich werden etwa 70 bis 80 % der Abhängigen von der Familie gepflegt. Geld bekommen sie nur in dem sehr begrenzten Rahmen der PSD. Aber, die Annahme, sie würden dadurch vielleicht eigene Rentenansprüche aufbauen, wäre falsch. Unter Umständen werden durch Familienpflege die Sozialfälle von morgen geschaffen, z.B. wenn jemand frühzeitig seine Arbeit aufgibt, um ein Elternteil zu pflegen. Betreuung haben die pflegenden Angehörigen, wenn sie zu den entsprechenden Angeboten hingehen. Man weiß, wie gut Betreuungsgruppen sind, insbesondere wenn sie professionell geleitet werden, und insbesondere wenn sie von Psychologen geleitet werden. Aber ich mache immer
[Seite der Druckausg.: 173]
wieder dieselbe Erfahrung, auch in meinem Privatumfeld; ich habe sehr vielen pflegenden Angehörigen geraten - ob es meine Schwester ist oder eine Freundin, in eine Gesprächsgruppe zu gehen, und dann bekomme ich fast systematisch dieselbe Reaktion „Oh, gibt es Gruppen? - Ja, gibt es; hier in Böblingen ist eine gute Gruppe - Oh wie schön, daß ich das weiß: wenn ich sie brauche, dann gehe ich dahin". Und wenn ich später einsehe, daß ich sie brauche, weil meine Schwiegermutter 96 ist und ihre Demenz immer stärker wurde, dann ist es häufig zu spät, denn die (falschen) Verhaltensschemata sind fest eingespielt. Und da dann herauszukommen, das ist auch gestern in dem Film deutlich geworden, das ist sehr schwer. Wenn die Gewohnheiten einmal eingefahren sind, ist es sehr, sehr schwer, Entscheidendes zu ändern - auch weil dazu sehr viel Selbstkritik gehört. Also, diese Art von Betreuung wird eher klein geschrieben, und die Verantwortung dafür trifft auch zum Teil die pflegenden Angehörigen selbst. Viele gehen ja davon aus, keiner könne Ihnen helfen. Manchmal steht auch dahinter, daß sie keine Hilfe annehmen wollen bzw. können.
Die Finanzierung der Heim-Pflegesätze. Der Tagessatz (Unterkunft und Verpflegung) wird auf Departementsebene festgelegt, und der Heimleiter kann in gewissen Grenzen diesen aushandeln. Für einen Großteil der Bewohner sowohl der staatlichen als auch der privaten gemeinnützigen Heime, die die staatliche Anerkennung haben, zahlt die Sozialhilfe einen Teil dieses sog. Hotelanteils, den der Bewohner selbst zu tragen hat. Diese Heime müssen ihr Budget vom Departement genehmigen lassen. Der Pflegesatz wird per Gesetz auf nationaler Ebene festgelegt, und da gibt es kein Aushandeln. Finanziert wird er von dem Krankenkassen-Zweig der Sécurité sociale. Aber es gibt noch immer andere finanzielle Träger wie insbesondere die Renten-Zusatz-Kassen, die bei der Finanzierung der Heimkosten eine ganz andere Rolle in Frankreich spielen als z.B. in Deutschland.
Kontrollen gibt es indirekt: keine Qualitätskontrollen der eigentlichen Pflege; aber es gibt Kontrollen von den unterschiedlichen verantwortlichen Instanzen, die Hygienekontrolle z.B. oder Kontrollen, ob Normen eingehalten werden. Man liest auch immer mal in der Zeitung, wie in anderen Ländern, daß mal wieder ein Riesenskandal aufgedeckt wurde, aber es sind Ausnahmefälle.
[Seite der Druckausg.: 174]
Die europäische Vereinheitlichung. Ich würde mit meinem österreichischen Vorredner von gestern sagen, daß, falls Mindestnormen festgelegt werden sollten, es sich damit nicht um eine Nivellierung handeln muß. Man kann immer mehr machen, wie Herr Olbrich gestern sehr eindrucksvoll an Beispielen belegt hat. Ich glaube, daß Ihre Frage grundsätzlich vielleicht den heutigen Rahmen sprengt; man müßte ganz anderes Vorwissen mitbringen, das ich nicht mitbringe, um über mögliche europäische Vereinheitlichung zu sprechen. Aber meines Wissens geht man in Europa nicht davon aus, man könne zu einer allgemeinen europäischen Harmonisierung der Rentensysteme kommen.
Zivildienstleistende gibt es in Frankreich, aber es ist nicht ein so weitreichendes Phänomen wie in Deutschland. Die relativ wenigen sind eher im Ausland, insbesondere in den ehemaligen französischen Kolonien z.B. im Schulwesen tätig oder auch im sozialen Bereich - aber auf jeden Fall hat Frankreich ja den Wehrdienst abgeschafft.
A. Braun: Und von einer allgemeinen Dienstpflicht ist nicht die Rede?
H. Jani: Nein, das wagt man nicht auch nur zu denken. Ich glaube es war 1993 auf einer sehr kleinen, intimen Pflegekonferenz in Weingarten, in diesem wunderschönen Kloster, da war ein Sachbearbeiter oder vielleicht Referatsleiter aus Bonn, und er sagte, Deutschland habe die Pläne fertig vorliegen für einen Sozialdienst für Männer und Frauen. Die liegen in den Schubladen, auch in anderen Ländern, aber man warte, daß ein Land so mutig ist, damit anzufangen. In Frankreich wird das Thema gelegentlich aufgeworfen und dann geht natürlich sofort das große Geschrei los, denn schließlich müßten wir Frauen ja die Kinder kriegen, aber daß wir nur noch 1,3 in unserem ganzen Leben zur Welt zu bringen brauchen im Gegensatz zu 8 bis 10 früher, spielt keine Rolle. Das stößt auf sehr viel Widerspruch; ebenso wie auch der Gedanke, Rentner, alle Art Beihilfeempfänger, Arbeitslose sollten nicht zuletzt um ihrer selbst willen zu einem sozialen Dienst gezwungen werden.
G. Braun: Aber die Einrichtung von Freiwilligendiensten wie etwa unser freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr kennt Frankreich nicht?
[Seite der Druckausg.: 175]
H. Jani: Nein, gibt es nicht.
A. Braun: Ich möchte hier gern eine Anmerkung zu der Vereinheitlichung in Europa machen: die Diskussion um die Angleichung der Sozialstandards, die ist vorbei. Wir haben die Entwicklung gehabt, daß über den Maastrichter Vertrag und zuletzt über den Amsterdamer Vertrag ganz eindeutig der Sozialbereich aus dem Zielhorizont irgendwelcher gemeinsamer europäischer Regelungen verschwunden ist. Im Gegenteil: wir haben seit Amsterdam das hochgehaltene Argument der Subsidiarität, und alle Sozialpolitik wird für subsidiär erklärt; das heißt, es gibt dort nur das Instrument der sogenannten Koordinierung. Wenn man sich also nach dem Muster der good-practices auf gemeinsam anzustrebende Ziele einigt, dann schreiben die Sozialminister das in ein gemeinsames Papier und empfehlen den 15 Ländern, sich daran zu orientieren bei ihren jeweiligen Zukunftsüberlegungen. Alles andere ist überhaupt nicht mehr auf dem Tisch, alles andere ist nach dem Amsterdamer Vertrag nicht denkbar.
G. Braun: Ich wollte noch eine kurze Frage stellen zu der Einschätzung im Vergleich dieser drei untersuchten Gruppen, Junge, Behinderte und Alte. Halten Sie dann die doch vorhandenen Manifeste, in denen immer wieder davon die Rede ist, daß die Alten als Kunden einerseits betrachtet werden sollen oder eben als diejenigen, die entscheiden, was z.B. in ihrer Wohnung passiert, wenn da von außen jemand reinkommt, halten Sie das nur für Deklamation und nicht für eine doch vielleicht auch zu erwartende Veränderung, an der manches good practice dann vielleicht zu erkennen ist ?
A. Braun: Also: der mobile Dienst ist der Gast in meiner Wohnung!
H. Jani: Der Klientengedanke steht in ganz Europa immer mehr im Vordergrund, und ich fand es sehr interessant, daß in dem Vortrag über die Niederlande grundsätzlich von Klienten gesprochen wurde. Das ist ein riesiger Fortschritt. Aber es darf nicht bei dem Wort bleiben, denn es hilft nicht weiter, wenn man sie Konsumenten nennt und ihnen damit nicht mehr als eine nette Bezeichnung gibt. Ich frage mich seit einiger Zeit, denn es läuft ja schon etwas länger diese Klientenbezeichnung, inwieweit das nicht genauso etwas ist wie: früher sagte man einfach „die Alten"
[Seite der Druckausg.: 176]
und heute sagt man „Senioren". Das hört sich so gut an. Und dann ist man nämlich gar nicht alt. Ob das nicht auch nur letztlich auf eine Wortbeschönigung herausläuft? Denn es kommt nichts nach. Es kommt zu wenig nach, es ist so undynamisch. Mir kommt die Altenhilfe immer stärker vor, als wäre alles irgendwo so fürchterlich festgefahren. Und da hilft dann auch eine neue Bezeichnung nicht. Hinzu kommt, daß, solange die Alten, das ist meine feste Überzeugung, solange die nicht endlich aufstehen und sagen, wir haben Rechte, wir wollen so behandelt werden, wir wollen das, wir..., wird sich nicht viel tun. In England ist das etwas ausgeprägter dank der National Carers Association, die für die pflegenden Angehörigen eine wirkliche pressure group darstellt; da geschieht etwas in dieser Richtung. Es gibt heute sicherlich viele Ansätze, aber wenn ich so die Dynamik auf den beiden anderen Sektoren sehe, dann sage ich, es dauert so lange, es geht zu langsam voran. Vielleicht liegt es daran, daß ich so ungeduldig werde im Alter.
W. Rosenbauer: Bei dem Stichwort Klienten oder Kunden, da kommt ja immer eine Art Tendenz hinein, wo man sagen könnte, jetzt wird es kommerzialisiert. Und das drückt sich auch dadurch aus, daß ich sage, ich kaufe die oder jene Leistung und ich habe eine Wahl und die ist dann auch meinetwegen durch meine finanzielle Situation begrenzt oder ermöglicht; es ist tendenziell eine Richtung, wenn ich von Klienten und Kunden und dergleichen spreche, die sich irgendwo aus dem Sozialen ein bißchen entfernt und mehr auf die Kommerzialisierung hinausläuft. Oder sehe ich das falsch ?
H. Jani: Der Klient nicht; das ist ein Kunde. Gut, wir können jetzt lange darüber diskutieren, welche guten und welche negativen Seiten das hat. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Altersforschung; früher sprach man von Unterstützten, es sind heute keine Unterstützten mehr, um es so auszudrücken, es gibt da verschiedene, sehr negativ belegte Worte, auch für die Heimbewohner, zum Beispiel.
Zwischenruf: Insassen!
H. Jani: Insassen, ja. Diese neuen Wörter haben natürlich sehr viel Positives, und sie drücken auch positive Entwicklungen aus. Natürlich kann man
[Seite der Druckausg.: 177]
jetzt sagen, es gehe mal wieder nur ums Geld und mal wieder nur um Konsum. Aber, ich möchte das eigentlich nicht so sehen, ich glaube, es geht mehr in die Richtung, daß der alte Mensch entscheiden kann und das finde ich, muß er auch können, solange ihm sein Kopf die Möglichkeit bietet.
A. Braun: Also, ich kann jetzt keine weitere Wortmeldung mehr annehmen, wir sind schon eine Viertelstunde über der Zeit und wir kommen sonst wieder in den Gang von gestern rein. So interessant das jetzt wäre, nochmal nachzuhaken, ich werde die Diskussion jetzt einfach hier mit Gewalt beenden, sonst haben wir keine Chance, den Zeitablauf hin zu bekommen. Noch einmal herzlichen Dank, Frau Jani, für die Diskussion.
Vielleicht kann es uns gelingen, die Kaffeepause wirklich auf 11 Uhr zu begrenzen; ich bitte auch daran zu denken, daß man die Schlüssel abgeben sollte.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | April 2001