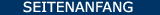![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
29. Oktober 1999
[Seite der Druckausg.: 7]
Alfred Braun: Einen wunderschönen guten Morgen, ich darf Sie alle recht herzlich zu unserem 9. Freudenstädter Forum begrüßen. „Solidarität der Generationen – Perspektiven des Älterwerdens der Gesellschaft in Deutschland und Europa", das ist ja die Dachzeile, unter der wir das Forum seit 1991 hier jedes Jahr veranstalten. Wir wollen uns in diesem Jahr insbesondere mit den Erfahrungen in Deutschland und den anderen europäischen Ländern beschäftigen, die gesetzliche Regelungen über Leistungen bei Pflegebedürftigkeit kennen.
Es ist jetzt gerade mal fünf Jahre her, daß die jahrzehntelange Auseinandersetzung um eine gesetzliche Regelung der Pflege in Deutschland abgeschlossen wurde. Der Bundestag hat am 22. April 1994 und der Bundesrat eine Woche später am 27. April das Pflegeversicherungsgesetz verabschiedet. Es trat, das will ich nur noch mal in Erinnerung rufen, dann in Kraft zum 01.01.1995; das heißt da wurden alle beitragspflichtig, die vom Gesetz erfaßt wurden und mußten zahlen. Die Leistungen im ambulanten Bereich setzten dann am 1. April 1995 ein und die Leistungen im stationären Bereich am 01.07.1996. Wenn man das noch einmal rückwärts abspielt, ist es ja eine ungeheure Kraftanstrengung gewesen, innerhalb dieses knappen Zeitraums von April 1994 bis April 1995 die ganze bürokratische Verwaltungsapparatur auf die Beine zu stellen, damit das laufen konnte. Ich finde immer noch: es ist den Kassen, wenn man diesen Gesichtspunkt berücksichtigt, sehr gut gelungen, das neue System zu implementieren. Es hat seitdem natürlich immer wieder eine ziemliche Diskussion darüber stattgefunden, ob es nun an den Kassen liege oder ob es am Gesetzgeber liege, wie das laufe mit der Pflege. Ich glaube, die Diskussion wird uns noch eine Weile verfolgen, aber mein bis jetzt überwiegender Eindruck ist, die Ärgernisse sind vom Gesetzgeber gewollt und nicht etwa eine bloße Folge des Verwaltungshandelns der Kassen.
Also fünf Jahre nach Ende dieser Auseinandersetzung wollen wir das heute noch einmal beäugen. Wir haben dafür morgen sozusagen die beiden potentiellen Kontrahenten im Bereich der stationären aber auch der ambulanten Leistungen hier am Tisch: einerseits in der Person von Dr. Hoberg für die Pflegekassen; er ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der
[Seite der Druckausg.: 8]
AOK in Baden-Württemberg, und in seinen Bereich fällt die Zuständigkeit für die Pflegekasse und den Medizinischen Dienst zum Beispiel. Und wir haben auf der anderen Seite für die Anbieter von Pflegeleistungen Frau Baehrens vom Diakonischen Werk in Württemberg. Ich glaube, damit haben wir einen sehr guten Ausschnitt aus der Diskussion zwischen diesen beiden Kontrahenten oder Partnern im Pflegebereich, und es kann morgen ganz schön spannend werden.
Aber wie immer - seit jetzt fast 10 Jahren - haben wir uns eigentlich und in erster Linie vorgenommen, an diesem Forum über den Zaun nach Europa zu gucken: zu sehen, wie machen das andere. Und ich habe die große Freude, vier unserer schon erprobten Helfer beim „über-den-Zaun-Gucken" hier bei uns zu begrüßen und zwar Dr. Hannelore Jani für das Länderbeispiel Frankreich morgen früh, Gret Pels und Henk Schippers, die heute abend ihren Teil über die Niederlande bestreiten, und Eduard Olbrich vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Wien zur österreichischen Pflegevorsorge. Wir haben ja da die interessante Parallele, daß die Österreicher das Problem fast gleichzeitig, aber genau anders gelöst haben, nämlich nicht über eine Versicherung, sondern über ein Leistungsgesetz. Es gab ja auch bei uns eine jahrzehntelange Diskussion zu der Alternative Leistungsgesetz oder Versicherung. Insofern können wir jetzt mal nachvollziehen, wie das in beiden Systemen gelaufen ist.
Heute vormittag geht es eher um die Theorie, die Steuerungsebene über den konkreten Ausformungen der Pflegepolitik. Thomas Schilling von der Universität Halle wird über Strategien zur Stützung familialer Potentiale für die häusliche und für die stationäre Pflege sprechen. Er ist eingesprungen für Holger Backhaus-Maul, der im Augenblick Erziehungsurlaub macht und in Amerika ist bei seiner Frau und wahrscheinlich schon bei seinem Kind; die Geburt wurde jetzt gerade so um diesen Zeitpunkt erwartet. Wir werden heute im zweiten Teil des Vormittags Frau Schäfer-Walkmann hören zu der Frage, welche Standards der Pflegeleistungen bei dem System, das wir haben, denn finanziert werden können. Auch sie ist eingesprungen für Frau Dr. Busch, die im Augenblick im Mutterschaftsurlaub ist. Es hat sich also ein bißchen Bevölkerungsbewegung unmittelbar auf unsere Seminarplanung ausgewirkt. Aber wir haben es sehr früh erfahren und
[Seite der Druckausg.: 9]
beide haben uns jemanden aus ihrem Arbeitsbereich als Vertretung vermittelt.
Wir haben dann heute nachmittag eine Phase eingeschoben - das hatte sich letztes Jahr bewährt - daß wir nach der Kaffeepause hier oben und einen Stock tiefer in dem anderen Lehrsaal jeweils Videobeiträge zum Thema zum Anschauen anbieten. Der eine Beitrag ist etwa eine Stunde lang, den werden wir unten zeigen; zwei Beiträge sind jeweils eine halbe Stunde lang, die werden wir hier zeigen. Und wer morgen noch die nötige Geduld hat, dem werden wir nochmals einen längeren Film von etwa einer Stunde und zwei kleinere Beiträge anbieten um 16 Uhr, sozusagen nach dem eigentlichen Forum.
Ich möchte auch hinweisen auf einige Sachen, die wir draußen ausgelegt haben, es sind in der Hauptsache zwei Dinge, einmal hat die Weinberger-Akademie der bayerischen Arbeiterwohlfahrt als Weiterbildungs- und For-schungsbegleitungseinrichtung über das „Modellprojekt regionale Service-zentren für häusliche Altenpflege" einen Abschlußbericht vorgelegt. Eine Kurzfassung des Abschlußberichts haben wir vollständig kopiert; den können Sie sich ansehen und bei Gefallen mitnehmen. Ein Lehrvideo, das die Weinberger-Akademie gemacht hat, „Pflege in einer Familie", können wir leider nicht zeigen, der hat einen Pfeifton drauf, wir wissen nicht warum. Aber wir haben draußen das Titelblatt von dem Begleitbuch zu diesem Video ausgelegt. Das Lehrvideo ist so angelegt, daß es eine Pflege- oder Betreuungssituation einfach anreißt und dann in dem Begleitbuch einige Folgen anbietet, wie man das zwischen den Beteiligten vorbeugend diskutieren könnte, um diese Probleme aufzuarbeiten.
Dann ist vor einiger Zeit das Mai-Heft von „Pro Alter" erschienen. Ich weiß nicht, ob Sie das alle kennen, das war früher „KDA-Info", seit einiger Zeit heißt es „Pro Alter" und jetzt haben sie auch noch mal das Layout und das Format verändert. Wir haben in die Mappen einen Prospekt für diese Zeitschrift eingelegt. Die Mai-Nummer hat Pflegeeinstufung zum Thema. Und ich finde das auch sehr gelungen, was sie dazu gemacht haben. Wir haben den Themen-Schwerpunkt „Einstufung" rauskopiert. Sie können das mitnehmen, es soll Sie aber nicht daran hindern, diese Zeitschrift trotzdem zu abonnieren.
[Seite der Druckausg.: 10]
Ebenfalls ausgelegt haben wir die neue Ausgabe der Broschüre des Bundesministeriums für Gesundheit zur Pflegeversicherung, die ist sehr informativ, da kann man auch ruhig darauf hinweisen. Und zuletzt haben wir noch dieses Beispiel eines Wohnungsanpassungshandbuches, das von einem kommerziellen Anbieter sehr gut gemacht wurde, hingelegt. Schauen Sie sich das an, die Bestelladresse und die Telefonnummer stehen hinten drauf, wenn Sie sich das aufschreiben wollen.
Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, daß wir Herrn Schilling gleich eine Viertelstunde Zeitvorsprung geben können, den wir erfahrungsgemäß gut brauchen können. Gestern abend haben einige gemerkt, daß manche sich kennen und einige niemand kennen. Deshalb vorab für die Diskussion eine Bitte: wenn jemand von Ihnen sich in der Diskussion meldet, bitte das Mikro benutzen und zweitens beim erstenmal kurz sagen, wer er oder sie ist und wo sie herkommen, aus welchem Umfeld.
Thomas Schilling: Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich. Herr Braun hat das ja schon kurz angedeutet, daß ich eingesprungen bin für Herrn Backhaus-Maul; ich bedanke mich bei Herrn Braun für die Begrüßung.
Ich komme aus Halle, von der Universität Halle an der Saale, also aus den neuen Bundesländern, bin von Beruf Diplom-Pädagoge, von der Ausbildung her Krankenpfleger, habe neben dem Studium immer in der Altenpflege gearbeitet, arbeite auch jetzt noch sporadisch in der Altenpflege und schreibe zur Zeit an meiner Dissertation im Bereich ambulanter Altenpflege, wo ich mich sehr intensiv mit Leitbildern in der Pflege beschäftige. Mit Leitbildern in der Pflege und Einstellungsmustern von Pflegekräften, also den Vorstellungen von guter Pflege, wie sie von außen formuliert werden und die versuche ich zu kontrastieren mit den persönlichen Vorstellungen von guter Pflege, wie sie Pflegekräfte haben. Das war für mich ein relativ spannendes Thema, weil ich denke, daß Anspruch und Wirklichkeit relativ weit auseinander klaffen und daß aufgrund der Erfahrungen, die ich selber als Krankenpfleger gemacht habe, ich näher untersuchen wollte, was hat es mit diesen Leitbildern auf sich und welche Möglichkeiten gibt es, diese Vorstellungen von guter Pflege umzusetzen. Vielleicht lasse ich es erstmal dabei bewenden.
[Seite der Druckausg.: 11]
Gebrechlich, hinfällig, krank zu werden, stellt ein allgemeines soziales und dennoch hochgradig individualisiertes Risiko dar: Allgemein, weil es prinzipiell jeden betrifft: Jeder wird alt, jeder kann pflegerischer Hilfe bedürftig werden - auch unabhängig vom Lebensalter - jeder kann erleiden, daß er nicht mehr kann, was er konnte oder können wollte. Aber sich nicht mehr selbst pflegen zu können, bleibt auch ein individualisiertes Risiko, weil sich vielleicht gerade im Falle des Eintritts von Pflegebedürftigkeit zeigt, wie tragfähig die soziale Plazierung des Einzelnen ist.
Der Schwerpunkt liegt auf altersbedingter Pflegebedürftigkeit. Die Kopplung von Alter und Pflegebedürftigkeit ist für einen Großteil der Alten unzutreffend. Trotz dieses (quantitativ gesehen) randständigen Problems kann Pflegebedürftigkeit im Alter aber als ein konstantes Phänomen begriffen werden. Pflegebedürftigkeit bleibt als Problem für eine „Minderheit" der Alten relevant und umfaßt neben den körperlichen Einschränkungen auch einen darüber hinaus bedeutsamen Pflegebedarf.
Bei der im Rahmen meiner Ausführungen nur ausschnitthaft möglichen Auswahl von Strategien zur Stützung von Potentialen familiärer und institutioneller Pflege möchte ich auf unterschiedliche Schwerpunkte kurz eingehen.
- Als erstes möchte ich einen kurzen historisierenden Überblick über die Entwicklung der Altenhilfe und der gesellschaftlichen Altersbilder in Deutschland geben. DABEI KOMMT ES MIR DARAUF AN ANZUDEUTEN, DAß ES UNTERSCHIEDLICHE ENTWICKLUNGEN IN WEST- UND OSTDEUTSCHLAND GEGEBEN HAT UND ES AUCH ZEHN JAHRE NACH DER WENDE NEBEN VIELEN GEMEINSAMKEITEN AUCH UNTERSCHIEDE GIBT, DIE ABWEICHENDE STRATEGIEN UND INSTITUTIONELLE AUSRICHTUNGEN NOTWENDIG MACHEN.
- Zweitens sollen einige ausgewählte dEMOGRAPHISCHE DATEN GENANNT UND ENTLANG DIESER „OBJEKTIVEN DATEN" SOWOHL ALTERSDIFFERENZIERUNGEN ALS AUCH POTENTIELLE PROBLEM- UND RISIKOGRUPPEN HERAUSGESTELLT WERDEN. DIESE DATEN SOLLEN MIT SOZIALEN HINTERGRÜNDEN ZU LEBENSLAGEN IM ALTER UND DER FAMILIE VERKNÜPFT WERDEN.
[Seite der Druckausg.: 12]
- Im Anschluß daran möchte ich in einem groben Überblick die gesetzlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen für eine familiäre und institutionelle Hilfe aufzeigen und die damit verbundenen Chancen und Probleme anreißen.
- AUS DIESEM ÜBERBLICK DER GESETZLICHEN UND ÖKONOMISCHEN RAHMENBEDINGUNGEN HERAUS SOLLEN ENTLANG DES LEITBILDES „AMBULANT VOR STATIONÄR" AUSGEWÄHLTE INSTITUTIONELLE HILFEN UND ANGEBOTE BESCHRIEBEN WERDEN. Primär soll es dabei um die Bereiche Wohnen, Sozialpflegerische Dienste (Sozialstationen) und soziale Altenarbeit gehen.
- DIE DARSTELLUNG VON INSTITUTIONELLEN ANGEBOTEN KANN NICHT LOSGELÖST VON DER NUTZUNG SOZIALER DIENSTLEISTUNGEN BETRACHTET WERDEN. HIER SOLL DER FRAGE NACHGEGANGEN WERDEN, WAS WIR EIGENTLICH ÜBER DAS NUTZUNGSVERHALTEN BZW. DIE AUSLÖSEBEDINGUNGEN BEI DER INANSPRUCHNAHME SOZIALER DIENSTE WISSEN.
Der Rahmen für eine institutionell abgesicherte Altenhilfe wird begrifflich unterschiedlich bestimmt. Der Altenhilfesektor kann in einen offenen und stationären Bereich unterteilt werden. Parallel dazu ist eine schematische Zuordnung in eine traditionelle und eine moderne Orientierung möglich.
In der traditionellen Orientierung besteht eine vorrangige Ausrichtung an der Bedürftigkeit, d.h. an der Armut, Behinderung oder Isolation älterer Menschen. Die moderne Orientierung zielt auf die Gesamtheit der Alten. Eine formale Orientierung am Lebensalter alter Menschen bleibt modifiziert erhalten. Im Kontrast zur traditionellen Orientierung rücken präventive Hilfemaßnahmen stärker in den Vordergrund. Das Verhältnis von Problemen und Potentialen im Alter drückt sich in den verschiedenen Altersbildern unterschiedlich aus. Pflegebedürftigkeit soll möglichst vermieden bzw. beschränkt bleiben. In Abhängigkeit von aktivitäts- oder defizitorientierten Altersbildern kommt es zu unterschiedlichen Attributionen, wie z.B. Pflegebedürftiger oder aktiver Senior, auf deren Basis sozialpolitische Maßnahmen entwickelt werden. Altersbilder dienen zur politischen Legitimation sozialpolitischer Maßnahmen und knüpfen „schön eingekleidet" an konsensfähige Werte, wie z.B. in Würde alt zu werden, Selbständigkeit, Bedürfnisorientierung u.a. an.
[Seite der Druckausg.: 13]
These: Der Abschied vom Heim hat paradigmatisch betrachtet keine „heimliche" Tradition!
Neben realen Problemlagen beeinflussen soziokulturelle und politische Faktoren die Zielvorstellungen und Schwerpunktbildung von Altenhilfe.
Viele Entwicklungen, die sich später als dominierender Trend in der Altenhilfe durchgesetzt haben, sind ansatzweise bereits in den vorhergehenden Altenhilfeentwicklungen erkennbar. Aus dem Grundsatz „offene vor geschlossene Altenhilfe" wird in den siebziger Jahren das Leitbild „ambulante vor stationärer Pflege".
In der Übersicht zeigt die Diskussion um das Alter und die damit verbundenen Altenhilfeorientierungen eine relativ hohe Kontinuität in den Grundorientierungen. Trotz veränderter Leitbilder und neuer Begrifflichkeiten ist die Altenhilfe seit der Einführung des neugefaßten Bundessozialhilfegesetzes (1961) in vielen Bereichen weitgehend konstant geblieben; im Überblick hat sich seit 1950 letztendlich nur ein wesentlicher Paradigmenwechsel in der Altenhilfe vollzogen: Die Orientierung an immateriellen Problemlagen und am Grundsatz „offen vor geschlossen" kann als primärer Hauptentwicklungsstrang identifiziert werden, denen sich andere Begriffe und Entwicklungen gewissermaßen untergeordnet haben.
Das „idealistische Altersbild" bildet eine wesentliche Grundorientierung in der Altenhilfe bis in die Gegenwart hinein. Das Alter wird in diesem Konstrukt als Aufgabe betrachtet und die Möglichkeiten zur Entwicklung und Vervollkommnung im Alter betont. Die daneben bestehende Sichtweise des Alters als soziales Phänomen verknüpft Altersprobleme vorrangig mit sozioökonomischen Rahmenbedingungen bzw. dem Bildungsgrad von älteren Menschen. Problembehaftete Alterssituationen werden eher am Rande wahrgenommen. Soziale Isolation und Beschäftigungslosigkeit werden problematisiert und die Familie zum Hort der Pflege alter Menschen deklariert.
Der pädagogische Impuls war in den fünfziger Jahren besonders stark. Alte Menschen sollten über Beschäftigungsangebote und Begegnungsmöglichkeiten sozial integriert bleiben. Dieser Impetus führte zur Entwicklung von offenen Altenhilfestrukturen. In den sechziger Jahren wurde die so-
[Seite der Druckausg.: 14]
ziokulturelle Ausrichtung der Altenhilfe, insbesondere durch die Einführung des neuen Bundessozialhilfegesetzes, betont. In diesem Zusammenhang entstand das bis heute dominierende Leitbild von „offener vor geschlossener Altenhilfe". Die prosperierende Wirtschaftsentwicklung begünstigte einen Institutionalisierungsschub der offenen Altenhilfe. Insbesondere Altentagesstätten wurden massiv ausgebaut und entwickelten sich zum Standardangebot der offenen Altenhilfe.
In den sechziger Jahren entwickelte sich eine realistischere Sicht auf das Alter. Funktionsverluste der Familie wurden offener artikuliert und in Anlehnung an diese Entwicklung eine stärkere Selbständigkeit älterer Menschen angestrebt. Über bereits installierte Strukturen der Altenhilfe sollten vor allem die Bildungs- und Beschäftigungsangebote unterstützt werden, welche die Selbständigkeit älterer Bürger so lange wie möglich fördern und entwickeln helfen. Trotz dieser Orientierung wurde der stationäre Sektor um- und ausgebaut.
In den siebziger Jahren lag der Akzent auf präventiv ausgerichteten Bildungsangeboten in der offenen Altenhilfe. Auf der Grundlage sozialwissenschaftlicher Untersuchungen wurde eine Korrelation von Bildungsstand und individuell vorliegender Alterssituation hergestellt. Der individuelle Bildungsstand soll bei Bedarf „nachgeliefert" und bei der Bewältigung von Altersproblemen präventiv aktiviert werden. Interventionsgerontologie wird zu einem neuen Zweig präventiv ausgerichteter Altenhilfe. Präventive Bemühungen richten sich auf das psycho-physische Wohlbefinden, das bis ins hohe Alter hinein gesichert werden soll. Problembehaftete Alterszustände, wie z.B. Pflegebedürftigkeit und Demenz, werden als Bestandteil eines negativen Altersbildes weitgehend ausgeblendet. Ziel war es, mit Hilfe präventiv ausgerichteter Altenarbeit, möglichst viele alte Menschen auf das Niveau des aktiven Senioren heraufzuheben.
Die Lebenssituation alter Menschen wurde in den siebziger Jahren über Altenhilfepläne verstärkt aufgegriffen. Eine ganzheitliche Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen sollte mit Hilfe von Altenhilfeplänen umgesetzt werden. Die Koordination und Organisation sozialer Dienste über Altenhilfeplanung wurde angestrebt. Im Gegensatz zum positiven Altersbild dominiert in den Altenhilfeplänen ein implizit negatives Alters
[Seite der Druckausg.: 15]
bild. Formal wurden die präventiven Wirkungen der offenen Altenhilfe positiv herausgestellt und eine Orientierung am aktiven Senior symbolisch mitvollzogen. Der Schwerpunkt der Planungen liegt aber zumeist auf dem Problem der Pflegebedürftigkeit. Die Planungseuphorie flaute Ende der siebziger Jahre merklich ab.
Die wachsende Krise des Wohlfahrtsstaates führte im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Einbrüchen und zunehmenden Legitimations- und Steuerungsproblemen auch im sozialen Bereich zu einer stärkeren Selbsthilfeorientierung im Altenhilfesektor. Die Reaktivierung und Inpflichtnahme familiärer Netzwerke skizziert eine eher konservative Kehrtwende in der Altenhilfe. Die Familie wird administrativ zur primären Problemlösungsinstanz im Alter deklariert. Eine Trennung in ein aktives und ein hinfälliges Alter wird in den verschiedenen Altenhilfediskursen sichtbar. Ambulante Dienste werden ausgebaut und als subsidiär unterstützende Hilfen in der Pflege konzipiert. Die Pflege in der Familie bleibt vorrangig. Die Potentiale und Wirkungen ambulanter Hilfsdienste wurden in den achtziger Jahren als ausreichend eingeschätzt. Sozialpolitische Diskurse zeigen eine Problemverschiebungstendenz und in der bürokratischen Umsetzung eine stärkere Funktionalisierung von Altersbildern. Die positive Sicht auf das Alter relativiert sich in sozialwissenschaftlichen Diskursen ebenso wie die Hoffnungen auf die weitreichenden präventiven Wirkungen durch Maßnahmen der offenen Altenhilfe.
Problemorientiertere Sichtweisen des Alters nehmen Ende der achtziger Jahre zu. Der Akzent von Altenhilfeplanung liegt verstärkt auf der Vernetzung und Kooperation unterschiedlicher Dienstleistungserbringer und Hilfeformen. Die manifest Pflegebedürftigen werden zur hauptsächlichen Zielgruppe der Altenhilfe in den neunziger Jahren. Harte Problemlagen dominieren die Diskussion in der Altenhilfe. Unter dem Postulat „ambulant vor stationär" wird nach professionellen Problemlösungen gesucht
Die Diskussion rund um die Lebensphase Alter ist relativ statisch. Während auf der politischen Ebene das Kompetenz- und Aktivitätsmodell vom Alter dominiert, besteht im Kontrast dazu ein Diskussionsstrang, der stärker die Probleme der Altersphase und die damit zusammenhängenden sozioökonomischen Rahmenbedingungen aufgreift. Auffällig ist die fehlende Paral-
[Seite der Druckausg.: 16]
lelität zwischen Altersbildern und praktischer Zielgruppenorientierung. Während das positive Altersbild das Defizitmodell des Alters weitgehend abgelöst hat, dominiert in der Altenhilfepraxis die Orientierung am pflegebedürftigen Alter. In der Altenpflege überwiegen Charakterisierungen, die sich an Einschränkungen bzw. Funktionsverlusten orientieren, während in Anlehnung an das positive Altersbild, selbst bei schwerer Pflegebedürftigkeit, von verbliebenen Aktivierungspotentialen ausgegangen wird. In der Summe dominieren in der Altenhilfe positive Orientierungen mit optimistischen Problemlösungskonzepten. Durch die hochambitionierten Ansprüche werden weitreichende Erfüllungshoffnungen geweckt. Die symbolische Funktion dieser Leitbilder scheint offensichtlich und führt insgesamt gesehen zur programmatischen Vernachlässigung des stationären Altenpflegebereiches.
Die besondere Orientierung auf den positiven Gesundheitsbegriff und an der außerinstitutionellen Pflege im familiären Rahmen kommt in der Wiener Erklärung (1982) zum Ausdruck: „Bei der Betreuung älterer Menschen sollte man nicht nur auf Krankheit achten, ...vielmehr ihr gesamtes Wohlbefinden im Auge haben und dabei die Wechselwirkung der körperlichen, geistigen, sozialen und ökologischen Faktoren berücksichtigen. Die Gesundheitsbetreuung zur Verbesserung der Lebensqualität der älteren Menschen sollte daher sowohl die gesundheitliche als auch die soziale Betreuung und die Familie einschließen. Die gesundheitliche Betreuung, vor allem die Grundbetreuung, sollte darauf abzielen, daß die älteren Menschen so lange wie möglich ein selbständiges Leben in ihrer eigenen Familie und Lebensgemeinschaft verbringen können und nicht von allen Aktivitäten anderer Menschen ausgeschlossen werden."
Die Übertragung des westdeutschen Altenhilfemodells auf die neuen Bundesländer war und ist nicht frei von Verwerfungen. Die Möglichkeiten und Grenzen westdeutscher Modelle in den neuen Bundesländern zeigen sich gerade dort deutlich, wo Unterschiede und Besonderheiten in den neuen Bundesländern unzureichend berücksichtigt wurden/werden. Die ostdeutsche Brille darf bei der Betrachtung des gesamtdeutschen Altenhilfesektors nicht aufgegeben werden. Ein nivellierender Blick auf unterschiedlich gewachsene Kontexte bleibt schwer nachvollziehbar. Ein kurzer
[Seite der Druckausg.: 17]
Einblick in die Altenpflegelandschaft der ehemaligen DDR scheint für das Verständnis dieser Unterschiede unabdingbar zu sein.
Bei der Rekapitulierung der DDR Altenhilfe durch Gerontologen aus der ehemaligen DDR fällt auf, daß zwar harte Auflistungen von Daten erfolgen, kritische Reflexionen und Hintergründe zu diesen „Fakten" aber weitgehend fehlen bzw. an der Oberfläche bleiben. Es fehlen differenzierte Forschungs- und Bedarfsanalysen.
In der DDR wurde administrativ ein umfassender Betreuungsanspruch postuliert. Die Fürsorge gegenüber alten Menschen sollte sowohl medizinische als auch soziale Maßnahmen umfassen, „...die das Ziel haben, die Selbständigkeit in der Lebensführung soweit wie möglich zu erhalten, anzuregen und zu aktivieren und dort schnell und unkompliziert zu helfen, wo es erforderlich wird." In Anlehnung an WHO-Grundsätze wurde formal ein mehrdimensionales Betreuungskonzept konzipiert. Die an dieses Verständnis anknüpfenden Empfehlungen der WHO galten in der DDR offiziell als umgesetzt.
Die Betreuung von Pflegebedürftigen wurde in der Realität primär über die Familien abgedeckt. Die Familienhilfe sollte im umfassenden Fürsorgeverständnis der DDR eingebunden sein in betriebliche, nachbarschaftliche und sozialdienstliche Hilfen (DRK, Volkssolidarität, Timurdienste, Hilfen durch die Nationale Front u.a.). Zentralistische Planung und Koordinierung über institutionalisierte Formen von Hilfe und Pflege sollten eine umfassende Betreuung sicherstellen. Die Übernahme von Pflege durch Familienangehörige war grundsätzlich kein gesellschaftlich erstrebenswertes Ziel. Die Aufgabe der Berufstätigkeit sollte vermieden werden. Familiäre Pflege wurde finanziell nur im geringen Maße unterstützt. Die zeitgleiche Vereinbarung von Beruf, Partnerschaft, Elternschaft und Pflege wurde gesellschaftlich propagiert. Der Anteil berufstätiger Frauen war in der DDR höher als in Westdeutschland, d.h. es bestand sowohl eine starke Betriebsbindung als auch eine starke Familienbezogenheit. Der offizielle und inoffizielle Druck auf (die in der Regel) weiblichen Familienmitglieder, diese von der häuslichen Pflege ihrer Angehörigen zu entbinden, hat trotz traditioneller Familienstrukturen in der DDR den Sog in die private Sphäre er-
[Seite der Druckausg.: 18]
schwert. Die Orientierung lag schwerpunktmäßig auf der Pflege über bzw. in Institutionen.
Eine vorrangige Konzentration auf die häusliche Pflege ist in der DDR nicht erkennbar. Die Pflege zu Hause war zumeist mit einer Doppelbelastung (Beruf und Familie) verbunden. Die staatlichen Regelungen boten für Angehörige keinen Anreiz, die Pflege zu Hause eigenständig durchzuführen. Angesichts der Zustände in den Heimen wurde die persönliche Pflege zu Hause z.T. als die bessere Alternative angesehen. Aufgrund der defizitären und äußerst unflexiblen formellen Hilfestrukturen waren ein hoher Verhandlungsaufwand, starke Partnerschaften und informelle Netzwerkstrategien notwendig, um die Pflege in der häuslichen Sphäre abzusichern. Wer sich ganz bewußt für eine private Pflege zu Hause entschied, parallel dazu aber von offiziellen Hilfen abhängig war, entwickelte ein klares Bewußtsein für die Grenzen des DDR Gesundheitswesen.
Die Schaffung von altersgerechten Wohnungen blieb trotz hochtrabender Versprechungen völlig unzureichend. Spezielle Wohnhäuser für Alte sollten, mit einem entsprechenden Versorgungsangebot versehen, eine Alternative zur stationären Versorgung bilden. Prinzipiell sollte eine stationäre Pflege vermieden werden, zumal die Heimkapazitäten nicht ausreichend vorhanden waren. Komplementäre Dienste und flankierende Maßnahmen zur Betreuung von Pflegebedürftigen wurden angestrebt, konnten aber im Kontext eines unterentwickelten Dienstleistungssektors in der DDR nur ansatzweise umgesetzt werden. Eine funktionsfähige Alternative zur stationären Betreuung von Hilfebedürftigen im Alter bestand im Prinzip nicht. Die soziale Betreuung reduzierte sich in der Regel auf das Sauberhalten und Heizen der Wohnung sowie auf die Wäsche- und Essensversorgung. Weitergehende Angebote und Dienstleistungen fehlten fast gänzlich.
Der Betreuungsschwerpunkt lag auf der somatischen Pflege und Betreuung der Patienten. Da die Kritik an bestehenden Betreuungsstrukturen und allgemein krankheitsbegünstigenden beruflichen und sozialen Rahmenbedingungen politisch brisant war, blieb eine öffentliche Diskussion darüber aus. Reformansätze wie sie z.T. in den siebziger Jahren in der Bundesrepublik artikuliert und teilweise auch umgesetzt wurden, blieben auf den Rahmen inoffizieller Fachdiskurse beschränkt.
[Seite der Druckausg.: 19]
Die insbesondere in „unproduktiven" Bereichen der Medizin, wie z.B. in der Psychiatrie und Altenpflege, bestehende Tendenz, weniger engagiert zu therapieren bzw. zu pflegen, führte zu einer deutlichen Vernachlässigung dieser Bereiche innerhalb des DDR-Gesundheitswesen. Die Bedingungen und Zustände waren in diesen Bereichen besonders bedrückend. Die Verwahrung und Grundversorgung von Pflegebedürftigen im Alter überwog. Der Verwahrungs- und Grundsicherungscharakter wurde durch fehlende personelle und institutionelle Kapazitäten, insbesondere im Altenpflegebereich, verstärkt. Pflegebedürftige wurden mangels familiärer und ambulanter Betreuungsmöglichkeiten primär in stationären Einrichtungen betreut. Die schlechten Wohnverhältnisse vieler älterer Hilfebedürftiger bzw. ihrer Angehörigen (Außentoiletten, Kaltwasseranschlüsse, fehlende Bäder, Kohleheizung, fehlende Fahrstühle usw.) schufen einen erhöhten Sog in die stationären Betreuungseinrichtungen. Die Platzkapazitäten in Feierabend- und Pflegeheimen, mit einem angestrebten Anteil von etwa 70% Pflegeplätzen, deckten den Bedarf bei weitem nicht ab.
Die Fehlbelegung und bloße Verwahrung von Hilfebedürftigen schuf ein diffuses Betreuungsprofil innerhalb stationärer Pflegeeinrichtungen Der verwahrende Charakter stationärer Pflegeeinrichtungen wurde durch den z.T. hemmungslosen Einsatz von Psychopharmaka eher verstärkt. Die Folge waren größtenteils unbeschäftigte, dahindämmernde Heimbewohner. Das unkritische Verabreichen dieser Medikamente ist auch im Zusammenhang mit fehlenden personellen Ressourcen sowie in unzureichenden sozialen bzw. psychotherapeutischen Betreuungsangeboten zu sehen.
Der Anteil an unqualifiziertem Pflegepersonal war im Bereich der Altenpflege überdurchschnittlich hoch. Eine aktive Reintegration und Rehabilitation von Pflegefällen wurde durch die mangelnde fachliche Qualifikation von Pflegekräften, die fehlende Rechtsstaatlichkeit sowie unzureichende flankierende Maßnahmen und Einrichtungen zumeist verhindert. In vielen Feierabend- und Pflegeheimen herrschten menschenunwürdige Bedingungen. Im Extremfall wurden bis zu zwanzig Pflegebedürftige in Bettensälen verwahrt.
Nur etwa zwölf Prozent der über 60-Jährigen möchten perspektivisch gesehen in einem Heim oder einem Seniorenstift verbringen (Emnid Umfra-
[Seite der Druckausg.: 20]
ge/Spiegel-Spezial 2/99; 59). Der Umzug ins Heim wird im allgemeinen kaum als eine Alternative zum vertrauten Wohnumfeld angesehen. Diese breite Ablehnung des Wohnens im Altenheim steht in Zusammenhang mit negativ besetzten Assoziationen, wie z.B. Sterbeeinrichtung, Endstation, Einbahnstraße/ Sackgasse, Heime sind Tatorte, Autonomieverlust, Armut und Einsamkeit. Die Resistenz dieser Vorstellungen ist trotz erheblicher Verbesserungen und Humanisierungen des stationären Sektors hoch.
Die positiven Slogans überzeugen trotz aufwendiger Werbung weniger („Geborgenheit in Freiheit") „Wenn man einen solchen Schritt erwägt, soll man ihn so früh wie möglich tun ... Du schließt deine Wohnung zu und verreist. Du kannst Deine Gäste im Hause unterbringen. Es gibt keinen Ärger mit Strom und Heizung und allem andren Kram, den Du zu Hause hattest." (H. Albertz)
Die Wahrnehmung von stationären Altenpflegeeinrichtungen als „totale Institutionen", in denen der Alte als „Opfer der Institution" beschrieben wird, führte zu einer radikalen Institutionenkritik. Der Ausgrenzungscharakter von stationären Pflegeeinrichtungen wurde kritischer wahrgenommen und über gemeinwesen- und teamorientierte Pflegekonzepte eine alternative Orientierung entworfen
Soweit Institutionen nicht durch offene Formen wie ambulante bzw. familiäre Pflege ersetzt werden können, sollen geschlossene Einrichtungen humanisiert und geöffnet werden. Die Kritik richtet sich gegen den Typ von Organisationen, welche die individuell gewachsenen Lebensbedürfnisse der Pflegebedürftigen vernachlässigt bzw. negiert. In diesem Sinne geht es um einen Abschied von einer bestimmten Art des Heimes. Alten- und Pflegeheime sollen aus dieser Sicht eher bewohnbare Lebensorte als funktionell starr organisierte Anstalten sein. Die theoretische Abkehr vom Leitbild des Krankenhauses wird vollzogen. Die innere Reformierung stationärer Pflegeeinrichtungen drückte sich in allgemeiner Weise im 1974 verabschiedeten Heimgesetz aus. Die Kritik an funktionellen, dem Krankenhaus ähnelnden Unterbringungsformen, hat in den siebziger Jahren zu spürbaren baulichen Verbesserungen in stationären Altenpflegeeinrichtungen geführt. Eine stärkere Orientierung an wohnähnlichen Unterbringungsfor-
[Seite der Druckausg.: 21]
men spiegelte sich u.a. in dem vom Bund geförderten Ausbau von Ein- bzw. Zweibettzimmern wieder.
In der Tendenz wächst der Anteil Schwerstpflegebedürftiger sowohl im stationären als auch im ambulanten Pflegebereich. Das Heim als Sterbeeinrichtung ist nicht nur ein traditionell geprägtes Stereotyp, sondern spiegelt treffend die Realität stationärer Pflege wider. Der Medizinalisierung des Pflegeheims wird in der gegenwärtigen Entwicklung erneut Vorschub geleistet. Die Tendenz zum „kleinen Krankenhaus" ergibt sich aus der Strukturorientierung des Pflegesektors. Im Zuge des Pflegeversicherungsgesetzes wird primär auf eine familiäre bzw. ambulante Hilfe orientiert. Die Vermeidung stationärer Pflege steht im Vordergrund. Die Tendenz, daß vorrangig Schwerstpflegebedürftige im Pflegeheim bzw. im Krankenhaus betreut werden müssen, welche dort nach relativ kurzer Verweildauer sterben, führt zur Konsolidierung der „medizinischen Ideologie des Pflegeheims".
Eine einseitige Verteufelung der außerhäuslichen Pflege bzw. komplementär dazu eine Heroisierung der häuslichen Pflege ist unangebracht. Bezogen auf die häusliche bzw. familiäre Pflege kann das Dogma einer Vermeidung von stationärer Pflege um jeden Preis zu Abhängigkeiten und sozialer Isolierung von pflegenden Angehörigen führen.
Alte Menschen lassen sich nicht in eine homogene Gruppen- und Altersstruktur pressen. Neben demographischen Entwicklungen sind soziostrukturelle Entwicklungen ebenso bedeutsam. Altersdiskussionen werden sowohl durch quantitative als auch qualitative Diskussionen geprägt. Alterseinteilungen und Altersbegriffe haben sich strukturell geöffnet (dreifaches Alter, negatives/positives Alter, politisches-, soziales-, biologisches Alter, zwei deutsche Alter: ostdeutsches/westdeutsches Alter, traditionelles/modernes Alter, Alterslast/Alterskapital, normativ vorgegebenes Alter, erfolgreich, gut, optimal usw.), was auch zu einer gewissen Diffusität geführt hat. Auf einige wichtige Differenzierungen, insbesondere des neuen Alters in West- und Ostdeutschland, werde ich vordergründig nicht eingehen können. Bezogen auf die Phänomene Pflege- und Hilfebedürftigkeit sollen andere Schwerpunkte gesetzt werden.
[Seite der Druckausg.: 22]
Welche Altersphasen und Gruppen im besonderen Maße Hilfe und Unterstützung benötigen, läßt sich aus einer demographischen und soziologischen Annäherung heraus ausschnittweise darstellen. Die Inblicknahme unterschiedlicher Altersphänomene und Lebenslagen ist notwendig, um Differenzierungen und Prioritäten in der Altenhilfepolitik zu setzen. Entlang eines demokratisch fundierten Gerechtigkeitsansatzes könnten mit Hilfe solcher Analysen soziale Ungleichheiten ausgeglichen werden.
Daß Gesundheitsrisiken sozial unterschiedlich verteilt sind und sich im Alter verstärken können, wird in einem von der europäischen Union herausgegebenen „Weißbuch" zur europäischen Sozialpolitik ausdrücklich hervorgehoben. Dort finden sich Empfehlungen für eine Gemeinschaftscharta der Grundrechte älterer Menschen. In den Empfehlungen werden die „...besonderen Bedürfnisse von Ausländern (Zuwanderer), ethnischen Gruppierungen, älteren Frauen und hilfebedürftigen alten Menschen..." in der Sozialpolitik hervorgehoben.
Der größte Teil der älteren Menschen ist in der Lage, weitgehend selbständig, d.h. auch ohne Hilfe von Bezugspersonen und Fremden, sein Leben zu meistern. Eine im Auftrag des Bundesministeriums für Familie und Senioren 1993 von Infratest durchgeführte Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: 3.216.000 Menschen, das sind 4,1 % der Bevölkerung, haben einen Hilfebedarf im weiteren Sinne. Insgesamt sind in Deutschland 1.650.000 Menschen (etwa 2% der Bevölkerung) auf Pflege angewiesen. Davon werden 1.200.000 zu Hause oder in der Familie gepflegt. Etwa 20 % der Altersgruppe älter als 80 Jahre sind pflegebedürftig.
Unter den 60- bis 80-Jährigen sind etwa 5 % pflegebedürftig. Die unter 60-Jährigen fallen in der Kategorie der Pflegebedürftigen quantitativ betrachtet kaum ins Gewicht (0,5 %).
Hochaltrigkeit wird in den nächsten Jahrzehnten deutlich zunehmen (steigende Lebenserwartung). Gerade für diese Altersgruppe kann von einem zunehmenden Dienstleistungsbedarf in den Bereichen Selbständigkeitsförderung, Hilfen beim Alltagsmanagement und pflegerische Versorgung ausgegangen werden. Prognostiziert wird eine ansteigende Zahl von
[Seite der Druckausg.: 23]
Pflegebedürftigen. Oberhalb der durchschnittlichen Lebenserwartung werden die gewonnenen Jahre zunehmend zur Last. Der Schweregrad von Alterspflegebedürftigkeit nimmt, wenn sie erst aufgetreten ist, tendenziell zu. Insbesondere bei Hochaltrigen ist eine Wandlung des Krankheitspanoramas (z.B. Chronifizierung und Multimorbidität) zu erwarten, verbunden mit typischen Alterskrankheiten (z.B. Altersdemenz/Alzheimer, Apoplex u.a.). In diesem Sinne entstehen bei Hochaltrigen Bedarfslagen, auf die der Altenhilfesektor differenziert reagieren muß.
Beim Umgang mit Krankheit und Pflegebedürftigkeit spielen Angehörige eine zentrale Rolle. Entscheidend für die weitere Lebensgestaltung beim Auftreten gesundheitsbedingter Beeinträchtigungen ist nicht das Lebensalter, sondern letzlich das Vorhandensein oder Fehlen von Familienmitgliedern im Haushalt, im selben Haus oder in der näheren Wohnumgebung.
Die Hauptpflegepersonen sind zu rund drei Viertel Frauen zumeist (in der Reihenfolge) Ehefrauen, Töchter, Schwiegertöchter. Ein wachsender Anteil der Frauen (mittlere und höhere Jahrgänge) ist berufstätig, d.h. gerade für diese Frauen entstehen z.T. schwierige Doppelbelastungen. Nur noch 27 % aller Beschäftigten haben „normale" Arbeitszeiten. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit nimmt zu: Wochenend-, Schichtarbeit, „normale" verlängerte Arbeitszeit (Überstunden), Arbeit auf Abruf, Kurzarbeit.
Diese Flexibilität ist durchaus ambivalent zu betrachten, einerseits können dadurch bestimmte familiäre und kulturelle Systeme abgestützt werden, d.h. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird erleichtert, andererseits können diese Strukturen den Aufbau kontinuierlicher Beziehungen beeinträchtigen bzw. sogar verhindern.
Eine Vielzahl von Frauen gehören zur „Sandwich-Generation", d.h. die Pflichten gegenüber den eigenen Kindern sind beendet, aber es beginnen die neuen Pflichten gegenüber den Eltern und Schwiegereltern. Diese Situation ist für die pflegende Angehörige auch mit Einschränkungen verbunden. Fragen des beruflichen Aus- und Wiedereinstieges, der Auf- und Ausbau einer eigenständigen sozialen Sicherung werden relevant. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt ein thematischer Dauerbrenner. In diesem Thema steckt eine besondere Virulenz, sowohl interfamiliärer
[Seite der Druckausg.: 24]
(moralischer Erwartungsdruck, Beteiligung anderer Familienmitglieder/ männlicher Familienangehöriger usw.) als auch sozialpolitischer Art (Arbeitszeiten/Teilarbeitszeit, Lücken im Versicherungsverlauf: diskontinuierliche statt kontinuierlicher Versicherungsverläufe durch Kinder- und Elternpflege u.a.).
Familienstrukturen ändern sich. Die Kinder von sehr alten Menschen („Hochaltrige") sind z.T. bereits selbst alt. Dadurch entstehen auch differenziertere Hilfemuster. Die Formen des Zusammenlebens werden tendenziell auch im Alter flexibler. Das Scheidungsrisiko steigt auch bei langjährig stabilen Ehen deutlich an, d.h. alt werden muß nicht bedeuten, zusammen alt zu werden. Auf eine vereinfachte Formel gebracht steigt mit steigender Lebenserwartung auch das Scheidungsrisiko. Langfristig verändert sich auch die Familienstruktur von Älteren (wachsender Anteil von Geschiedenen, Verwitweten, Nichtverheirateten). Perspektivisch wird der Anteil von Menschen über 60 Jahre, die kinderlos sind und außerhalb einer Kernfamilie leben, steigen. Die sich stärker in das Blickfeld schiebende Trennungs-und Scheidungsproblematik ist ein Indikator für die sich verändernde soziale Struktur der Familie und somit auch des (zukünftigen) Alters. In diesem Sinne gibt es neben der traditionellen Singularisierung (längere Lebenserwartung der Frauen, Weltkriegswitwen ohne Kinder u.a.) auch eine moderne Variante der Singularisierung (z.B. mehr Paare ohne Kinder bzw. Ein- Kind Familien, Alleinerziehende, nichteheliche Lebensgemeinschaften mit begrenzter Dauer/Lebensabschnittsgefährte). Aus diesen - mit Individualisierung und Pluralisierung umschriebenen - Familienentwicklungen konstituiert sich das familiäre Bild der „Teilzeitgemeinschaften". Gerade diese Gruppen von Menschen werden zunehmend auf externe soziale Leistungen angewiesen sein, d.h. ältere Alleinstehende werden zur wachsenden Zielgruppe sozialer Dienstleistungen.
Verwandtschaftsverhältnisse sind als „Brennpunkte des Vertrauens" auch weiterhin von erheblicher Bedeutung, aber in der Breite betrachtet nicht mehr Träger inniger sozialer Beziehungen. Die angenommene familiäre Innigkeit weicht in modernen Familienstrukturen einer stärkeren „Intimität auf Abstand". Die innere Nähe stellt sich eher aus der Distanz her, d.h. die „Gemütsansprüche" in der Familie setzen eher funktionelle Neutralisierungen voraus als ein Geflecht aufeinander abgestimmter Aufgaben in der
[Seite der Druckausg.: 25]
Familie. Auf Dauer scheint die Familie bei einer kontinuierlichen und aufwendigen Hilfeleistung gegenüber ihren pflegebedürftigen Angehörigen institutionell überlastet. In diesen Lebenslagen erfordern die Hilfeleistungen von den einzelnen Familienmitgliedern einen erheblichen „Opfersinn". Die insbesondere für Frauen entstehende Spannung zwischen kulturell tradierter Opferrolle und dem Recht auf Eigenleben auszubalancieren, ist sowohl von passenden Fremdhilfen als auch von innerfamiliären Erwartungen und Kooperationen abhängig.
Eine solche Entwicklung kann nicht als ein allgemeiner Niedergang der Familie verstanden werden. Daß auf traditionelle Versorgungszusammenhänge immer weniger zurückgegriffen werden kann, scheint nur bedingt richtig zu sein. In der Regel werden traditionelle familiäre Hilfemuster in der Pflege nach wie vor aktiviert. Die Erwartung, daß die Angehörigen die Pflege hauptsächlich tragen, ist mehr oder weniger stark verinnerlicht und wird bei eintretender Bedürftigkeit auch wirksam. Die Familie ist im traditionellen Rollenleitbild vor allem der Zuständigkeitsbereich der Frau. Bei allen Aufweichungen wirken private Rollenzuweisungen gegenüber Frauen („Dasein für andere") noch sehr stark.
Ein etabliertes Betrachtungsmuster ist die Vorstellung, daß soziale Dienstleistungen einen Ersatz für nicht mehr ausreichende bzw. fehlende familiäre (informelle) Unterstützung sind. Stellvertretend für diese Auffassung steht das von Cantor (1979) entwickelte „hierarchische Kompensationsmodell". Dieses Modell geht von einer Rangfolge von Hilfeleistungen aus. Nach diesem Modell ist in erster Instanz der Betroffene selbst bzw. die Kernfamilie verantwortlich. Erst in letzter Verantwortung greifen formelle Unterstützungssysteme wie medizinische bzw. soziale Dienste. Dieses Modell knüpft an kulturell gewachsene gesellschaftliche Leitbilder an. Die gegenüber der Familie bestehenden Außenerwartungen treffen sich mit den internen Familienerwartungen. Untersuchungen zeigen, daß der Ehepartner bzw. die eigenen Kinder die primären Unterstützungsressourcen für hilfe- und pflegebedürftige alte Menschen darstellen. Formelle Hilfen von außen anzunehmen, wenn zumindest formal gesehen intakte familiäre Unterstützungsressourcen bestehen, gilt familienintern häufig als Makel bzw. Tabubruch. Der Solidarität innerhalb der Familie, gerade in Krisensituationen (z.B. der Eintritt von Pflegebedürftigkeit bzw. zunehmende
[Seite der Druckausg.: 26]
Hilfebedürftigkeit), wird gegenüber einer Fremdhilfe von außen der Vorzug gegeben.
Die konzeptionelle Beschreibung von sowohl traditionellen als auch modernen Familienentwicklungen kann dazu führen, differenzierte Strategien für unterschiedliche Familienformen zu entwickeln. Insbesondere die Frage, welche Möglichkeiten jenseits der traditionellen Familienpflege zur Unterstützung und Betreuung bestehen bzw. wie diese weiter entwickelt werden müssen, wenn die alten Unterstützungsmuster nicht mehr funktionieren, bleibt perspektivisch gesehen brisant.
„Es geht in der Pflegeversicherung nicht um die alte Geldverteilungsmaschine, sondern um eine neue Stütze für eine Sozialkultur, in der die Generationen beieinandergehalten werden und so die Gesellschaft vor einer allgemeinen Verheimung geschützt wird. Deshalb muß eine Pflegeversicherung mit einer ambulanten Infrastruktur beginnen. Tagespflege, Kurzzeitpflege, ambulante hauswirtschaftliche Dienste, Sozialstationen, Not-rufeinrichtungen helfen den Menschen, die vertrauten vier Wände so lange wie möglich zu erhalten." (Norbert Blüm in der FAZ v. 22.04.1992).
Das PVG präsentiert sich nach einer etwa zwanzigjährigen Diskussion als eine versicherungsrechtliche Leistung, die bei eintretender Pflegebedürftigkeit eine Lebensrisikoversicherung des Hilfebedürftigen darstellen soll. Diese Grundsicherung bei Pflegebedürftigkeit soll über ein abgestuftes und hochstandardisiertes Leistungssystem sichergestellt werden. Jeder Pflegebedürftige erhält ungeachtet seiner Vermögens- und Einkommenssituation die gleichen Leistungen. Ergänzende Leistungen, sei es im Rahmen privater Absicherungen als auch über Leistungen anderer sozialer Sicherungssysteme (z.B. gesetzliche Unfallversicherung, Beamtenversorgung, Sozialhilfe u.a.) sind auch nach Einführung des PVG notwendig.
Der im §14 SGB XI festgeschriebene Pflegebedürftigkeitsbegriff bezieht sich, in Anlehnung an den WHO-Gesundheitsbegriff, auf Personen, die körperlich, geistig und seelisch krank bzw. behindert sind. Diese benötigen bei den ATL (Aktivitäten des täglichen Lebens) dauerhaft bzw. für voraussichtlich mindestens sechs Monate im erheblichen oder höheren Maße Hilfe. Bei der Aufzählung der für die Anerkennung von Pflegebedürftigkeit
[Seite der Druckausg.: 27]
relevanten Krankheits- und Behinderungsgruppen sind primär körperliche Defizite maßgeblich. Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit orientiert sich ausschließlich an der Fähigkeit, täglich wiederkehrende Verrichtungen selbst ausüben zu können oder nicht. Pflegebedürftigkeit bezieht sich hauptsächlich auf Funktionsstörungen des Stütz- und Bewegungsapparates, der Sinnesorgane, des Zentralnervensystem und der inneren Organe (§ 14(1-3) SGB XI). Als Krankheiten bzw. Behinderungen werden auch endogene Psychosen, Neurosen und geistige Behinderungen ausdrücklich anerkannt (§14(3) SGB XI).
Die detaillierte Beschreibung von notwendigen Verrichtungen im Sinne des PVG (z.B. Einkaufen, Kochen, Waschen, Heizen etc.), die mit genauen Punktwerten von den Pflegediensten abgerechnet werden müssen, läßt individuelle Spielräume kaum zu. Die Verrichtungen des täglichen Lebens werden unter den Kategorien Mobilität, Hygiene, Ernährung, hauswirtschaftliche Versorgung und im weitesten Sinne Kommunikation zusammengefaßt. Obwohl kommunikative Bedürfnisse von Pflegebedürftigen anerkannt und bei der Pflege mit einbezogen werden sollen, finden diese bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit keine direkte Berücksichtigung. In der Begründung der Bundesregierung zum §14(4) SGB XI heißt es dazu: „Andere Bedarfsbereiche, z.B. Kommunikation, können keine eigenständige Berücksichtigung finden, da die Kommunikation für Gesunde, Kranke und Pflegebedürftige grundsätzlich in gleicher Weise notwendig und eine Abstufung daher nicht möglich ist".
Eine ähnliche Verengung wird im Bereich der Mobilität sichtbar. Diese explizit im §14 (4) SGB XI genannte Kategorie wird auf Verrichtungen im Zusammenhang mit Körperpflege, Ernährung, hauswirtschaftlicher Versorgung, Stehen und Treppensteigen u.a. eingegrenzt.
Das PVG bestimmt den Begriff der Pflegebedürftigkeit über eine dauerhafte und erhebliche Hilfebedürftigkeit. Ein kurzfristiger oder unterhalb von erheblicher Pflegebedürftigkeit liegender Pflegebedarf, wird bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nicht berücksichtigt. Eine Vielzahl von Pflegebedürftigen erreichen die niedrigste Pflegestufe I nicht und müssen somit auch weiterhin Leistungen im Rahmen des BSHG (§ 68) in Anspruch nehmen. Die weitreichenden Einschränkungen, welche für eine Bedürftig-
[Seite der Druckausg.: 28]
keit im Raster der Pflegestufe eins vorliegen müssen, führen zur Entstehung einer Versorgungslücke, unmittelbar vor Erreichen der niedrigsten Pflegestufe.
Eine weitere Versorgungslücke entsteht auch bei Schwerstpflegebedürftigen. Eine im Einzelfall kontinuierliche Versorgung ist insbesondere im ambulanten Bereich schwer möglich und müßte bei fehlenden materiellen und familiären Ressourcen durch die Sozialhilfe aufgefangen werden. Insbesondere Einkommensschwache werden bei schwerer Pflegebedürftigkeit und Überschreitung der vorgegebenen Pflegesachleistungen, im Rahmen der festgelegten Grenzen des § 36 SGB XI, schneller in stationäre Einrichtungen gedrängt. Kommunen können in diesen Fällen eine Ergänzung durch Sozialhilfeleistungen im ambulanten Bereich verweigern, wenn diese im Vergleich zur stationären Pflege unverhältnismäßig kostenintensiv sind. Wo die Grenzen liegen, wird nicht näher ausgeführt. Da stationäre Einrichtungen als geeignete und zumutbare Pflegeeinrichtungen gelten, wird der Vorrang einer häuslichen Pflege (§ 3 SGB XI) gegenüber einer stationären Versorgung nicht um jeden Preis aufrechterhalten.
Die in allen Pflegestufen festgeschriebene Vorrangigkeit des pflegerischen Aufwandes gegenüber der hauswirtschaftlichen Versorgung leuchtet nicht ohne weiteres ein. Häufig ist der hauswirtschaftliche Bedarf größer und eine Hilfe in diesem Bereich für die Aufrechterhaltung einer selbständigen Haushaltsführung bedeutsamer. Die grobe Dreiteilung der Pflegestufen berücksichtigt nicht ausreichend die individuellen Bedürfnislagen von Betroffenen.
Aus einer problematisierenden Darstellung des SGB XI heraus sollen einige ausgewählte Entwicklungs- und Reformperspektiven deutlich gemacht werden.
Im Bereich der Häuslichen Pflege stößt das PVG gerade dort auf hohe Zufriedenheit, wo Geldleistungen bezogen werden und Pflegebedürftige von in Haushalten lebenden Familienangehörigen (oder anderen Personen) unterstützt werden. Eine geringere Zufriedenheit besteht bei prekären Netzwerkkonstellationen, in denen der Bezug von Sachleistungen auch deutlicher hervortritt. In Bezug zu dem bereits andeutungsweise beschriebenen
[Seite der Druckausg.: 29]
Wandel von Familienstrukturen zeigt sich die Begrenztheit des PVG gerade dort, wo sie auf moderne Lebensverhältnisse stößt. Die positiven Effekte des PVG entfalten sich am ehesten in traditionellen Familienstrukturen (mehrere Kinder, Mehrpersonenhaushalt, geringe Scheidungsrate, lange Wohndauer usw.). In diesem Sinne stützt das PVG eher traditionelle Familienformen, während Pflegearrangements in modernen bzw. prekären Familienkonstellationen unzureichend und unflexibel bleiben. So vorteilhaft familiäres und freiwilliges Engagement auch für die Hilfebedürftigen möglicherweise sein kann, scheint der Rahmen für eine „neue Kultur des Helfens" unbefriedigend zu sein. Da ein Großteil der Pflege über die Familien der Pflegebedürftigen abgesichert wird, sind die finanziellen Leistungen für pflegende Angehörige zu gering. Das unzureichende Pflegegeld (§37 SGB XI) und die schmalen, von den Pflegekassen gezahlten Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige stellen keine ausreichende soziale Absicherung dar und machen bei der angespannten Arbeitsmarktsituation, mit unsicheren Erwerbsperspektiven, eine Entscheidung der Angehörigen zur Nächstenpflege zum Dilemma. Pflegende Angehörige sind oft ausgebrannt. Die enorme Belastung von Angehörigen bleibt weitgehend unsichtbar. Ob das unter Umständen bis zu „24-Stunden-Gefordertsein" durchgehalten werden kann, ist entscheidend dafür, ob Pflegebedürftige zu Hause betreut werden oder nicht. Aus diesen Erfahrungen heraus wird auch die Begleitung und „Pflege" der Angehörigen immer wichtiger.
Während die Reduzierung der Nettoausgaben bei den Sozialhilfeträgern für die Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen eingetreten ist, gelang die Herausführung von Hilfebedürftigen aus der Sozialhilfeabhängigkeit im Großen und Ganzen nicht. Grundsätzlich könnte in Anlehnung an Klie überlegt werden, ob die investive Objektförderung durch eine stärkere Subjektförderung ergänzt werden sollte. In diesem Sinne könnten z.B. Leistungen des PVG einkommensabhängiger gewährt und Leistungen für Einkommensschwache über das PVG erweitert werden. Insbesondere im vollstationären Bereich könnten somit mehr Pflegebedürftige von ergänzenden Leistungen der Sozialhilfe unabhängiger werden.
- Die enge und selektive Berücksichtigung und Ausgestaltung der „Verrichtungen des täglichen Lebens" bevorzugt auf der einen Seite
[Seite der Druckausg.: 30]
bestimmte Bedarfslagen, vernachlässigt aber auf der anderen Seite den spezifischen Bedarf in schwer typisierbaren Pflegesituationen. Die dadurch entstehende Spannung von typischen und weniger typischen Pflegesituationen ist für Betroffene diskriminierend. Die starre Verrechtlichung und Standardisierung von Pflegeleistungen kommen den subjektiven Entlastungserwartungen von pflegenden Angehörigen und Betroffenen nicht ausreichend genug entgegen. Die Gestaltungsoptionen für einen individuelleren Pflegemix sollten erweitert werden. Was als typischer und atypischer Hilfebedarf gelten kann oder nicht, muß stärker als bisher diskutiert werden. Insbesondere die Anerkennung des Hilfebedarfs bei vorliegenden psychischen Veränderungen (z.B. Demenz) ist in der Praxis völlig unzureichend. Die Begutachtungspraxis des MDK wird in der Pflege allgemein kritisiert, weil der Pflegebedarf bei psychischen Krankheiten nicht ausreichend ermittelt wird und es häufig zu niedrigen bzw. gar keinen Einstufungen kommt. Der „typische Hilfebedarf" von Dementen wird im SGB XI nur teilweise anerkannt. Das „Mehr" an sozialer Betreuung (hoher Stellenwert von kommunikativen Hilfen) insbesondere bei psychisch kranken/behinderten Menschen wird im Pflegebedürftigkeitsbegriff unzureichend berücksichtigt. Der starre Pflegebegriff und die daran anschließenden Pflegebedürftigkeitsrichtlinien sollten differenzierter ausgestaltet werden. Insbesondere Hilfen im Bereich der Mobilität und der Kommunikation müssen für spezifische Gruppen von Pflegebedürftigen ausgeweitet werden.
- Prozesse der Professionalisierung in der Pflege konnten nur zum Teil befördert werden. Die Ausweitung des Pflegemanagement mit Zielorientierungen, individuellen Pflegeplänen und einer Reklamation bestimmter Domänen für die Übernahme von Verrichtungen durch Pflegefachkräfte haben Professionalisierungseffekte ausgelöst. Die Durchsetzung professioneller Pflege über ausreichendes Fachpersonal sieht beispielsweise im stationären Pflegebereich einen Prozentsatz von 50 %, im Verhältnis von Fachkraft/Hilfskraft, vor. Diese Vorgabe kann in der Praxis flächendeckend bisher nicht erreicht werden.
- Ambivalent bleibt die starke Formalisierung und Regulierung der Pflege. Die z.T. rein formale Adaption von Regularien, Pflegeschritten und
[Seite der Druckausg.: 31]
Standards allein kann nicht der Maßstab für eine befriedigende Professionalisierungsentwicklung sein. Ein vertiefendes inhaltliches Qualitäts- und Prozeßpflegeverständnis hat sich bisher kaum entfalten können. Die Diskussion um Qualitätssicherung ist zu stark betriebswirtschaftlich dominiert. Das Versprechen von Leistungen nach dem anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse wird durch das Wirtschaftlichkeitsgebot eingeschränkt. Die Entwicklung und Sicherung von Pflegequalität bleibt unter sozialpflegerischen Gesichtspunkten defizitär. Das System von externer und interner Qualitätssicherung funktioniert sowohl quantitativ als auch qualitativ gesehen unzureichend. Es fehlt an abgestimmten Qualitätssicherungsmaßnahmen aller Beteiligten. Ohnehin bezieht sich das Berufsgruppenkonzept des SGB XI primär auf die Gruppe der Pflegenden. Andere Berufsgruppen (Hauswirtschaft, Soziale Arbeit, therapeutische Berufe) werden, trotz konzeptionell angestrebter interdisziplinärer Vernetzungs- und Kooperationsappelle, tendenziell ausgeklammert. Aufgaben der Beratung und des Care- und Casemanagement sollten im Sinne einer fachlich guten Pflege stärker als bisher interdisziplinär erfüllt werden.
- Das PVG folgt dem Konzept der Wettbewerbsneutralität und Marktöffnung. Regulierende infrastrukturelle Steuerungen sollen über die Investitionsförderung und Infrastrukturverantwortung der Länder erfolgen. Notwendig ist eine öffentliche Bedarfsplanung der pflegerischen Infrastruktur. Gezielte Evaluation und Beobachtung von Angebotsstrukturen sowie Formen einer öffentlichen Honorierung und qualitativen Würdigung funktionierenden Zusammenwirkens von Pflegehaushalten und Versorgungsdiensten sind notwendig, um die Marktmechanismen im Pflegesektor, entsprechend der Bedürfnisse von Betroffenen, besser steuern zu können.
- Die Stellung der Kommunen spielt eine zentrale Rolle bei der lokalen Sicherung der Kombination von informell erbrachten, freiwillig organisierten und sozialstaatlich finanzierten Hilfen. Eine neue Kultur des Helfens auf lokaler Ebene könnte auch mit Hilfe des PVG stärker gefördert werden. Der Bedeutung der Kommunen über die alleinige Nennung in § 8 SGB XI wird man nur unzureichend gerecht. Zu Lasten der Pflegekassen könnte den Kommunen ein deutlicher Auftrag bei der Planung,
[Seite der Druckausg.: 32]
Moderation und Koordination übertragen werden. Die verpflichtende Herstellung von Transparenz auf dem Pflegemarkt könnte bei der sinnvollen Inanspruchnahme von unterschiedlichen Hilfeleistungen eine wesentliche Rolle spielen. Über ein „integriertes Pflegeberatungskonzept" könnte die Transparenz von Dienstleistungen mit einer Vermittlung von Diensten bzw. über ein koordiniertes fallbezogenes Hilfesetting (Case-Management) implementiert werden.
- Die Charakterisierung des PVG als ein Grundsicherungs- und Zuschußmodell macht komplementäre Sicherungssysteme notwendig, die abgelehnte bzw. weitergehende Leistungen und Pflegeansprüche abfedern können. Die Erwartung, daß die Sozialhilfe abgelehnte Leistungen der Pflegeversicherung auffangen kann, relativiert sich angesichts eingeschränkter Sozialhilfeleistungen und wohlfahrtsstaatlicher Kürzungen. Nach Einführung des PVG gehen Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes den Leistungen des BSHG voran. Durch das subsidiäre Prinzip werden weitergehende Pflegeleistungen bzw. auch Leistungen zur Wiedereingliederungshilfe im Rahmen des BSHG nicht berührt (vgl. §13(3) SGB XI). Die Hilfe zur Pflege ist nach § 68 BSHG auch bei einfacher Pflegebedürftigkeit möglich.
- Ein erweiterter Altenhilfeanspruch läßt sich aus § 75 BSHG ableiten. In diesem wird der im PVG weitgehend nicht berücksichtigte Bedarf an kultureller und sozialer Teilhabe festgeschrieben. Die Partizipation am gesellschaftlichen Leben soll möglichst lange gesichert und die durch das Alter entstehenden Schwierigkeiten verhütet, überwunden und gemildert werden. Dieses ökologisch akzentuierte Ziel eines Lebens in der Gemeinschaft, in Beziehung zu Angehörigen und Freunden innerhalb der vertrauten Wohnumwelt orientiert auf ein Leben außerhalb von Institutionen. Der Erhalt eines außerhalb stationärer Einrichtungen der Altenhilfe selbständigen und nach Möglichkeit lebenswerten Lebens stellt eine wesentliche Intention der im § 75 BSHG formulierten Hilfsangebote dar. Im Rahmen des § 75(6) BSHG können auf Wunsch auch Betätigungsmöglichkeiten vermittelt werden. Die Betätigungsmöglichkeiten sollen den Wünschen und Bedürfnissen entgegenkommen und sowohl an Steckenpferde als auch an frühere berufliche Tätigkeiten anknüpfen. Eine Betätigung ist nicht nur als arbeitsnahe Tä-
[Seite der Druckausg.: 33]
tigkeit denkbar. Die unterstützende Hilfe bezieht sich auch auf die Förderung von sportlichen Betätigungsmöglichkeiten für alte Menschen. Die im § 75 BSHG darüber hinaus angebotenen prophylaktischen Maßnahmen zielen auf eine vorbereitende Auseinandersetzung mit dem Alter und dem damit potentiell verbundenen Risiko der Pflegebedürftigkeit. In diesem Kontext soll die Auseinandersetzung mit möglichen Altersproblemen sowie Lösungs- und Verarbeitungsansätze zur Überwindung bzw. Milderung dieser Schwierigkeiten im Vorfeld von Alter und Behinderung stimuliert werden. Welche Maßnahmen konkret damit gemeint sind, bleibt im § 75 (6/3) BSHG offen. In der Kommentierung von Schellhorn beziehen sie sich auf beratende, informierende bzw. aufklärende Hilfen gegenüber Personen, die als noch nicht offiziell alt gelten. Die im § 75 BSHG insbesondere im Absatz vier und fünf angedeuteten Maßnahmen sollen eine soziale und kulturelle Teilhabe älterer Menschen erhalten helfen. Entsprechende Maßnahmen können sich u.a. auf institutionell selbst organisierte Veranstaltungen, z.B. über bestehende kommunale Seniorenberatungsstellen, Seniorenkreativvereine, Altenclubs usw. beziehen.
- Die sozialgesetzlichen Voraussetzungen für eine partielle Ergänzung des PVG über das BSHG, insbesondere was den Bereich der psychosozialen Betreuung von Pflegebedürftigen betrifft, liegen z.T. vor. Allerdings sind auch hier Einschränkungen und Relativierungen angebracht. Trotz eines bestehenden Soll- Anspruches, welcher z.B. in den §§ 68 und 75 BSHG formuliert wird, können die anspruchsvollen Maßnahmen im umfassenden Sinne kaum voll umgesetzt werden. Angesichts der schwierigen finanziellen Lage der Kommunen sind die freiwilligen Leistungen des BSHG, aus denen sich die offene Altenarbeit weitgehend finanziert, radikal gekürzt worden. Ob diese Kürzungen über Modellprojekte von Bund und Land partiell kompensiert werden können bzw. optimistischer betrachtet zu einer neuen Dynamik im Altenhilfesektor führen, scheint fraglich zu sein. Die erwarteten Einsparungseffekte bei der Sozialhilfe durch die Einführung des PVG kommen nach erster Einschätzung nicht unbedingt der offenen Altenhilfe bzw. der Verbesserung psychosozialer Betreuung von Pflegebedürftigen zugute. Die Umsetzung der nach §§ 68 und 75 BSHG möglichen Maßnahmen erfordert einen relativ hohen personellen und organisatori-
[Seite der Druckausg.: 34]
schen Aufwand, um der Mehrzahl der potentiell Hilfebedürftigen bedarfsgerechte Hilfen und Angebote offensiv anbieten zu können. Die Mehrzahl der insbesondere im § 75 BSHG aufgelisteten Maßnahmen kommen vorrangig aktiven Senioren entgegen, welche noch nicht bzw. weniger schwer pflegebedürftig sind. In diesem Sinne bestimmen auch personale und soziale Kompetenzen von Alten die Auswahl und Nutzung von bedarfsgerechten Hilfsmöglichkeiten im Rahmen des BSHG.
Im Kontext einer Diskussion um ein sinnvolles und erfülltes Alter werden parallel zu dieser Debatte auch Diskussionen darüber geführt, inwieweit eine umfassende Bedürfnisbefriedigung oder die Verlängerung der Lebensdauer älterer Menschen nachfolgende Generationen unzumutbar belasten. Die problematisierende Wahrnehmung von Alten wird in Bezug zu begrenzten ökonomischen Ressourcen gesetzt. Die befürchteten Einschränkungen und Belastungen nachfolgender Generationen, durch die scheinbar überzogenen Ansprüche alter Menschen, werden z.T. einseitig überhöht. In diesem Kontext kommt es auch zu Neiddebatten bzw. sprachlichen Entgleisungen (z.B. Altersschwemme, Altersberg, Altenbombe, kollektive Fettlebe), welche das Generationsverhältnis zwischen Jungen und Alten übermäßig belasten und zu einer schleichenden Entsolidarisierung beitragen. Das in der Bevölkerung, trotz eines administrativ entfalteten positiven Altersbild und dem wachsenden Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft, etablierte negative Altersbild findet seine Passung und scheinbare Legitimation in ökonomischen Parametern.
Die Befriedigung eines Mangels unterliegt aus der ökonomischen Perspektive gesehen einem Effizienzparadigma. Mit einem Minimum an Mitteln soll unter den gegebenen Umständen ein maximaler Erfolg realisiert werden. Sind die „Bordmittel" begrenzt, d.h. der finanzielle Rahmen so eng, daß ein ausreichender Mitteleinsatz zur Befriedigung des Mangels nicht gegeben ist, kann maximal ein Basisbedarf befriedigt werden. Ohne einen linearen Bezug zur Pflegebedürftigkeit herstellen zu können, sind die Auswirkungen des finanziellen Deckelungsprinzips im PVG , insbesondere für finanziell Schwache und sozial isolierte Pflegebedürftige, restriktiv bedeutsam. So unterliegen im PVG die versicherungsrechtlichen Leistungen gegenüber den Pflegebedürftigen einem strengen Wirtschaftlichkeitsge-
[Seite der Druckausg.: 35]
bot. Die Leistungen sind nicht zwangsläufig bedarfsdeckend und dürfen im Wortlaut der gesetzlichen Vorschrift „...das Maß des Notwendigen nicht übersteigen." (§29 SGB XI). Die durch das Prinzip der Kostendeckelung begrenzten Abrechnungsmöglichkeiten der Leistungsanbieter im Pflegesektor erzeugen einen Effizienzdruck. Dadurch entsteht eine Tendenz zur Rekord- und Hauruckpflege. Nicht abrechenbare Leistungen werden zu Komfort- bzw. Zusatzleistungen, deren Befriedigung zwar wünschenswert, aber im erheblichen Maße von der Überschußmotivation der Pflegenden, dem ehrenamtlichen Engagement anderer und den finanziellen Möglichkeiten des Hilfebedürftigen selbst, abhängig ist.

Die über den Basisbedarf hinausgehenden Ansprüche können für den Typus des institutionell und finanziell abhängigen Pflegebedürftigen zum unbezahlbaren Luxus werden. Die marktwirtschaftliche Regulierung und Befriedigung von weitergehenden Bedürfnissen über kostenpflichtige Dienstleistungen kann Pflegebedürftige, welche auf einen solchen Markt angewiesen sind, sozial deklassieren (Polarität des Alters/arm und reich). Insbesondere bei geringer Kaufkraft und brüchigen familiären bzw. außer-
[Seite der Druckausg.: 36]
familiären Netzwerken können bei zunehmender Hilfs- und Pflegebedürftigkeit Einkommens- und Vermögensunterschiede zunehmen. In der Pflegephase kann es zu schwerwiegenden sozialen Ungleichheiten kommen.
Das Dilemma, einerseits produktiv und effizient pflegen zu müssen und andererseits eine an den Erwartungen und Bedürfnissen des Einzelnen orientierte Pflege durchzuführen, ist kaum auflösbar. Kundenbedürfnisse werden insbesondere in Zeiten knapper Kassen und fehlenden soziökonomischen Ressourcen der Betroffenen in sozialrechtlich anerkannte Bedarfslagen transformiert. Nutzerinteressen und Effizienzorientierungen stehen sich z.T. widersprüchlich gegenüber, d.h. die Differenzen zwischen angestrebten Zielen, gesetzlich garantierten Dienstleistungen und subjektiver Bedürfnisbefriedigung bleiben argumentativ bedeutsam.
Der im PVG formulierte Vorrang der häuslichen vor der stationären Pflege (§ 3 SGB XI) bzw. der sich durch das Gesetz ziehende Appell an die Selbstverantwortung bzw. Selbsthilfe der Versicherten (§ 8(2)SGB XI) kann auch mit einem ökonomischen Sinn unterlegt werden. Insbesondere in Zeiten rezessionsbedingter Haushaltskürzungen, gerade im Sozial- und Gesundheitssektor, erleben diese Selbsthilfeappelle einen tendenziellen Boom. Selbsthilfe- und Aktivierungsaufforderungen orientieren darauf, daß jede Familie und jeder Alte einen Beitrag leisten sollte, damit die Altenhilfe finanzierbar bleibt.
Der Hinweis, daß auch die ältere Generation stärker komplementäre Hilfen zwischen familiären und wohlfahrtsstaatlichen Hilfen übernehmen soll, ist nicht frei von ideologischen Nuancen. Ideologisch nuanciert deshalb, weil ein gesellschaftliches Drängen und Zuweisen, in Richtung eines gesellschaftlich nützlichen Ehrenamtes, auch vordergründig ökonomisch motiviert scheint. Der Appell für mehr Selbstverantwortung bzw. ehrenamtliches Engagement kann mit ökonomischen Rückzugsstrategien in der professionellen Altenhilfe in Verbindung gebracht werden. Die im Zusammenhang mit Modellprojekten des Bundesministerium für Familie und Senioren (z.B. Seniorenbeiräte, Seniorengenossenschaften, Seniorenbüros usw.) entwickelten Appelle propagieren auch ein freiwilliges Engagement von älteren Bürgern selbst. Bürgerschaftliches Engagement bzw. ökono-
[Seite der Druckausg.: 37]
misch formuliert „intragenerationelle Produktivitätspotentiale" werden stärker eingefordert.
Bei vielen Alten, die zum Teil gerade erst lebenslangen Verpflichtungen entronnen sind oder brachial aus dem Arbeitsmarkt herausgerissen wurden, lösen diese Appelle eher Widerstände aus. Die berufliche Herausdrängung älterer Arbeitnehmer aus dem Arbeitsmarkt paßt mit den gesellschaftlichen Wiederverpflichtungsappellen schwer zusammen. Das administrative Vorgeben von Lebenssinn, über ein ehrenamtliches Engagement für andere, erscheint zu inszeniert. Der Austauschcharakter zwischen den Generationen wird immer von einem ungleichgewichtigen Verhältnis von Geben und Nehmen bestimmt sein. Hier muß es eine natürliche Solidarität zwischen den Generationen geben. Im Kern zeigt die Diskussion um die Produktivitätspotentiale auch eine bedenkliche ethische Kehrseite. Eine aggressive Produktivitätseinforderung bzw. Wiederverpflichtung zu einem gesellschaftlich nützlichen Engagement der Älteren kann zu einer Polarisierung beitragen, in der „unproduktive Alte" gesellschaftlich an den Rand gedrängt bzw. ältere Menschen zunehmend unter Rechtfertigungs- und Legitimationszwänge geraten. Man sollte die gesellschaftlich klimatischen Irritationen einer ökonomisch intendierten Produktivitäts- und Leistungsdiskussion nicht unterschätzen. Die Beherrschung des Generationsverhältnisses basiert auf einer intergenerativen Solidarität ohne überdehnte administrative Aufforderungs- und Verpflichtungspostulate. Die durch die Lebensleistung erworbenen Ansprüche auf ein entsprechendes Alterseinkommen müssen nicht ein zweites Mal über gesellschaftlich nützliche Arbeit verdient werden. Bei denen, die aus unterschiedlichen Gründen diese Ansprüche nicht in ausreichender Weise erwerben konnten, wirken diese Aufforderungen ohnehin zynisch.
Durch das SGB XI sind Marktelemente in die Pflege eingeführt worden. Es ist kein konsequent realisiertes Marktmodell, aber der Pflegebedürftige hat die Freiheit der Wahl zwischen unterschiedlichen Diensten und Einrichtungen. Der ausgelöste Anbieterwettbewerb ist gewollt. Durch die auch im PVG festgeschriebene Pluralität von Diensten wird der Trend zum Wettbewerb stimuliert. Eine streng bedarfsorientierte Zulassung von Diensten ist im SGB XI nicht vorgesehen. Der bedarfsunabhängige Zulassungsanspruch ist geradezu radikal für das Sozialleistungsrecht. Hintergrund
[Seite der Druckausg.: 38]
dieser Marktöffnung ist (war) die angestrebte Forcierung der Infrastrukturentwicklung in der Pflege. Im Kontext dieser Marktorientierung wird auch der „Graue Markt" (nicht zugelassene Anbieter, selbstbeschaffte Pflegekräfte) gefördert. Es entsteht eine Konkurrenz zweier Märkte. Professionelle Pflegefachkräfte und zugelassene Dienste stehen unter stärkerem Legitimationsdruck, d.h. sie müssen den Hilfe- und Pflegebedürftigen davon überzeugen, daß sie eine qualitativ bessere Pflege bieten können als Nichtfachkräfte bzw. nicht zugelassene Dienste. Die noch junge Professionalisierungsentwicklung und fachliche Anerkennung von professionell Pflegenden, insbesondere in der Altenpflege, wird durch diese Marktorientierung nach den bisherigen Erfahrungen nicht befördert.
Ein Hintergrund der begrifflichen Etablierung der Kundenperspektive in der sozialpflegerischen Arbeit sind zunehmend stärker einfließende ökonomische Diskurse. Der sich in fast allen Bereichen der Gesellschaft forcierende Rationalisierungsdruck wird auch in den unterschiedlichen Bereichen des Pflegesektors deutlich. Die in der Privatwirtschaft verankerten Managementkonzepte (New Public Management, Social Management, Lean Management usw.) werden z.T. auch auf Non-Profit-Organisationen übertragen. Modernes Managementdenken hat Einzug gehalten in soziale Unternehmen und mit ihnen in die Leitbilddiskussion.
Kaum ein Träger bzw. Dienstleistungsanbieter im Pflegesektor verzichtet in seinen konzeptionellen Leitlinien auf die Kundenorientierung. Verwandt mit den hier nicht weiter entfaltbaren Managementkonzepten ist die Diskussion um die Sicherung der Pflegequalität. Nach den Vereinbarungen gemäß § 80 SGB XI zur Qualitätssicherung besteht eine explizite Orientierung an den Bedürfnissen der Adressaten und ihrer Zufriedenheit. Das Primat der Kundenzufriedenheit hat in der Qualitätssicherungsdiskussion Konjunktur. Die rhetorische Etablierung des Begriffes kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß Qualitätssicherungsansätze nur begrenzt kundenorientiert sind. Allgemeine Handlungs- bzw. Strukturstandards sowie notwendige Kostenbegrenzungen stehen zumeist im Vordergrund. Die sich etablierende Kundenorientierung ist Ausdruck eines Paradigmenwechsels. Der begriffliche Wechsel vom „Patient-Klient-Kunde-Bürger" steht in Beziehung zu einer Entwicklung, die sich auch in entsprechenden Rahmenbedingungen niedergeschlagen hat.
[Seite der Druckausg.: 39]
Das in diesen Leitbildbegriffen durchschimmernde Rollenverständnis kann bei der Charakterisierung von Lebenslagen älteren Menschen nützlich sein. Entlang dieses vielschichtigen Rollenverständnisses lassen sich Handlungen, Konzepte und Dienstleistungen entwickeln, die Konnotationen zu unterschiedlichen Diskursen (politisch, ökonomisch, juristisch usw.) möglich machen. Eine ausschließliche Orientierung am Kundenparadigma verengt die Dimensionen von Altenarbeit. Für die zukünftige Altenarbeit ist die Weisheit dieses Begriffes begrenzt.
Das in der Kundenorientierung zum Ausdruck kommende Marktmodell, welches von einer relativ souveränen Beziehung von Leistungsnachfrager und Leistungsanbieter ausgeht, kontrastiert mit der eingeschränkten Konsumentensouveränität vieler Pflegebedürftiger. Die Fähigkeit, sich auf dem Angebotsmarkt souverän zu bewegen und soziale Dienstleistungen adäquat einzukaufen, entspricht einem idealisierten Kundenbild, das weder mit der Situation von Hilfe- und Pflegebedürftigen noch mit dem Charakter einer sozialen Dienstleistung in Übereinstimmung zu bringen ist. Soziale Dienstleistungen sind keine Konsumgüter, die man miteinander vergleichen und bewerten kann. Pflege- und Hilfebedürftige befinden sich in einer Situation der Abhängigkeit, d.h. es besteht ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Helfern und Hilfesuchenden. Ein individueller Aushandlungsprozeß scheitert teilweise an der Hinfälligkeit des Klienten.
Der unproduktive Charakter von Altenpflege und die z.T. fehlende Kundensouveränität von Hilfebedürftigen schafft eine besondere Sensibilität, gerade in Bezug auf überzogene Rationalisierungstendenzen. Der Pflegemarkt muß somit auch aus ethischen Gründen extern kontrolliert werden. Die dafür bestehenden Möglichkeiten, z.B. über den MDK, Qualitätssicherungsstellen in Ämtern, Heimaufsicht, Pflegekonferenzen (siehe Modellprojekte), einrichtungsübergreifende Qualitätszirkel, sind unzureichend (vgl. auch § 80 SGB XI/Qualität u. Qualitätssicherung). Flankierende Formen des Patientenschutzes über Selbsthilfegruppierungen von Betroffenen bzw. Angehörigen, über Verbraucherverbände/Verbraucherzentralen, Selbstkontrolle und Transparenz der Anbieter u.a. sind bisher kaum sichtbar. In diesem Sinne erscheinen die Implikationen einer positiv besetzten Anbietervielfalt im Pflegebereich überbetont.
[Seite der Druckausg.: 40]
AUSGEWÄHLTE INSTITUTIONELLE HILFEN UND ANGEBOTE (Wohnen, Mobile Soziale Dienste und soziale Altenarbeit):
- Aus der Skizzierung von Entwicklungslinien, institutionellen Verankerungen und Problemschwerpunkten heraus möchte ich einige institutionelle Hilfen und Angebote kurz darstellen. Die Verknüpfung von Angebotsstrukturen und potentiellen Problem- bzw. Zielgruppen der Altenhilfe bleibt dabei maßgeblich. Die primäre Orientierung an der weitgehend unabhängigen und selbständigen Lebensführung von Hilfe- und Pflegebedürftigen prägt das Aufgaben- und Angebotsspektrum sozialpflegerischer Dienste in der Altenhilfe. Entlang dieses Paradigmas werden u.a. folgende Zielvorstellungen formuliert
- Erhaltung des gewohnten Umfeldes (Wohn- und Sozialumfeld)
- Sicherung der wirtschaftlichen Lebensgrundlage durch ein ausreichendes Einkommen (Rente, Pension, Sozialhilfe)
- Sicherung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Ausbau der Gesundheitsvorsorge in den Bereichen Prävention, Therapie, Rehabilitation
- Bereitstellung geeigneter Einrichtungen für Menschen, die in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt sind
- Sterbebegleitung in angemessener Umgebung, um menschenwürdiges Sterben zu ermöglichen
Die vertraute Umgebung wird als ein wesentlicher Faktor angesehen, der auf die psychische und körperliche Situation stabilisierend wirkt. Die große Mehrheit (etwa 73 %) der befragten Deutschen zieht eine eigene Wohnung als Alterssitz vor. Da der Anteil an Wohneigentum (Eigentumswohnungen, Häuser) in den alten Bundesländern hoch ist (etwa 45 %) dominiert der Wunsch, im eigenen Domizil bis zum Tode bleiben zu wollen. Aber auch unabhängig von der Eigentumsfrage dominiert das Bewußtsein, das vertraute Wohn- und Sozialumfeld nicht verlassen zu wollen.
Die Wohnbedingungen älterer Menschen ändern sich. Der angedeutete Wandel von Familienstrukturen spiegelt sich auch in den Wohnformen
[Seite der Druckausg.: 41]
wieder. Die stärkere Inanspruchnahme ambulanter Dienstleistungen resultiert u.a. auch aus der zunehmenden Verweildauer Älterer in der eigenen Wohnung. In den Großstädten leben heute schon 40 % der über 65-Jährigen allein (Singularisierungstrend), 80% davon sind Frauen (Feminisierung). Der Bedarf an unterstützenden Hilfen bei der alltäglichen Lebensführung ist relativ groß. Rund ein Viertel der Männer und etwa sieben Prozent der Frauen über 80 Jahre sind, was die Verrichtungen des Alltags betrifft, erheblich eingeschränkt, d.h. benötigen jemanden, der häusliche Tätigkeiten arbeitsteilig übernimmt bzw. übernehmen könnte.
Aus diesen Entwicklungstendenzen und Orientierungen heraus entwickeln sich entsprechende Wohnangebote/Wohnformen. Die Unterstützung des selbständigen Wohnens durch altengerechte Wohnungen, Modernisierung der eigenen Wohnung und Wohnraumanpassung bei Behinderung, Wohngemeinschaften, Wohnberatung, Entlastung bei den Aufgaben der Haushaltsführung, Mahlzeiten-, Einkaufs- und Putzdienste, Hilfe im Krankheitsfall durch häusliche Pflege u.a. hat zu einer rasanten Entwicklung von wohnbegleitenden Dienstleistungen geführt.
Die traditionelle pflegerische Versorgungsstruktur wird durch privatwirt-schaftliche, sich staatlichen Regulierungen weitgehend entziehende Angebote verändert. Da die Einkommens- und Vermögenssituation vor allem in westdeutschen Haushalten als bedeutend eingeschätzt wird, entwickeln sich Dienstleistungsangebote, die sich parallel zu sozialstaatlichen Angeboten etablieren.
Im Zweiten Altenbericht der Bundesregierung zum Thema: „Wohnen im Alter" wird der Ausbau dieser Sonderwohnform nachdrücklich empfohlen. Die Weiterentwicklung dieser Wohn- und Betreuungsform in enger Zusammenwirkung mit ambulanten Dienstleistern der Altenhilfe wird zur „...wesentlichen Zielrichtung der Politik für das Wohnen im Alter..." (Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der Sachverständigenkommission). Das Betreute Wohnen, z.T. auch als Service-Wohnen bezeichnet, bezieht sich sowohl auf betreute Wohnanlagen als auch auf betreutes Einzelwohnen. In der Regel wird der Mietvertrag mit einem Servicevertrag kombiniert, in dem sowohl Grundleistungen, die als Kostenpauschale in manchen Fällen auch vom Sozialamt übernommen werden können, als
[Seite der Druckausg.: 42]
auch Wahlleistungen enthalten sind, die zumeist privat finanziert werden müssen (in Ausnahmefällen auch Kassen- bzw. Sozialhilfefinanzierung möglich). Das sich rasant etablierende Konzept des „Betreuten Wohnen" wird von den Bewohnern unterschiedlich eingeschätzt. Einerseits können Heimeinweisungen abgewendet werden, Drehtür-Effekte und Feuerwehreinsätze vermieden und die Qualität der Dienstleistungen stabiler gesichert und kontrolliert werden, andererseits geht der Wohnhauscharakter bei verstärktem Betreuungsaufwand verloren. Ein hoher Anteil an Pflegebedürftigen schafft eine Heimatmosphäre.
Bei der Formulierung und Kontrolle von definierten baulichen Standards (z.B. nach Heimmindestbauverordnung) könnten Differenzierungen vorgegeben werden, die besonderen Pflegebedarfslagen entgegenkommen. Dabei geht es nicht um spezialisierte Wohnformen bzw. Ghettos, sondern um die architektonische Berücksichtigung unterschiedlicher Zielgruppen und deren Bedürfnisse im Sinne einer situativen Architektur. Die grundsätzliche Orientierung am Normalisierungsprinzip verweist auf individualisiertere Wohn- u. Betreuungskonzepte .
„Sozialstationen haben für den Erhalt einer selbständigen Lebensführung, für den längstmöglichen Verbleib in der gewohnten Umgebung, aber auch zur Entlastung und Unterstützung pflegender Familienangehöriger eine außerordentliche Bedeutung." (2. Landesaltenplan NRW 1991).
Sozialstationen haben sich in Westdeutschland seit den achtziger Jahren als maßgebliches Leistungsangebot in der Altenhilfe etabliert. Die weitreichenden Erfüllungshoffnungen standen ganz im Sinne einer „Rebellion gegen die stationäre Altenhilfe", haben sich aber auch aus Kostenersparnisgründen etablieren können. Sozialstationen gelten als Prototyp eines konzentrierten Pflegedienstes, d.h. einer Einrichtung, „...in der unterschiedliche Pflegeangebote organisatorisch, häufig auch örtlich zusammengefaßt und integriert sind." Für die Bereiche der ambulanten Kranken-, Alten-, und Familienpflege bestehen u.a. folgende Zielsetzungen:
- Kranke, behinderte, pflegebedürftige und alte Menschen in ihrer Wohnung zu betreuen, zu versorgen und in ihrer Selbständigkeit zu fördern
[Seite der Druckausg.: 43]
- Ärztliche Behandlung durch häusliche Pflege zu unterstützen
- Krankenhausaufenthalte verkürzen bzw. vermeiden
- Pflegeheimaufnahmen vermeiden bzw. verzögern
- Pflegende (Betreuende und Angehörige) zu beraten und sie mit praktischen und psychosozialen Hilfen zu unterstützen
- Pflege und Begleitung im häuslichen Bereich sicherzustellen.
Das Aufgaben- und Leistungsspektrum ist breit gefächert und umfaßt u.a. folgende Rahmenangebote:
- Kurse für häusliche Alten- und Krankenpflege (Vermittlung medizinischer und pflegerischer Kenntnisse)
- Gesprächskreis für pflegende Angehörige
- Ambulante Alten-, Kranken- und Familienpflege
- Leistungen der Krankenkasse: häusliche Krankenpflege und häusliche Pflegedienste (SGB V, §§ 37 u. 55)
- Leistungen nach SGB XI
Um eine umfassende Versorgung von Pflegebedürftigen sicherzustellen, wird auf die wichtige Vermittlerfunktion von Sozialstationen hingewiesen, durch die eine Kette von Hilfen geknüpft werden soll. Der Sozialstation kommt bei der Erkennung von Versorgungsdefiziten eine wichtige Rolle zu. Entlang entsprechender Zielkomplexe wie Prävention, Akutversorgung und Rehabilitation sollen Sozialstationen eine Vielzahl von Funktionen übernehmen. Diese Ansprüche umzusetzen ist nicht nur aufgrund von Dienstleistungslücken ein Problem. Die dafür notwendigen personellen und fachlichen Kompetenzen (z.B. über Sozialarbeiter) bestehen flächendeckend gesehen kaum.
Differenzierte Bedürfnisse und Lebenslagen von Hilfe- und Pflegebedürftigen treffen auf eine Pluralität von Anbietern und Angeboten. Die Kooperation zwischen diesen Anbietern ist defizitär, d.h. die Fragmentierung sozialer Dienste in der Bundesrepublik verhärtet sich. Viele Angebote und
[Seite der Druckausg.: 44]
Entwicklungen bleiben intransparent und lösen in ihrer unübersichtlichen Komplexität bei einer Vielzahl von Hilfe- und Pflegebedürftigen Unsicherheit aus. Aus dieser Situation heraus sind gegensteuernd immer wieder Vernetzungs- und Kooperationsbemühungen initiiert worden. Der Vernetzungsgedanke wurde über verschiedene Modellprojekte initial gefördert. So wurden z.B. in Nordrhein-Westfalen regionale Pflegekonferenzen erprobt, die sich dem Aufbau ortsnaher Versorgungsstrukturen widmen. In diesen Konferenzen sollen alle in den Hilfe- und Pflegeprozeß Involvierten (soziale Dienste, Vertreter der Betroffenen, Berufsverbände, Ärzte, Medizinischer Dienst, Sozialämter u.a.) sitzen. Diese Ansätze etablieren sich in der Breite betrachtet kaum.
Die Erfahrungen zeigen, daß im Kontrast zu integrativen und ganzheitlichen Leitbildern in der Altenhilfe die Altenhilfelandschaft eher zerrissen ist. Eine integrierte Dienstleistungslandschaft in der Altenpflege, in der eine individuell sinnvolle Ergänzung und Zuordnung von Diensten im Interesse des Hilfebedürftigen organisiert werden kann, skizziert eher eine visionäre Wunschvorstellung. Koordination und Vernetzung von Dienstleistungen orientieren sich weniger an sinnvollen Zuordnungen der Dienste als an der ökonomischen Effizienz von Leistungen sowie der Sicherung von Besitzständen der Dienstleistungsanbieter.
Soziale Arbeit stellt entlang der angedeuteten Verwerfungen und Lücken zwischen informellen und formellen Hilfen aus meiner Sicht eine wichtige Verbindung dar. Sie kann eine wichtige Mittler- und Übersetzerposition einnehmen. Gerade angesichts z.T. divergierender Ansprüche und Entwicklungen (Professionalisierungsdebatte, Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz im sozialen Sektor, Förderung einer neuen Kultur des Helfens) scheint es wichtig zu sein, entsprechend der jeweiligen individuellen Situation, Schnittstellen und Anschlüsse zwischen verschiedenen Hilfeformen herzustellen. Professionelle Hilfen sollen in das interaktive Geflecht zwischen Angehörigen und Pflegebedürftigen eingepaßt werden. Der Anspruch einer Vermittlung und Aktivierung von informellen und formellen bzw. zwischen professionellen und familiären Hilfen zielt auf ein Passungsverhältnis unterschiedlicher Hilfeformen. Die Bedeutung einer Vertrauensperson, die fallbezogen einen entsprechenden Hilfebedarf evaluiert und gemeinsam mit den Betroffenen einen Hilfeplan entwickelt, drängt
[Seite der Druckausg.: 45]
die Profession des Sozialarbeiters/Sozialpädagogen in eine zentrale Position. Aus den bereits dargestellten Akzentsetzungen in der Pflege dominieren körperbezogene und ökonomische Diskussionen. Diese Entwicklung ist ein Indiz dafür, daß sozialpädagogische Orientierungen eher in die Defensive geraten. Die Vision des interdisziplinären Unterstützungs- und Erschließungsmanagement ist weit weg von den gegenwärtigen Praktiken sozialer Arbeit.
Soziale Arbeit bei älteren Menschen bezieht sich im wesentlichen auf zwei Statuspassagen: Übergang ins Rentenalter und Hochaltrigkeit. Adressaten sind die sogenannten „neuen Alten" sowie Pflegebedürftige und deren Angehörige. Gefordert wird eine „neue Kultur der Hilfe"(vgl. §8(2) SGB XI) . Primäre Netzwerke sollen gestärkt und die Hilfen flexibel, individuell und bedarfsgerecht erbracht werden. Neue Positionierungen und Aufgaben der Sozialpädagogik/Sozialarbeit werden in den Bereichen Koordination, Vernetzung und Planung ambulanter Hilfen, Information und Beratung, psychosoziale Begleitung, Case-Management gesehen. Diese Veränderungen des Aufgabenspektrums hängen eng mit den Rahmenbedingungen des PVG zusammen.
Soziale Arbeit wird durch das PVG nicht oder nur im geringen Maße finanziell unterstützt. Sozialpflegerische Beratung und Vermittlung ist als integrierte Leistung vieler Einrichtungen und Dienste der Altenhilfe sowohl finanziell als auch fachlich nicht ausreichend verankert. Trotz ungünstiger gesetzlicher Rahmenbedingungen ist sie aber unverzichtbar. Sie stellt ein notwendiges kritisches Korrektiv zur Dominanz medizinischer und pflegerischer Sichtweisen dar.
Die Bedürfnisse pflegender Angehöriger bleiben weitgehend unsichtbar. Trotz sporadischer Selbsthilfeaktivitäten artikulieren sich pflegende Angehörige kaum öffentlich. Einerseits besteht eine schwerpunktmäßige Orientierung auf Familie und pflegende Angehörige, andererseits fehlen gerade im Vorfeld von anerkannter Pflegebedürftigkeit ein Mangel an Ansprechpartnern. Hilfe- und Pflegebedürftigkeit sowie eintretende Persönlichkeitsveränderungen des Kranken verlangen häufig eine tiefgreifende Umstellung gegenseitiger Erwartungen und Verpflichtungen innerhalb der Familie. Deren Perspektiven und Kontexte (Lebenssituation, sozialräumliche
[Seite der Druckausg.: 46]
Umgebung, Netzwerke etc.) sollen stärker als bisher durch eine zugehende soziale Arbeit erfaßt und moderiert werden.
Pflegende Angehörige wollen Entlastung in der Betreuung ihrer Hilfebedürftigen, aber nicht die Wegnahme der Verantwortung. In diesem Sinne wird auch die Spannung zwischen expertokratischem Wissen und Laienwissen problematisiert, d.h. Angehörige beugen sich nicht automatisch der fachlichen Einschätzung und Anordnung professioneller Helfer. Die Angebote sollen den Ton, die Erwartungen, die lebensweltlichen Erfahrungen und schichtspezifischen Hintergründe von Betroffenen berühren. Es geht um eine stärkere Zielgruppendifferenzierung (Ausländer, Demente, Bedürfnisse von Pflegeangehörigen). Aus den unterschiedlichsten Perspektiven sollen Wissensformen generiert und miteinander verknüpft werden. Der begleitende Charakter der Arbeit grenzt sich von reaktiven Interventionsmustern ab.
In Deutschland leben zur Zeit etwa eine halbe Million Menschen ausländischer Herkunft, die älter als 60 Jahre sind. Bis zum Jahr 2010 soll diese Zahl auf etwa 1,3 Millionen ansteigen. Daneben sei hier auch auf die große Anzahl von Aussiedlern aus Osteuropa hingewiesen Zwischen 1951-1988 sind etwa 1,5 Millionen Aussiedler nach Deutschland gekommen. Alt und Ausländer sein, kann zu einer doppelten Benachteiligung führen. Diskriminierende Elemente bei der Integration von Ausländern bestehen weiterhin. So liegen die Entwürfe für ein Antidiskriminierungsgesetz noch immer auf Eis. Die bestehenden Rechte bzw. der Rechtsschutz von Migranten sind unzureichend. Der rechtliche Status von Migranten hat u.a. Auswirkungen auf die Inanspruchnahme von Sozialleistungen. Die sozial-rechtliche Absicherung von Migranten und Aussiedlern bildet die essentielle Basis für die befriedigende psychosoziale Unterstützung und gesundheitlich-pflegerische Versorgung von ausländischen Mitbürgern.
Ein Teil der älteren Migranten und Aussiedler wird spätestens im Fall der Pflegebedürftigkeit auch auf professionelle Hilfe angewiesen sein, insbesondere dann, wenn die Pflege sehr umfangreich ist und die Angehörigen überlastet sind.
[Seite der Druckausg.: 47]
Die ansonsten in der Altenhilfe offensiv vorgetragene Integrations- und Gemeinschaftsorientierung bleibt bezogen auf die Integrationsbemühungen älterer Migranten und Aussiedler völlig unzureichend. Träger und Wohlfahrtsverbände sind personell und strukturell nicht auf diese in sich sehr inhomogene Zielgruppe ausgerichtet. Bestehende Kommunikationsschwierigkeiten, andere moralische Standards und Geschlechtereinstellungen u.a. erfordern spezifische Kompetenzen und Angebotsstrukturen. Interkulturelle Aspekte spielen bei der Planung und Gestaltung von Angeboten bzw. Unterstützungsleistungen nur eine geringe Rolle, d.h. auf diese Gruppe hat sich das Altenhilfesystem nur am Rande eingestellt. Die Orientierungen der deutschen Altenhilfe sind gegenüber der wachsenden Anzahl älterer Migranten und Aussiedler zu deutschlastig. Fachliche Konzepte und bedarfsgerechte Angebote fehlen weitestgehend bzw. sind auf wenige Modellprojekte beschränkt. Gerade auf diese Zielgruppe bezogen gibt es bisher kaum Forschungen und Lösungsansätze. Bei der Entwicklung von Angeboten besteht, von einigen Modellinitiativen abgesehen, ziemliche Ratlosigkeit. Abschottung und Mißtrauen gegenüber deutschen Instititutionen ist bei älteren Migranten weit verbreitet. Dieses Mißtrauen ist aber z.T. durchaus wechselseitig. Kontakte bestehen (wenn überhaupt) zu Einrichtungen der eigenen Ethnie und zu Migrationssozialdiensten, über die man in Aufbau und Struktur wenig weiß. Die über diese Dienste bestehenden Angebote sind aber weder konzeptionell noch personell in der Lage, Aufgaben der Altenhilfe zu übernehmen. In diesem Kontext wird u.a. auf eine institutionalisierte Form der Vernetzung zwischen der etablierten Altenhilfe und den Migrationsdiensten orientiert.
Daß sich deutsche MitarbeiterInnen der professionell organisierten Altenhilfe um ältere Migranten bemühen, scheint für diese Menschen eine exotische Erfahrung zu sein. Die sogenannte Komm-Struktur des deutschen Altenhilfesystems manifestiert die wechselseitige Unbekanntheit und Zugangslosigkeit. Die mangelnde Inanspruchnahme von Diensten impliziert auf den ersten Blick einen mangelnden Bedarf. Der „Mythos der endgültigen Rückkehr" hält sich ebenso hartnäckig wie der Mythos von den intakten Generations- und Familienstrukturen innerhalb der Gruppe der Migranten. Die Situation von Migranten ist wesentlich vielschichtiger. Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten, ungeklärte Fragen der Rückkehr, Erwartungshaltungen gegenüber den eigenen Kindern u.a. verhin-
[Seite der Druckausg.: 48]
dern sowohl eine Information über bestehende Angebote als auch eine Inanspruchnahme von sozialen Diensten.
Grundsätzlich besteht eine Inkongruenz zwischen der modernen Orientierung der komplementären Hilfeleistungen über professionelle Dienstleistungssysteme im Verbund mit familiären Hilfeleistungen und den realen Zuständen und Rollenzuweisungen in der Familie von Pflegebedürftigen. Die Absicht, die Pflege von Familienangehörigen zu übernehmen, ist sowohl von subjektiven als auch objektiven Faktoren abhängig. In diesem Geflecht spielen sowohl gewachsene Familienerwartungen, interfamiliäre Beschäftigungsmuster, das bestehende Netz an professionellen Dienstleistungen und nicht zuletzt auch eine bestehende gesellschaftliche (Alters-)Ideologie eine Rolle. Welche subjektiven Pflegestrategien von Betroffenen und Familienangehörigen eingesetzt werden, ist sowohl von dem vorhandenen System der Unterstützung als auch von lebensgeschichtlich gewachsenen Einstellungs- und Anpassungsmustern abhängig. Die geringen Nutzungsraten sozialer Dienste, trotz sich verändernder familiärer Strukturen und Beschäftigungsmuster und zum Teil geringer ökonomischer Ressourcen, verdienen eine genauere empirische Betrachtung. Professionelle Unterstützung erreicht nur etwa ein Drittel aller privaten Pflegehaushalte. Daß insbesondere bei einer Kumulation von Benachteiligungen die Nutzung von sozialen und kulturellen Angeboten gering ist, muß zu denken geben.
Die Möglichkeiten, das Wohlfahrtssystem mit seinen offiziellen und „halboffiziellen" Hilfesystemen sich informativ zu erschließen und für sich sinnvoll nutzbar zu machen, überfordert häufig die sozialen Ressourcen von Hilfebedürftigen und pflegenden Angehörigen. Die selbstbewußte Inanspruchnahme von Diensten ist in der Breite betrachtet nicht etabliert. Ohne in stereotype Klassen- bzw. Schichtmuster verfallen zu wollen, deuten empirische Untersuchungen darauf hin, daß die selbstbewußte Inanspruchnahme und systematische Suche nach professionellen Hilfen und Unterstützungsarrangements eher ein Mittelschichtphänomen ist. Die im Rahmen der Altenhilfe z.T. inszenierten Hilfsangebote werden von autonomen und finanziell gut abgesicherten Alten oft als ungenügend bzw. stigmatisierend erlebt. Hilfe wird durch dieses Klientel eher über Dienstleistungen aus dem privatwirtschaftlichen Markt eingekauft und mit wohl-
[Seite der Druckausg.: 49]
fahrtsstaatlichen Grundleistungen kombiniert. Während für gut informierte und finanziell abgesicherte alte Menschen ein selbstorganisierter und souveräner Umgang mit staatlichen Hilfen und käuflichen Dienstleistungen eher möglich ist, gestaltet sich für schlecht informierte, schwer Pflegebedürftige und finanziell Schwache der selbstbestimmte Umgang mit solchen Hilfen schwieriger.
In diesem Kontext beschreiben King/Chamberlayne andere Hilfemechanismen z.B. in Arbeitermilieus (wo gibt es die eigentlich noch in klassischer Form?), unter Ausländern/Aussiedlern, in denen stärker informelle Hilfen untereinander aktiviert werden (Familien- und Nachbarschaftshilfen). Informationen und Erfahrungen über Rechte und Hilfen des wohlfahrtsstaatlichen Systems werden häufig informell, d.h. von Mund zu Mund weitergegeben. Moderne und traditionelle Pflegestrategien sind möglicherweise auch milieuabhängig. Der allgemeine Widerstand innerhalb der älteren Generation dagegen, selbstbestimmt und flexibel Hilfeleistungen in Anspruch nehmen zu sollen, ist insbesondere in den neuen Bundesländern hoch. Das traditionell staatliche Fürsorgeverständnis scheint hier im Bewußtsein der älteren Generation stärker verhaftet zu sein als in Westdeutschland. Welche Faktoren die Inanspruchnahme bzw. Nichtinanspruchnahme von sozialen Diensten wirklich beeinflussen, darüber gibt es kaum empirische Untersuchungen. Über die Nutzung sozialer Dienste liegen vorwiegend Ergebnisse aus amerikanischen Studien vor.
Die Unterteilung des Altenhilfesektors in einen offenen und stationären Bereich ist mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Altersbildern verknüpft. Während der offene Altenhilfebereich in seiner modernen Orientierung auf den aktiven Senior zielt, liegt die Ausrichtung im stationären Bereich auf dem manifest Pflegebedürftigen. Seit den fünfziger Jahren gilt in der Altenhilfe der Grundsatz offener vor geschlossener Hilfe bzw. ambulanter vor stationärer Hilfe. Die Kontinuität dieses Paradigmas knüpft administrativ an eher positive Altersbilder an. Trotz dieses optimistischen Altersbildes wird der stationäre Sektor der Altenhilfe kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut. Eine Parallelität zwischen Altersbildern und Zielgruppenorientierung ist in der Gesamtübersicht nicht ohne weiteres erkennbar.
[Seite der Druckausg.: 50]
Die Altenhilfe in der DDR zeigte eine deutlich andere Orientierung. Die Pflege von alten Menschen in stationären Einrichtungen war gesellschaftlich gewollt. Darüber täuschen auch anders gelagerte Postulate, die sich an WHO-Grundsätzen und Leitlinien orientierten, nicht hinweg. Die Pflege in der häuslichen Umgebung bzw. in der Familie wurde gesellschaftspolitisch nicht präferiert. Der Mangel an altersgerechtem Wohnraum, pflegerischen und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen u.a. erzeugten einen Sog in die stationären Betreuungsinstitutionen. Die personelle und räumlich-technische Ausstattung des als „unproduktiv" eingestuften Altenpflegebereiches waren so defizitär, daß angesichts dieser Zustände viele Angehörige die Betreuung von Familienangehörigen in der häuslichen Umgebung bevorzugten.
Trotz unterschiedlicher Entwicklungen kann kontextübergreifend von einem negativen Image des Pflegeheimes ausgegangen werden. Die in Westdeutschland öffentlich sichtbare Diskussion um den Charakter bewohnbarer Pflegeheime hat zu einer Humanisierung des stationären Bereiches beigetragen. Auf der Grundlage dieser gewachsenen Diskurse wird die durch das PVG tendenziell beförderte Medizinierung des Pflegeheims kritisch beurteilt. Der wachsende Anteil von Schwerstpflegebedürftigen erhärtet das negative Bild vom Pflegeheim.
Die Inblicknahme demographischer und soziostruktureller Entwicklungs-tendenzen führt zu teilweise diffusen Altersbegriffen und chronologischen Alterseinteilungen. Trotz dieser unübersichtlichen Altersbegriffe und Kate-gorisierungen rückt die Gruppe der Hochaltrigen verstärkt in den Blickpunkt, d.h. wird zur primären Zielgruppe in der Altenpflege. Parallel dazu werden in den aktuellen Debatten die Bedürfnisse und Belastungen pflegender Angehöriger genauer wahrgenommen. Quantitative Daten werden mit soziologischen Deutungen verknüpft. Die Veränderung von Familienstrukturen und Rollenmustern werden durch empirische Untersuchungen differenzierter sichtbar. Unzureichende Rahmenbedingungen und Dienstleistungsangebote können auf der Basis von Forschungsergebnissen kritisiert sowie Reformvorschläge daraus abgeleitet werden. Die Förderung moderner Familienstrukturen zielt u.a. auf die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Darüber hinaus soll die psychosoziale Begleitung pflegender Angehöriger ausgebaut werden.
[Seite der Druckausg.: 51]
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des PVG zeigen eine deutliche Orientierung auf manifest Pflegebedürftige. Das Pflegeversicherungsgesetz ist ein egalitär ausgerichtetes Grundsicherungsmodell, das sich an einem relativ statischen Pflegebedürftigkeitsbegriff orientiert. Der Pflegebegriff ist aus pflege- bzw. sozialwissenschaftlicher Sicht betrachtet verengt. Diese Verengungen entstehen durch weitreichende Standardisierungen und der kategorial starren Schematisierung von Bedürfnissen entlang funktioneller Einschränkungen. Insbesondere bei psychischen Erkrankungen erweist sich dieses Raster als unzulänglich. Das grundsätzliche Dilemma, eine qualitativ gute Pflege unter wirtschaftlich vorgegebenen Rahmenbedingungen sicherzustellen, bleibt bestehen und verweist auf komplementäre Sicherungssysteme und Zusatzleistungen. Die Erwartungen, daß über das BSHG zusätzliche Leistungen in Anspruch genommen werden können, bleiben weitestgehend unerfüllt. Der im § 75 BSHG eingeführte erweiterte Hilfeanspruch, der auf eine kulturelle und soziale Teilhabe älterer Menschen zielt, kann angesichts eingeschränkter Finanzierungsspielräume nicht eingelöst werden.
Das ökonomisch geprägte Bedürfnisverständnis in der Pflege erweist sich insbesondere für finanziell Schwache und sozial Isolierte als restriktiv bedeutsam. Eine exzessive Markt- und Kundenorientierung verträgt sich nicht mit dem prinzipiell „unproduktiven" Charakter von Altenpflege und der z.T. eingeschränkten Kundensouveränität von Pflegebedürftigen. Überzogene Rationalisierungstendenzen sind ethisch bedenklich. Der Pflegemarkt bedarf deshalb einer stärkeren externen Kontrolle und Regulierung.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und staatlichen Sicherungssysteme skizzieren, entlang des paradigmatischen Grundsatzes ambulant vor stationär, wesentliche institutionelle Hilfen und Angebote. Ziel bleibt die weitgehend unabhängige und selbständige Lebensführung von Hilfe- und Pflegebedürftigen. Die vertraute Umgebung wird als ein wichtiger Faktor bei der Sicherung des individuellen Wohlbefindens von Pflegebedürftigen angesehen. Durch die längere Verweildauer älterer Menschen in ihrer Wohnung und den Wandel von Familienstrukturen steigt der Bedarf an ambulanten Dienstleistungen. Spezielle Wohnformen und domizilorientierte Dienstleistungen, die verstärkt auch privatwirtschaftlich angeboten
[Seite der Druckausg.: 52]
werden, sind Ausdruck dieser Entwicklungstendenzen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse von Hilfe- und Pflegebedürftigen sollen auch architektonisch Berücksichtigung finden. Heimeinweisungen und krisenbedingte Krankenhausbehandlungen sollen möglichst vermieden werden. Rund um das Thema „Wohnen im Alter" entwickeln sich Sonderwohnformen wie z.B. das Betreute Wohnen, die im Verbund mit ambulanten Diensten der Altenhilfe eine vorrangige politische Zielrichtung der offenen Altenhilfe umreißen.
Bei der Sicherstellung von ambulanten Dienstleistungen spielen die seit den achtziger Jahren in Westdeutschland etablierten Sozialstationen eine zentrale Rolle. Dort konzentrieren sich örtlich und organisatorisch unterschiedliche Pflegeangebote. Die Vermittler- und Vernetzungsfunktionen von Sozialstationen werden angesichts der Fragmentierung sozialer Dienste und Angebote explizit herausgestellt. Es besteht ein erheblicher interner und externer Kooperations- und Koordinierungsbedarf zwischen Diensten und Dienstleistungen. Diese Ansprüche können angesichts der dafür notwendigen personellen und fachlichen Ressourcen flächendeckend nicht realisiert werden.
Die Notwendigkeit professioneller Hilfen entlang angedeuteter Verwerfungen und Versorgungslücken zwischen formellen und informellen Hilfesystemen zielt auf verstärkte Vermittlungs- und Übersetzungsleistungen. Neben den Pflegebedürftigen benötigen auch pflegende Angehörige, Migranten/Ausländer bzw. Aussiedler eine auf die Situation bezogene Hilfeleistung. Individuell und kulturell unterschiedliche Kontexte könnten über zugehende soziale Arbeit intensiver erfaßt und moderiert werden. Die Angebote und Unterstützungsleistungen der Altenhilfe zeigen eine zu unspezifische und starre Ausrichtung. Unterschiedliche Zielgruppen und deren Bedürfnisse können über schematische Hilfsangebote kaum erreicht werden.
Zielgruppenorientierte Forschungen und daran anknüpfende Lösungskonzepte fehlen weitestgehend. Prinzipiell stellt Soziale Arbeit angesichts der körperbezogenen und ökonomisch geprägten Rahmungen in der Pflege ein notwendiges Korrektiv dar. Die stärkere Einbeziehung von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen bleibt als Forderung bestehen, damit professionelle
[Seite der Druckausg.: 53]
Hilfen in das interaktive Geflecht zwischen Angehörigen und Pflegebedürftigen individuell eingepaßt werden können.
Die administrativen Bemühungen, über regionalisierte Modellprojekte (z.B. Pflegekonferenzen) eine verbesserte Kooperation und Vernetzung von unterschiedlichen Dienstleistungen und Trägern anzustoßen bzw. zu etablieren, scheitern z.T. an der Konkurrenz von Dienstleistungsanbietern. Eine integrierte Dienstleistungslandschaft in der Altenpflege bleibt eher eine Wunschvorstellung. Angesichts der dargestellten Wettbewerbssituation bleiben Aufgaben der Beratung und Vermittlung eine kommunale Pflichtaufgabe. Eine ausreichende finanzielle und fachliche Verankerung von Beratungs- und Vermittlungsleistungen sollte gesetzlich fixiert werden.
Bei der Darstellung von primären Leitbildorientierungen, Zielgruppen und daran anschließenden institutionellen Angeboten stellt sich die Frage nach der faktischen Nutzung von pflegerischen Dienstleistungen. Die normativen Vorstellungen von guter Pflege decken sich z.T. nicht mit den Hilfearrangements von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Es besteht eine Inkongruenz zwischen der modernen Orientierung der komplementären Hilfeleistungen über professionelle Dienstleistungssysteme, im Verbund mit familiären Hilfeleistungen, und den realen Zuständen und Rollenzuweisungen in der Familie von Pflegebedürftigen.
Daß insbesondere bei einer Kumulation von Benachteiligungen die Nutzung von sozialpflegerischen Angeboten relativ gering bleibt, verdient besondere Aufmerksamkeit. Das gehäufte Auftreten bestimmter Defizite und Einschränkungen läßt sich nicht linear über soziale Dienste kompensieren. Der Zusammenhang zwischen Lebenssituation und Dienstenutzung scheint weniger offensichtlich als angenommen. Das Zusammenwirken von gesundheitlichen, sozialen und psychologischen Merkmalen ist empirisch schwer faßbar. Insbesondere die Bedeutung psychologischer Mechanismen (Erwartungen, Einstellungen, soziokulturelle Deutungsmuster u.a.) darf bei der Nutzung sozialer Dienste nicht unterschätzt werden.
A. Braun: Vielen Dank an Herrn Schilling, auch wenn sein Beitrag ein wenig lang geraten ist. Deshalb würde ich mich dafür entscheiden, daß wir seinen Beitrag zunächst zur Kenntnis nehmen, nicht gleich noch eine Dis-
[Seite der Druckausg.: 54]
kussion anhängen, sondern uns jetzt eine Viertelstunde Pause gönnen, damit wir Frau Schäfer-Walkmann dann auch wirklich genügend Zeit zur Darstellung ihres Projekts vor der Mittagspause lassen.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | April 2001