![]()
Oktober 97
*Der Friedrich-Ebert-Stiftung, die in vielfältiger Weise dazu beigetragen hat, daß diese Arbeit entstehen konnte, bin ich zu besonderem Dank verpflichtet.
1. Globalisierung - ein neues Phänomen?
„Internationale Wettbewerbsfähigkeit" und „Probleme des Standorts" sind nicht nur in Deutschland ein zentraler Gegenstand der wirtschaftspolitischen Debatte. US-amerikanische Gewerkschaften beklagen den Verlust von 400 000 Arbeitsplätzen durch die NAFTA und die stagnierenden Einkommen der Industriearbeiter durch Importkonkurrenz aus Entwicklungsländern. In Frankreich, den Niederlanden und Schweden sieht man einen Arbeitsplatzabbau durch ausländische Direktinvestitionen. In Japan wird die Aushöhlung der industriellen Basis durch die zunehmende Auslagerung von Produktionsstätten in südostasiatische Schwellenländer befürchtet. Selbst in Korea und Taiwan registriert man mit Besorgnis den wachsenden Konkurrenzdruck durch die aufstrebenden Entwicklungsländer der Region. Auf der anderen Seite gibt es in vielen Entwicklungsländern und in den osteuropäischen Transformationsländern die Sorge, bei völlig offenen Märkten mit qualitativ hochwertigen Gütern aus den Industrieländern überschwemmt zu werden und erneut - wie in den 80er Jahren - in eine Verschuldungskrise zu geraten. Die jüngsten Zahlungsbilanzkrisen einiger „asiatischer Tiger" zeigen, daß diese Sorge nicht ganz unberechtigt ist. Schließlich sehen sich viele Entwicklungsländer in Afrika und Lateinamerika als Opfer einer Marginalisierung, da sie kaum von den zunehmenden weltwirtschaftlichen Handels- und Kapitalströmen erfaßt werden. Nicht nur in den Industrieländern begrüßt man also den wachsenden Handels- und Kapitalverkehr mit den Entwicklungs- und Transformationsländern nur mit erheblichen Einschränkungen, sondern auch in den Entwicklungsländern selbst. Auf beiden Seiten wird befürchtet, daß der zunehmende internationale Wettbewerb zwischen Ländern mit stark unterschiedlichen Löhnen und Sozialleistungen einen Anpassungsdruck zur Folge hat, der die Gesellschaftssysteme überfordert.
Unter „Globalisierung" werden üblicherweise drei Dimensionen der zunehmende wirtschaftlichen Verflechtung der Nationalstaaten subsummiert: Der Handel mit Waren und Dienstleistungen, die Wanderung von Kapital und Technologie und die Verflechtung der Arbeitsmärkte. Richtig ist: Das Gewicht der mit dem Weltmarkt verflochtenen Bereiche hat in allen industrialisierten Volkswirtschaften schon seit dem Beginn der Industrialisierung zugenommen. Nach dem 2. Weltkrieg hat sich dieser Trend fortgesetzt. Zwei Entwicklungen haben allerdings in den letzten Jahren die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Globalisierung in den Augen vieler Beobachter verstärkt: der Zusammenbruch des kommunistischen Machtsystems und die zunehmende Ausrichtung der Entwicklungsländer in der Asien-Pazifik-Region und in Lateinamerika am westlichen Wirtschafts- und Demokratiemodell.
Im Lichte dieser schockartigen Veränderungen wird in der öffentlichen Diskussion häufig der Eindruck erweckt, Globalisierung sei erst in jüngster Zeit zu einer besonderen Herausforderung geworden. Das empirische Bild spricht aber eine andere Sprache. Dies läßt sich anhand der genannten drei Dimensionen der Internationalisierung oder Globalisierung ohne weiteres skizzenhaft belegen.
Der internationale Handel war seit dem Ende der 40er Jahre die treibende Kraft der zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtung zwischen den Industrieländern. Hiermit einher ging ein stetig steigender Offenheitsgrad der meisten Volkswirtschaften (Abbildung 1). Insbesondere die westeuropäischen Länder und die USA sind beim Handel mit Industriegütern zusammengewachsen. Auch bislang weitgehend geschlossene nationale Märkte werden aufgebrochen und dem weltweiten Wettbewerb ausgesetzt. Derzeit sind hiervon besonders die staatlich geschützten Monopolunternehmen in der Nachrichtenübermittlung, dem Verkehr und der Energiewirtschaft betroffen. Auch Banken, Versicherungen und andere private Dienstleistungen werden sich künftig stärker dem internationalen Wettbewerb stellen müssen.
Für Deutschland gilt der allgemeine Trend zunehmender Verflechtung zwar im Prinzip auch, seit Mitte der 80er Jahre hat sich allerdings der Trend zu zunehmender Offenheit etwas verlangsamt und ist im Zuge der Vereinigung zeitweilig sogar zurückgegangen (Abbildung 2). Seit den 50er Jahren hatte sich die deutsche Wirtschaft allmählich für den internationalen Handel geöffnet. Aufstrebende Entwicklungs- und Schwellenländer haben mit etwa 5 vH am deutschen Import nur eine untergeordnete Bedeutung. Der deutsche Außenhandel ist weitgehend durch den Handel mit anderen Industrieländern geprägt.
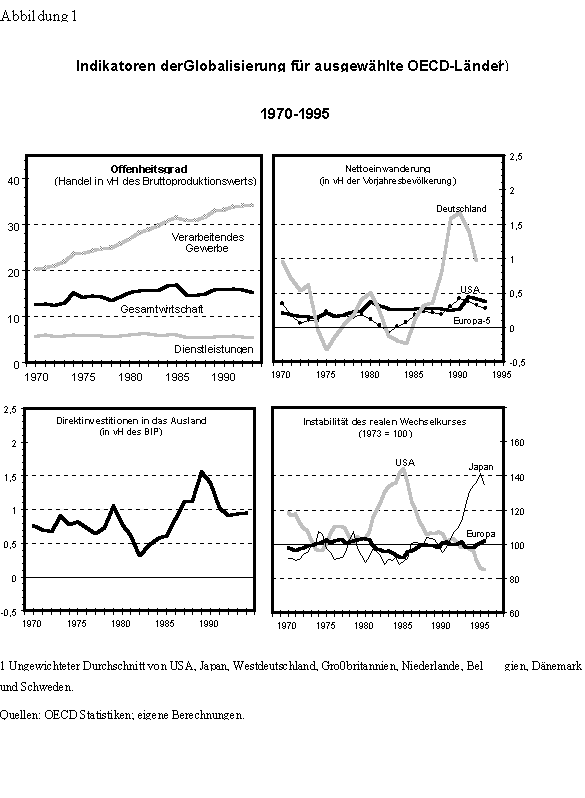
Abbildung 2 Indikatoren der Globalisierung für Deutschland, 1950-1994
Offenheitsgrada
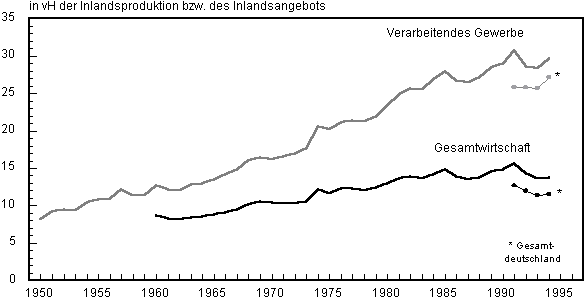
a Mittelwert aus Exportanteil der Inlandsproduktion und Importgehalt des Inlandsangebots. Quellen: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen und Schätzungen.
Während der gesamten Nachkriegszeit hatte Westdeutschland einen – zumeist erheblichen – Exportüberschuß. Jedem Exportüberschuß entspricht ein Nettokapitalexport. Durch seine anhaltenden Exportüberschüsse hat Deutschland folglich Auslandsvermögen aufgebaut. Im System fester Wechselkurse von Bretton Woods schlug sich dies vorwiegend in Form zunehmender Devisenreserven der Bundesbank (= Nettokredite an ausländische Zentralbanken) nieder, während seit dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen zu Beginn der 70er Jahre zunehmend private Kapitalexporte, also Kredite an das Ausland, Käufe ausländischer Wertpapiere und Direktinvestitionen an Bedeutung gewannen. Im Zuge der Globalisierung der Produktion hat der Anteil der Direktinvestitionen am Nettokapitalexport stetig zugenommen. Ein erheblicher Teil der Zunahme der deutschen Direktinvestitionen im Ausland entfiel in den letzten Jahren allerdings auf das Banken- und Versicherungsgewerbe, während die Verlagerung von arbeitsintensiven Produktionsverfahren bislang keine zentrale Rolle spielen.
Die Liberalisierung der internationalen Kapitalmärkte, der rasche Fortschritt in der Nachrichtentechnik, die Einführung neuer Finanzinstrumente und der zunehmende Finanzierungsbedarf von Schwellen- und Entwicklungsländern haben zu einem außergewöhnlich raschen Wachstum des weltweiten Kapitalverkehrs geführt. Auch die für die wirtschaftliche Entwicklung bedeutsamen langfristigen Zinssätze werden in immer stärkerem Umfang durch internationale Kapitalbewegungen bestimmt, die ein nicht zu unterschätzendes spekulatives Moment enthalten.
Es gibt keinen globalen Arbeitsmarkt. Der Zustrom auf die Arbeitsmärkte der meisten Nationalstaaten wird durch eine restriktive Einwanderungspolitik reguliert. Gegenwärtig liegt der Anteil der im Ausland geborenen Einwohner an der Gesamtbevölkerung nur in drei der führenden OECD-Ländern bei mehr als 10 vH. Allerdings nahm dieser Anteil in den meisten Ländern in den letzten Jahrzehnten zu. Die restriktive Einwanderungspolitik vieler Länder ist nicht vornehmlich Folge der hohen Arbeitslosigkeit in den westlichen Ländern, sondern hat vielfältige kulturelle und gesellschaftliche Wurzeln. Insofern würde sich durch eine Veränderung der wirtschaftlichen Grundbedingungen, also Beseitigung der Arbeitslosigkeit und höheres Wachstum in den Industrieländern, daran nichts ändern. Die zuweilen in der Globalisierungsdebatte geäußerte Befürchtung, es entstünde ein globaler Arbeitsmarkt, ist somit ohne jede Grundlage. Das Zusammenwachsen der Welt beschränkt sich weiterhin auf die Güter- und Kapitalmärkte und unterliegt damit den Gesetzmäßigkeiten, die die Entwicklung dieser Märkte seit Beginn der Industrialisierung kennzeichnen.
2. Globalisierung und Strukturwandel
2.1 Globalisierung und das Aufholen der Entwicklungsländer
Globalisierung ist nicht allein das Ergebnis des technischem Fortschritts und des internationalen Wettbewerbs, sie ist auch politisch gewollt: Die wirtschaftliche und politische Öffnung einer zunehmenden Anzahl von Ländern, multilateral im Rahmen des GATT und der WTO, regional z.B. innerhalb der Europäischen Union und unilateral in Osteuropa, China, Südostasien und Lateinamerika hat den grenzüberschreitenden Fluß von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Technologie stark erleichtert. Die zunehmende Öffnung der nationalen Volkswirtschaften durch den Abbau staatlicher Beschränkungen des Handels- und Kapitalverkehrs ist von der Überzeugung getragen, daß eine offene Weltwirtschaft den Wohlstand aller beteiligten Länder erhöht. Hinzu kommt, daß das Entwicklungsmodell, das den weniger entwickelten Ländern mit direkter westlicher Hilfe den Übergang zu einem sich selbsttragenden Aufholprozeß erleichtern wollte, die Erwartungen enttäuscht hat.
Von der Vorstellung auszugehen, Regionen konkurrierten wie Unternehmen miteinander um Absatzmärkte, ist ein grundlegender Fehler derjenigen, die die Globalisierung als Bedrohung oder zumindest als neue und unbewältigte Herausforderung charakterisieren. Diese Vorstellung steht im Widerspruch zu dem weithin unbestrittenen Prinzip der Ausnutzung komparativer Vorteile: Regionen spezialisieren sich auf den Export von Gütern und Dienstleistungen, die sie im Vergleich zu anderen kostengünstiger herstellen können; sie importieren dagegen solche Güter, die sie im Inland nur mit relativ hohen Kosten erzeugen können. Internationaler Handel beruht somit auf dem Prinzip der Arbeitsteilung, bei dem alle beteiligten Länder gewinnen. Das empirische Bild zeigt dementsprechend, daß hochentwickelte Länder solche Güter exportieren, für deren Produktion vergleichsweise viel Humankapital und Technologie erforderlich ist, während sich weniger entwickelte Länder auf den Export von arbeits- und rohstoffintensiven Produkten spezialisieren. Das Entwicklungsniveau der Länder, also vor allem ihre Ausstattung mit Kapital, entscheidet über die Höhe des Lohnniveaus. Das Lohnniveau selbst entscheidet nicht, welche Volkswirtschaften wettbewerbsfähig sind, sondern nur, welche Unternehmen und Branchen besonders stark gewinnen und besonders stark verlieren. Da Hochlohnländer wegen ihrer hohen Innovationsfähigkeit oft überdurchschnittliche Gewinne auf dem Weltmarkt erwirtschaften und Überschüsse im Handel mit den Entwicklungsländern erzielen, spricht zudem vieles dafür, daß sie vom internationalen Handel in besonders hohem Maße profitieren. Nicht zuletzt deswegen gehören die Industrieländer zu den Vorreitern einer weiteren Liberalisierung der Weltwirtschaft. Wäre von einem grundsätzlichen Wettbewerbsnachteil der Hochlohnländer auszugehen, wäre die von der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig unterstützte Einführung des europäischen Binnenmarktes und der Fortschritt bei den WTO-Vereinbarungen offenbar eine Politik gegen nationale Interessen.
Globalisierung führt allerdings zum Strukturwandel. Dieser kennt, aus welchen Gründen er auch immer zustandekommt, Gewinner und Verlierer. Auf Branchenebene gehören in den Industrieländern die humankapital- und forschungsintensiven Branchen zu den Gewinnern des Strukturwandels, während prinzipiell die arbeitsintensiven Branchen zu den Verlierern zählen. Dies war über die gesamte Nachkriegszeit der Fall. Bis in die 70er Jahre hinein beruhte der Handel mit Industriegütern weitgehend auf intra-industriellem Handel zwischen Ländern mit ähnlichem Lohnniveau, während der Handel mit Niedriglohnländern weitgehend inter-industriell war: Die Industrieländer exportierten Industriegüter in diese Länder und importierten Primärgüter von dort. Seit den 70er Jahren ist eine verstärke Industrialisierung und Auswärtsorientierung von Niedriglohnländern zu beobachten. Hiermit einher ging ein zunehmender Anteil dieser Länder am Welthandel mit Industriegütern.
Vielfach wird befürchtet, daß dies einschneidende Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt der Hochlohnländer zur Folge hat: Die zunehmende Spezialisierung der fortgeschrittenen Industrieländer auf den Export von wissens- und humankapitalintensiven Produkten und der zunehmende Import von arbeitsintensiven Produkten verringere die Nachfrage nach weniger qualifizierten Arbeitnehmern im Sektor der handelbaren Güter. Dies werde verstärkt durch die Verlagerung von arbeitsintensiven Produktionsverfahren durch Direktinvestitionen im Ausland. Das wiederum hätte zur Folge, daß die Nachfrage nach weniger qualifizierten Arbeitnehmern unter Druck gerate. Bei starren Lohnstrukturen und unzureichenden Ausbildungsanstrengungen führe dies zu höherer Arbeitslosigkeit bei weniger Qualifizierten, bei flexiblen Lohnstrukturen ergäben sich stark zunehmende Lohnunterschiede.
Das ist, soweit es nur den Außenhandel betrifft, richtig für Volkswirtschaften, die keine Überschüsse und Defizite in der Leistungsbilanz kennen. Hinzu kommt, daß es auch Kräfte gibt, die den rein außenhandelsinduzierten Effekten entgegenwirken. Der Strukturwandel, der sich unabhängig vom Außenhandel vollzieht - und das ist immer noch der weitaus größere Teil -, bringt auch Entwicklungen mit sich, die einfache Arbeit begünstigen. Mit wachsendem Einkommen steigt nämlich in allen Volkswirtschaften der Welt der Anteil der Dienstleistungen und in diesem Sektor werden viele weniger gut ausgebildete Arbeitskräfte eingesetzt. Schon wegen dieses Effekts darf bei Untersuchungen der Auswirkungen des Außenhandels auf die Beschäftigung nicht einfach von den Veränderungen bei der Arbeitslosigkeit geringer Qualifizierter auf Auswirkungen der Globalisierung und/oder auf eine „zu geringe" Lohndifferenzierung geschlossen werden. Zu bedenken ist auch, daß das Qualifikationsniveau des Arbeitsangebots von Land zu Land sehr unterschiedlich ist.
Der empirische Befund ist folglich keineswegs eindeutig. Zwar hat in einigen Ländern die Lohnspreizung seit Beginn der 80er Jahre deutlich zugenommen (das gilt vor allem für die USA und das Vereinigte Königreich), während sie in anderen (Deutschland und die Niederlande z.B.) relativ konstant geblieben ist. Dennoch gibt es in den Ländern mit zunehmender Lohnspreizung eine höhere oder zumindest gleich hohe Arbeitslosigkeit gering qualifizierter Arbeitskräfte im Vergleich zu denjenigen mit weniger differenzierten Löhnen. [ Vgl. zu diesem Abschnitt Flassbeck (1996). ] Und dies, obwohl die USA und in abgeschwächter Weise auch Großbritannien - ohne jeden Zusammenhang mit der Globalisierung - seit Anfang der 90er Jahre eine bessere Arbeitsmarktentwicklung aufweisen als die kontinentaleuropäischen Länder.
2.2 Intertemporaler und internationaler Strukturwandel [ Vgl. Trabold: (1997).]
Wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Herausforderungen („Standortprobleme") für einzelne Regionen der Welt können offenbar auf zwei verschiedene Arten entstehen. Erstens, das Ingangsetzen des Strukturwandels in der Zeit, also die Umsetzung neuer Ideen in neue Produkte oder Produktionsverfahren und damit die Verdrängung herkömmlicher Güter und Herstellungsmethoden, gelingt nicht in befriedigender Weise. Zweitens, die Bewältigung des Strukturwandels im Raum, also die Verdrängung von im Inland hergestellten Produkten durch Produkte, die in anderen Ländern erzeugt worden sind, führt zu unüberwindlichen Friktionen. Um die damit verbundenen Probleme analysieren zu können, muß man sich zunächst vor Augen führen, wie beide Arten des Strukturwandels beschaffen sind und welche direkten und indirekten Folgen sie haben.
Der intertemporale und der internationale Strukturwandel laufen nach ganz ähnlichen Prinzipien ab. Beim intertemporalen Strukturwandel überwindet der Pionierunternehmer die unaufhebbare Restriktion der Unsicherheit über die Zukunft durch sein Handeln: Er investiert in neue Produktionsverfahren und/oder neue Produkte, erreicht im Erfolgsfalle temporäre Vorteile gegenüber seinen Konkurrenten und schafft dadurch neue Arbeitsplätze, mehr Einkommen und schließlich die Nachfrage für die von ihm angebotenen Produkte. Das Geheimnis des Erfolges ist in letzter Konsequenz immer eine betriebliche Kostensenkung infolge einer Innovation oder, was auf das gleiche hinausläuft, die Produktion eines neuen Produktes zu einem Preis, der es vorteilhaft gegenüber seinen schon vorhandenen Substituten erscheinen läßt. Diese Kostensenkung wird in den Preisen weitergegeben und führt in der Regel zu Marktanteilsgewinnen des Pionierunternehmers, weil der gesamte Markt weniger stark expandiert als die Nachfrage nach seinen Produkten.
Entscheidend dabei ist, daß der Pionierunternehmer in die Lage versetzt wird, seine Innovation bei ansonsten unveränderten Kostenbedingungen durchzuführen. Konkret: Er greift auf vorhandene Arbeitskräfte zurück, ohne daß der von ihm zu zahlende Lohn unmittelbar (stärker) steigt als bei seinen Konkurrenten. Das heißt, Arbeit ist ausreichend mobil oder die Lohnverhandlungen sind ausreichend stark zentralisiert, so daß für den Unternehmer der Lohnsatz eine gegebene Größe ist. Der Pionierunternehmer greift daneben auf Kapital zurück, ohne daß der Zins sofort (stärker) steigt. Kapital ist also mobil, und das Kapitalangebot ist hinreichend elastisch. Letztlich kombiniert also der Pionierunternehmer mehr oder effizienter verwendetes Kapital mit Arbeit, wobei ihm beide Produktionsfaktoren zum gleichen Preis zur Verfügung stehen wie allen anderen Unternehmen. Anders ausgedrückt, er kombiniert höhere Produktivität der Arbeit, also einen geringeren Arbeitseinsatz pro produzierter Gütereinheit, mit unverändertem Lohn.
Beim internationalen Strukturwandel ist nicht die Überwindung der Unsicherheit bezüglich der Zukunft das entscheidende Charakteristikum. Nicht die Aussicht auf höhere Arbeitsproduktivität ist hier der Auslöser des Strukturwandels, sondern die Kombination von gegebener Produktivität mit einem geringeren Lohnniveau in einem anderen Land. Das heißt, der Faktor Arbeit ist immobil, und diese Immobilität wird von mobilem Kapital genutzt. Ganz gleich, von wo der internationale Strukturwandel ausgeht, ob von einem Kapitalgeber in den Industrieländern oder von einem aufholenden Land selbst, immer werden Kostensenkungen gegenüber den bisherigen Kombinationen erzielt, weil eine vorhandene Technik, eine schon bekannte Kombination von Kapital- und Arbeitseinsatz mit geringeren Lohnsätzen als bisher durchgeführt wird.
Insgesamt gesehen läuft es also darauf hinaus, daß zwei Arten von Anstößen für den sektoralen Strukturwandel möglich sind. Die Produktion einer gegebenen Gütermenge mit einer geringeren Menge von Arbeit zum gegebenen Lohn - das ist der intertemporale Strukturwandel. Oder die Produktion einer gegebenen Gütermenge mit der gleichen Menge von Arbeit bei geringeren Lohnsätzen - das ist der internationale Strukturwandel. Beides beschreibt aber jeweils nur die erste Stufe des gesamten Anpassungsprozesses.
Beim intertemporalen Strukturwandel bringt die Einführung der neuen Kombination zwar eine Verminderung des Arbeitseinsatzes pro Produkteinheit beim Pionierunternehmer mit sich, gleichzeitig aber auch eine Zunahme des gesamtwirtschaftlichen Realeinkommens infolge der Preissenkung beim Produkt des Pioniers. Damit können entweder mehr Produkte des Pionierunternehmers selbst gekauft werden oder eine größere Menge anderer Güter. Gesamtwirtschaftlich gesehen führt diese Art von Strukturwandel nicht zu steigender Arbeitslosigkeit, sondern „lediglich" zur Verlagerung von Arbeitsplätzen von einem Unternehmen zu einem anderen. Da diese Art von Strukturwandel unvorhersehbar ist, genügt für die wirtschaftspolitische Absicherung der damit verbundenen Folgen offenbar, eine ausreichend große Mobilität der Arbeitskräfte im weitesten Sinne, also Mobilität in betrieblicher, sektoraler, regionaler und qualifikationsbezogener Hinsicht.
Beim internationalen Strukturwandel führt die Verlagerung der Produktion in andere Regionen der Welt scheinbar zunächst zu einem Verlust an Arbeitsplätzen und Einkommen im Inland. Aber auch hier steigt uno actu das Realeinkommen im Inland, weil die gleichen Produkte, die bisher nachgefragt wurden, nun zu einem geringeren Preis aus dem Ausland zu beziehen sind. Hier steht also eine Verbesserung der terms of trade an der Stelle, an der beim intertemporalen Strukturwandel die Zunahme der Arbeitsproduktivität gestanden hat, ansonsten sind die Folgen weitgehend gleich.
Eine kleine Komplikation ergibt sich scheinbar dadurch, daß im Gefolge der steigenden Nachfrage nach den nun billigeren Produkten aus dem Ausland im Inland zunächst keine positiven Effekte zu erkennen sind. Doch auch hier muß man weiterdenken. Baut das von der Verlagerung profitierende Land keine Handelsbilanzüberschüsse auf, kommt die Mehrnachfrage nicht wie beim intertemporalen Strukturwandel aus dem Inland, sondern in Form von Auslandsnachfrage dieses oder eines dritten Landes in das Inland zurück. Lediglich in dem Falle, in dem das vom Strukturwandel profitierende Land Handelsbilanzüberschüsse aufbaut - der klassische Fall dafür sind die Ölpreisexplosionen und die hohen Leistungsbilanzüberschüsse der Ölförderländer -, sinkt die Weltnachfrage. Dann steht dem positiven Realeinkommenseffekt im Inland zunächst ein negativer Nachfrageeffekt gegenüber. Doch auch das ist nur ein vorläufiges Ergebnis. Es ist nämlich zu fragen, welche Auswirkungen die unvermeidliche Zunahme des Nettokapitalexports des begünstigten Landes auf die internationalen Kapitalmärkte hat. Dort müßte es prinzipiell zu einer Kompensation für die gesunkene Güternachfrage kommen: Im Prinzip müßte das Kapitalangebot steigen, die Zinsen sinken und so die Investitionstätigkeit zunehmen. Daß es dazu im Falle der beiden Ölpreisexplosionen nicht gekommen ist, steht auf einem anderen Blatt, das heißt, hat Gründe, die nicht im Zusammenhang mit der Globalisierung stehen.
Beide Arten von Strukturwandel sind also im Prinzip konstruktiv, sind eben „schöpferische Zerstörung" (J.A. Schumpeter). Ein neues oder preiswerteres Produkt tritt immer und immer unmittelbar an die Stelle des verdrängten. Es gibt keinen Verlierer ohne einen Sieger. Und jeder Verlierer hat die Möglichkeit, durch Nachahmung auf die Gewinnerseite zu wechseln. Die deutlich sichtbarsten Auswirkungen hat der Strukturwandel auf den Gütermärkten. Sie sind Ausgangspunkt und Ziel des unternehmerischen Handelns. Aber auch die Kapitalmärkte sind betroffen, unmittelbar von der Kreditnachfrage, die der Pionierunternehmer entfaltet, mittelbar über die Neuverteilung von Kreditmitteln und die Absorption von zusätzlichem Kapitalangebot.
Lediglich mittelbar betroffen sind die Arbeitsmärkte. Der Faktor Arbeit ist relativ immobil. Daher kommt es am Arbeitsmarkt in beiden Fällen des Strukturwandels zu einer innerbetrieblichen und vermutlich zu einer intersektoralen Verschiebung der Arbeitskräftenachfrage, nicht aber automatisch zu allgemeiner Arbeitslosigkeit. Nur im Extremfall der sinkenden Weltnachfrage ist überhaupt einer der beiden Mechanismen (zu hohe Reallöhne, zu geringe Nachfrage) berührt, die in der ökonomischen Theorie für das Entstehen von allgemeiner Arbeitslosigkeit angeführt werden. Gesamtwirtschaftlich falsch ist in jedem Fall die häufig vertretene Auffassung, die Verschiebung der Nachfrage von Sektoren mit geringer Kapitalintensität hin zu Sektoren mit hoher Kapitalintensität vernichte Arbeitsplätze. Dabei wird nämlich nicht in Rechnung gestellt, daß kapitalintensive Produktion auch mit höherem Wachstum verbunden ist. Anpassungsdruck auf dem Arbeitsmarkt entsteht allerdings praktisch immer in regionaler, sektoraler und qualifikationsmäßiger Hinsicht. Hier können Fehlentwicklungen eintreten, die Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik schaffen.
Darüber hinaus kann die Umsetzung von neuen Ideen und damit der Strukturwandel durch makroökonomische Restriktionen behindert werden. Bei der Entwicklung der theoretischen Vorstellungen zur Dynamik des intertemporalen Strukturwandels haben solche makroökonomischen Rahmenbedingungen eine bedeutende Rolle gespielt. Heute werden sie allerdings kaum noch diskutiert, was einen entscheidenden Aspekt des Prozesses von vornherein ausblendet.
2.3 Geld und Kapital im Entwicklungsprozeß
Fehlschläge bei der gesamtwirtschaftlichen Stabilisierung, zumeist bei der Stabilisierung des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus, haben in der Geschichte der Weltwirtschaft häufig dazu geführt, daß Länder ihre realwirtschaftlichen Potentiale nicht annähernd ausschöpfen konnten, während gerade die Länder realwirtschaftlich erfolgreich waren, bei denen das relativ friktionsfrei gelang (Japan und Deutschland etwa). Hinzu kommt, daß für die aufholenden Länder, die in der Regel Nettokapitalimporteure sind (eben weil sie aufholen, also „hohe Produktivität" in Form von Investitionsgütern importieren müssen), die Restriktion „Kreditfähigkeit" eine - wie sich am Beispiel Mexikos gezeigt hat und derzeit bei den „Tigern" in aller Deutlichkeit zeigt - nicht zu unterschätzende Bedeutung hat. Insofern dürfen Geld - und Kapitalmarkt aus einem Szenario des internationalen und intertemporalen Strukturwandels nicht ausgeblendet werden.
Die Rolle von Geld und Kapital im intertemporalen Entwicklungsprozeß ist in der Ökonomie umstritten. Für den Großteil der Ökonomen hat der Geldmarkt keinerlei erwähnenswerte Funktion im Entwicklungsprozeß, sondern „nur" den Rang einer Rahmenbedingung. Die Geldpolitik sorgt für Preisstabilität, um auf diese Weise inflationsbedingte Allokationsverzerrungen zu verhindern. Der Kapitalmarkt hat zwar die Funktion, den Entwicklungsprozeß zu finanzieren, aber nur in dem Sinne, daß die anfallenden Ersparnisse (das Kapitalangebot) effizient auf die vorhandenen Nachfrager verteilt werden.
Aus dieser Theorie werden sehr weitreichende Schlußfolgerungen abgeleitet. Es wird zum Beispiel empfohlen, die Zentralbanken, wie in einigen der erfolgreichen Länder, unabhängig zu machen, um auf diese Weise der Geldwertstabilität den Rang einer Rahmenbedingung zu geben, die den Entwicklungsprozeß nicht behindert. Es wird auch gefolgert, daß Länder ohne nennenswerte eigene Ersparnisse, wie etwa die osteuropäischen Transformationsländer, die Grenzen für internationales Kapital öffnen müssen, um den Entwicklungsprozeß finanzieren zu können. Dazu müsse man eine attraktive Verzinsung ebenso wie ein geringes Wechselkursrisiko gewährleisten.
Diese Theorie ist allerdings mit einigen Rätseln konfrontiert, für die sie bisher nicht die Andeutung einer Lösung bietet. Warum etwa ist es über mehrere Jahrzehnte hinweg in vielen, vor allem in den südamerikanischen Ländern, nicht gelungen, einen erfolgreichen Entwicklungsprozeß zu initiieren und der Geldwertstabilität den Rang einer Rahmenbedingung zu geben, obwohl über viele Jahrzehnte restriktive Geldpolitik betrieben wurde? Auch die Frage, wieso Länder mit sehr unterschiedlicher Verankerung der Geldpolitik ähnlich erfolgreich bei der Stabilisierung der Preise und der Auslösung eines Entwicklungsprozesses sind, bleibt unbeantwortet. In einigen asiatischen Ländern, wie etwa in Südkorea, hat die Geldpolitik nie eine auch nur halbwegs unabhängige Rolle gehabt, sondern war immer unmittelbar in den Dienst des Entwicklungsprozesses gestellt, ohne daß das häufige Inflationsbeschleunigungen zur Folge gehabt hätte.
Noch wichtiger ist die Frage, wieso es noch keinem Land gelungen ist, vorwiegend mit Hilfe ausländischen Kapitals einen erfolgreichen Entwicklungsprozeß in Gang zu setzen, viele Länder aber weitgehend ohne jede ausländische Hilfe und ohne nennenswerte eigene, vorher schon vorhandene Ersparnisse äußerst erfolgreiche Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt und beendet haben: Japan, die Bundesrepublik Deutschland und Südkorea sind hier wieder herausragende Beispiele. Die Bundesrepublik etwa hat nach dem Zusammenbruch von Einkommen und Ersparnissen im Gefolge des zweiten Weltkrieges schon Anfang der 50er Jahre per saldo wieder Kapital exportiert.
Offenbar bedarf es einer anderen Theorie intertemporalen Strukturwandels, um diese und andere Fragen zu beantworten. Eine solche Theorie der Entwicklung haben insbesondere J.A. Schumpeter und F.A. Hayek geliefert. Nach deren Entwicklungstheorie gibt es einen unauflöslichen und extrem engen Zusammenhang zwischen intertemporalem Strukturwandel und dem Geldsystem eines Landes. Rasche wirtschaftliche Entwicklung im Schumpeterschen Sinne, also ausgelöst durch Pioniere am Gütermarkt, ist nur möglich, wenn die Geldpolitik den Entwicklungsprozeß vorfinanziert, also, wie Schumpeter es ausdrückt, einen potentiell inflationären Prozeß finanziert, der aber nicht inflationär wird, weil der Pionierunternehmer die geldpolitische Vorfinanzierung erfolgreich zur Ausweitung der Produktion nutzt. Oder, wie Hayek es ausgedrückt hat, nur durch die Geldschöpfung der Banken ist es möglich, den Entwicklungsprozeß weit rascher und erfolgreicher ablaufen zu lassen, als wenn die Finanzierung dieses Prozesses nur auf bereits vorhandene Ersparnisse angewiesen wäre. Schumpeter schreibt dazu:
„Die Kaufkraftschaffung charakterisiert prinzipiell die Methode, nach der sich die wirtschaftliche Entwicklung in der nicht geschlossenen Volkswirtschaft durchsetzt. Durch den Kredit wird den Unternehmern der Zutritt zum volkswirtschaftlichen Güterstrom eröffnet, ehe sie den normalen Anspruch darauf erworben haben. Es ersetzt gleichsam eine Fiktion dieses Anspruchs temporär diesen Anspruch selbst. Die Kreditgewährung in diesem Sinn wirkt wie ein Befehl an die Volkswirtschaft, sich den Zwecken des Unternehmers zu fügen, wie eine Anweisung auf die Güter, die er braucht, wie ein Anvertrauen von Produktivkräften." [ Schumpeter (1964), S. 153.]
Folgt man dieser Theorie, ist ohne weiteres zu verstehen, wieso Länder mit hoher Inflationsmentalität in der Regel wenig erfolgreich bei der Ingangsetzung eines erfolgreichen Entwicklungs- und Aufholprozesses sind. Jeder Versuch, den Entwicklungsprozeß via Geldschöpfung vorzufinanzieren, scheitert am raschen Aufflammen neuer inflationärer Prozesse in den Löhnen und Preisen, die sofort mit geldpolitischer Restriktion via hohe Zinsen erstickt werden müssen. Umgekehrt, in Ländern mit hoher stabilitätspolitischer Disziplin kann die Geldpolitik immer wieder - sozusagen ungestraft - eine solche Vorfinanzierung zulassen, ohne sofort inflationäre Schübe auszulösen. Das Gegenteil tritt ein: Die Vorfinanzierung, also der geldpolitische Vertrauensvorschuß, wird durch raschere reale Expansion bestätigt, die Inflationsmentalität wird weiter geschwächt.
Nach dieser Theorie erledigt sich auch die zweite Frage ohne weiteres. Gerade weil die Geldpolitik Entwicklungsprozesse vorfinanzieren muß, sind auch Länder ohne disponible eigene Ersparnisse äußerst erfolgreich. Die den Investitionen entsprechenden Ersparnisse sind dann nämlich nicht Voraussetzung für die Investition, sondern deren Ergebnis. Weil investiert wurde, sind Ersparnisse, nämlich solche aus Gewinnen und zusätzlichem Arbeitseinkommen entstanden, nicht umgekehrt. Daraus folgt auch, daß das Öffnen der Grenzen für Kapital keineswegs notwendige Bedingung für einen erfolgreichen intertemporalen Strukturwandel ist. Entscheidend ist vielmehr die Bildung von Kapital im Innern, nämlich im Zuge eines von Investitionen getragenen Entwicklungsprozesses. Im Lichte dieser Theorie ist die Option, mit Hilfe hoher Zinsen und einem festen Wechselkurs ausländisches Kapital anzulocken, geradezu selbstmörderisch. Weniger bedeutend ist dabei allerdings die unmittelbare Konkurrenz ausländischer Unternehmen auf den eigenen Gütermärkten, entscheidend sind vielmehr die für diese Strategie erforderlichen hohen Zinsen, die die eigenen Entwicklungspotentiale zerstören. Folgt man aber als Entwicklungs- oder Schwellenland der orthodoxen Doktrin hoher Zinsen nicht, muß man sich allerdings unmittelbar dem Diktat einer weitgehend ausgeglichenen Handelsbilanz beugen; auch dies ist derzeit bei den erfolgreichen asiatischen Schwellenländern zu beobachten.
Schließlich sind nach der Schumpeter-Hayek-Theorie Länder nicht deswegen erfolgreich, weil sie auf eine unabhängige Zentralbank setzen, sondern weil es - weitgehend unabhängig vom Status der Zentralbank - gelingt, einen sozialen Konsens hinsichtlich der Einkommensverteilung zu erzielen, der dafür sorgt, daß rasche Entwicklungsprozesse und daraus sich ergebende Gewinnspielräume entweder toleriert oder durch angemessene Beteiligung aller Gruppen tolerierbar gemacht werden. Die Geldpolitik greift nur ein, wenn dieser Konsens - etwa in Phasen der Voll- oder Überbeschäftigung - gefährdet ist und inflationäre Beschleunigungen drohen.
3. Arbeitslosigkeit in den Industrieländern
Die letzte Rezession hat auch in Westdeutschland die Beschäftigungserfolge des Aufschwungs vom Ende der 80er Jahre wieder zunichte gemacht: Die Arbeitslosenquote ist, wie in der Europäischen Union insgesamt, höher als je zuvor. Der Aufschwung, der 1994 eingesetzt hatte, war viel zu schwach, um eine Wende am Arbeitsmarkt einzuleiten. Sogar Länder mit früher hohem Beschäftigungsniveau wie Schweden und Finnland sind jetzt von Massenarbeitslosigkeit erfaßt. Hingegen verzeichnen die USA seit 1992 einen Beschäftigungsboom; ihre Arbeitslosenquote liegt inzwischen auf einem Niveau unterhalb dessen, was vor der Rezession von 1989/90 erreicht war; sie liegt damit auch weit unter dem europäischen Niveau. In der öffentlichen Diskussion werden hauptsächlich Arbeitsmarktrigiditäten für die unbefriedigende Beschäftigungsentwicklung in Europa verantwortlich gemacht. Anders noch als in den 80er Jahren wird heute vielfach argumentiert, daß ein rascheres Wachstum kein geeignetes Mittel zur Rückführung der Arbeitslosigkeit sei. Vielmehr müsse, so argumentiert vor allem die OECD, der Arbeitsmarkt gründlich reformiert und flexibilisiert werden; es gelte auch hier, die Wettbewerbskräfte zu stärken.
3.1 Das Erscheinungsbild der globalen Arbeitslosigkeit
Die westdeutsche Arbeitslosenquote ist in den letzten 25 Jahren nicht allmählich, sondern schubartig gestiegen, und zwar in den Jahren 1974/75, 1981-1983 und 1993/94 jeweils im Gefolge einer Rezession, die zweimal Ergebnis von Ölpreisexplosionen
waren. Eine vergleichbar starke Konjunkturabhängigkeit der Arbeitslosenquote läßt sich auch für die USA beobachten. In den USA fiel die Arbeitslosenquote im nachfolgenden Aufschwung jedoch jeweils wieder auf das ursprüngliche Niveau zurück, während sie in der EU deutlich über diesem Niveau blieb. Westdeutschland nimmt eine mittlere Position ein: Über den gesamten Zeitraum gesehen lag die westdeutsche Arbeitslosenquote deutlich niedriger als diejenige der übrigen EU-Länder zusammen. Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs in der zweiten Hälfte der 80er Jahre sank sie in der Tat parallel mit derjenigen der USA. Während des Vereinigungsbooms unterschritt sie zeitweilig sogar die US-Rate deutlich (Abbildung 3). Obgleich die Arbeitslosenquote im vereinten Deutschland stark gestiegen ist, liegt sie immer noch weit unterhalb derjenigen der übrigen EU-Länder, jedenfalls bei Verwendung der von der OECD standardisierten Raten. [ Nach der Konvention der deutschen Arbeitsmarktsta tistik ist arbeitslos, wer als arbeitslos ge mel det ist. Nach internationaler Konvention ist arbeitslos, wer nach eigenen Angaben aktiv Arbeit sucht. Letz te res wird über einen regelmäßigen Mikrozensus erfaßt.]
Abbildung 3 Arbeitslosenquoten im internationalen Vergleich, 1970-1995
(in vH; standardisierte OECD-Daten)
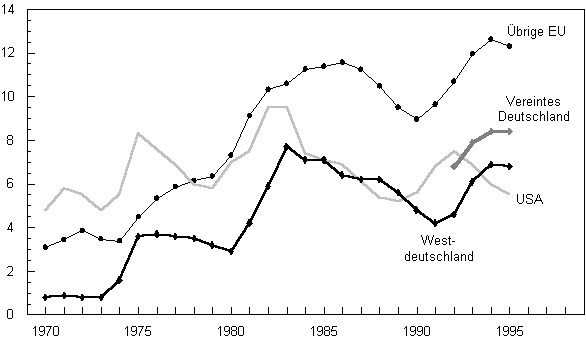
Quelle: OECD, eigene Berechnungen.
Die Arbeitslosenquote ist indes ein unzureichender Indikator für Unterbeschäftigung. Der Anpassungsmechanismus auf verschlechterte gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen muß sich nämlich nicht in einer verminderten Anzahl der Beschäftigten niederschlagen, er kann sich in einer Anpassung der geleisteten Arbeitsstunden pro Beschäftigten vollziehen. Die Art der Anpassung wird in starkem Umfang von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konventionen und Institutionen bestimmt, etwa dem Kündigungsschutz, der tariflichen Arbeitszeit, der Arbeitslosenversicherung und Frühverrentungsprogrammen.
Abbildung 4 Unterbeschäftigung im internationalen Vergleich 1993
(in vH der Erwerbspersonen; Deutschland ohne „stille Reserve")
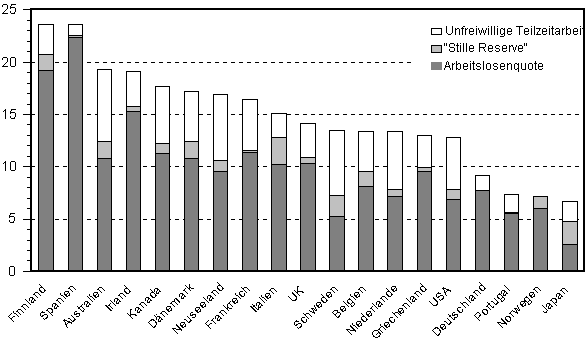
Quellen: OECD, Employment Outlook 1995; eigene Berechnungen.
Die Streuung der „Unterbeschäftigungsquoten" ist innerhalb der OECD, soweit sich dies statistisch erfassen läßt, geringer als diejenige der Arbeitslosenquoten. Insbesondere in den USA und in Japan ist die „versteckte Arbeitslosigkeit" höher. Beispielsweise ist in den USA die unfreiwillige Teilzeitarbeit stärker ausgeprägt als in Deutschland. In Japan ist die Unterbeschäftigungsquote fast dreimal so hoch wie die Arbeitslosenquote. Da diese Daten (vgl. Abbildung 4) die „stille Reserve" für Deutschland nicht berücksichtigen, insbesondere nicht die Teilnehmer der zahlreichen Arbeitsmarktprogramme, wird hier allerdings das Ausmaß der Unterbeschäftigung unterschätzt. Tatsächlich dürfte sich Deutschland eher im Mittelfeld der anderen OECD-Länder bewegen als im unteren Viertel.
Diese Ergebnisse ändern jedoch nichts an der Tatsache, daß die Unterbeschäftigungsquote in Deutschland mittlerweile ein im längerfristigen Vergleich sehr hohes Niveau erreicht hat. Gleichwohl verdeutlicht dieser Vergleich – bei allen Vorbehalten gegenüber den von der OECD verwendeten, recht groben Schätzmethoden –, daß das Problem der hohen Unterbeschäftigung ein nicht nur auf Deutschland und Westeuropa beschränktes Phänomen ist.
3.2 Die Ursachen der Arbeitslosigkeit
In der wissenschaftlichen Literatur lassen sich zwei Erklärungsansätze für Arbeitslosigkeit unterscheiden: Arbeitslosigkeit wird entweder als Strukturproblem des Arbeitsmarktes oder auf das Zusammenwirken von gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Arbeitsmarktstrukturen zurückgeführt. Ersteres schließt die neoklassische Theorie ein, die Arbeitslosigkeit grundsätzlich mit „zu hohen" Reallöhnen erklärt.
3.2.1 Arbeitslosigkeit als Strukturproblem
Das Argument der strukturbedingten Arbeitslosigkeit unterstellt, daß sich die aktuelle Arbeitslosenquote in eine strukturelle und in eine konjunkturbedingte Arbeitslosenquote zerlegen läßt und daß die strukturelle Arbeitslosenquote ausschließlich durch die Funktionsmechanismen des Arbeitsmarktes bestimmt wird, also grundsätzlich unabhängig vom Konjunkturzyklus ist. Diesem Modell liegt üblicherweise hinsichtlich der konjunkturellen Arbeitslosigkeit die Phillipskurve zugrunde, die einen negativen Zusammenhang zwischen konjunktureller Arbeitslosenquote, Veränderung des Nominallohns und Inflationsrate unterstellt. Jeder Versuch, die tatsächliche Arbeitslosenquote durch eine expansive Makropolitik dauerhaft unter die Arbeitslosenquote zu drücken, die mit einer stabilen Inflationsentwicklung vereinbar ist (NAIRU), mündet unweigerlich in dauerhaft höhere Inflation, nicht aber in dauerhaft höhere Beschäftigung. Als zentrale Erklärungsfaktoren der NAIRU werden angeführt: (i) Gewerkschaften, die aufgrund ihrer Marktmacht nicht-markträumende Reallöhne durchsetzen; (ii) sektorale, regionale und qualifikationsbezogene Lohnstrukturen, die nicht hinreichend auf die relativen Knappheiten auf den Teilarbeitsmärkten reagieren, so daß sich bei raschem Strukturwandel ein „mismatch" zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage herausbildet; (iii) eine großzügige Arbeitslosenunterstützung und Sozialhilfe, die einen Anreiz für Arbeitslose darstellt, die Stellensuche weniger intensiv zu betreiben; und (iv) Kündigungsschutz, inflexible Arbeitszeiten und hohe Lohnnebenkosten, die den Faktor Arbeit zusätzlich verteuern.
Die meisten empirischen Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, daß die europäischen Arbeitsmärkte mikroökonomisch weniger flexibel sind als der US-amerikanische [ Zusammenfassend: OECD (1994).] . Indes war dies auch in den 60er und 70er Jahren der Fall, als die US-Arbeitslosenquote noch deutlich höher war als die europäische. Wenn die europäische Arbeitslosigkeit hauptsächlich auf Strukturprobleme zurückgeführt werden kann, muß entweder nachgewiesen werden, daß die Arbeitsmarktrigiditäten in den 80er Jahren merklich zugenommen haben, oder daß sich die Anforderungen an die Flexibilität des Arbeitsmarktes im Vergleich zu den 60er Jahren erheblich beschleunigt haben. Es gibt eine Reihe von Anhaltspunkten dafür, daß die europäischen Arbeitsmärkte in den 70er Jahren an Flexibilität verloren haben. Indes trifft dies nicht für die 80er und frühen 90er Jahre zu, wo sogar eine entgegengesetzte Entwicklung festzustellen ist. Ähnliches gilt für das Tempo des Strukturwandels oder der Globalisierung. Der Strukturwandel hat sich in den 70er Jahren beschleunigt, danach aber nicht mehr.
Die Strukturhypothese kann nicht überzeugend den starken Anstieg der europäischen Arbeitslosenquote seit Anfang der 80er Jahre – und dies ist das eigentliche Problem – erklären. Die Strukturhypopthese kann insbesondere nicht erklären, wieso die wirtschaftliche Entwicklung und die Beschäftigungsdynamik in Westdeutschland so bedeutend besser war als im übrigen Westeuropa. Es spricht wenig dafür, daß in Westdeutschland in den 80er Jahren eine weit größere „strukturelle" Flexibilität bestand als etwa in Frankreich. Selbst wenn das aber so wäre, könnte die Strukturhypothese nicht erklären, wieso auch Westdeutschland dann seit 1992 wieder bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit so weit zurückgefallen ist.
Hinzu kommt, jeder Anstieg der Arbeitslosigkeit erfolgte bisher nach einer scharfen Rezession. Solche schubartigen Anstiege der Arbeitslosenquote mit nachfolgend dauerhaft höherer Arbeitslosenquote lassen sich auch für die USA im Zuge der Weltwirtschaftskrise und für das Vereinigte Königreich in den 80er Jahren beobachten, ohne daß dies sinnvoll auf eine Veränderung der Arbeitsmarktrigiditäten zurückgeführt werden kann. Gleiches gilt für den starken Anstieg der Arbeitslosenquote in Schweden seit 1990. Offenkundig ist die Unterscheidung zwischen struktureller und zyklischer Arbeitslosigkeit nicht haltbar. Die Arbeitslosenquote ist vielmehr pfadabhängig; sie kann durch einmalige Ereignisse („Schocks") dauerhaft beeinflußt werden, ohne daß es eine Automatik des Ausgleichs selbst in funktionierenden Marktwirtschaften gäbe.
3.2.2 Arbeitslosigkeit als Problem der makroökonomischen Steuerung
Die theoretischen Ansätze, die anhaltende Arbeitslosigkeit als gesamtwirtschaftliches Problem betrachten, verwerfen die Unterscheidung zwischen Zyklus und Trend. Vermutet wird, daß die gegenwärtige Arbeitslosenquote vor allem von der konjunkturellen Arbeitslosigkeit der Vorperioden beeinflußt wird, aber eine gewisse Beharrungstendenz („Hysteresis") aufweist. Bei reiner „Hysteresis" ist die gegenwärtige Arbeitslosenquote vollständig pfadabhängig. Aber auch bei teilweiser „Hysteresis" wird die Arbeitslosenquote stark von der Länge und der Ausprägung gesamtwirtschaftlicher Prosperitäts- und Depressionsphasen beeinflußt.
Da die Strukturen der nationalen Arbeitsmärkte zwar zur Erklärung der nationalen Unterschiede in der Beschäftigungsentwicklung innerhalb Europas beitragen, nicht aber erklären, warum Europas Arbeitslosenquote insgesamt in den späten 80er und in den 90er Jahren nicht zurückgegangen ist, müssen Asymmetrien von Aufschwung und Abschwung in den USA und in Europa in Betracht gezogen werden. In der Tat ist die makroökonomische Entwicklung in den USA seit Anfang der 80er Jahre insgesamt wesentlich günstiger als in Europa gewesen. Die Investitionstätigkeit war fast durchweg wesentlich dynamischer als in Europa (Abbildung 5, Teil 3). In den 80er Jahren gab es folglich ein ständig größer werdendes Wachstumsgefälle zwischen den USA und Europa (Abbildung 5, Teil 4). Dies hat die Grundlage für das amerikanische „Beschäftigungswunder" gelegt. Dagegen gibt es für die Behauptung, in Europa seien die Löhne „zu hoch", keinen Beleg. Zwar sind in den 70er Jahren die Reallöhne durchweg kräftiger als die Produktivität gestiegen, aber Anfang der 80er Jahre kehrten sich die Verhältnisse um: Seitdem sind in ganz Europa, aber auch in Deutschland, fast Jahr für Jahr die Reallöhne hinter der Produktivität zurückgeblieben (Abbildung 5, Teil 5). In den USA waren zwar die Schwankungen der Lohnquote weniger ausgeprägt, von einem völlig anderen Bild als in Europa kann spätestens seit Mitte der 80er Jahre jedoch nicht mehr die Rede sein. [ In Teil 6, ist das Haushaltsdefizit um den Schuldendienst bereinigt, weil letzterer keine potentiell expansiven Wirkungen hat. Die Geldpolitik wird durch die Differenz zwischen dem langfristigen und dem kurz fristigen Zinssatz gemessen (Teil 7). Wenn Zentralbanken den kurzfristigen Zinssatz anheben, erhöht dies die Opportunitätskosten von langfristigen Wertpapieren und Sachinvestitionen, was die Haltung von kurzfristigen Titeln attraktiver macht. Dies ist im allgemeinen mit einem Rückgang von Investitionen, Produktion und Beschäftigung verbunden.]
Die schlechte Beschäftigungsentwicklung in Europa während eines großen Teils der 80er Jahre läßt sich allerdings ohne weiteres auf die anhaltende Desinflation zurückführen. Diese hielt die Kapazitätsauslastung niedrig, was das Wachstum von Investitionen und Produktion verlangsamte. [ Die Investitionsquote ist in konstanten Preisen gemessen, weil durch die Computerrevolution die Preise der Investitionsgüter relativ zum BIP-Deflator gefallen sind. Folglich unterschätzt eine Inve stitions quote zu laufenden Preisen die Investitionsaktivität.]
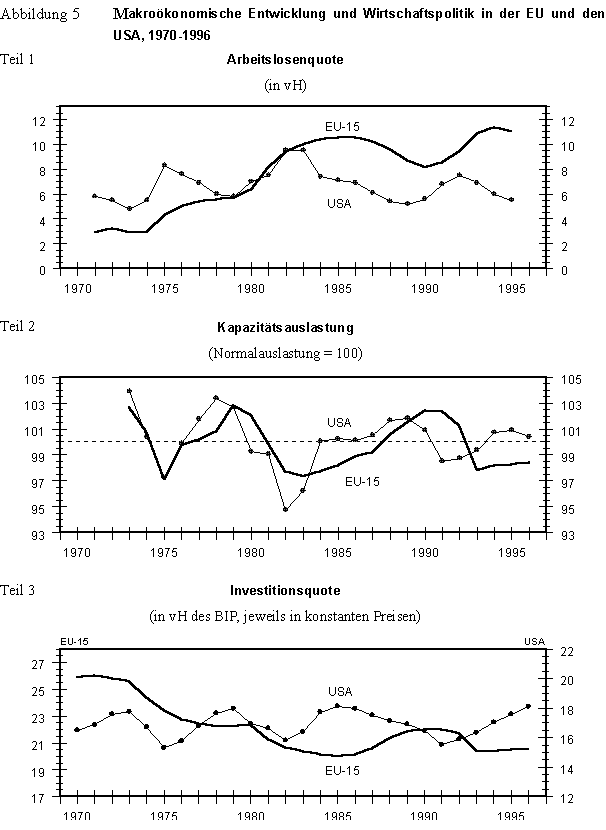
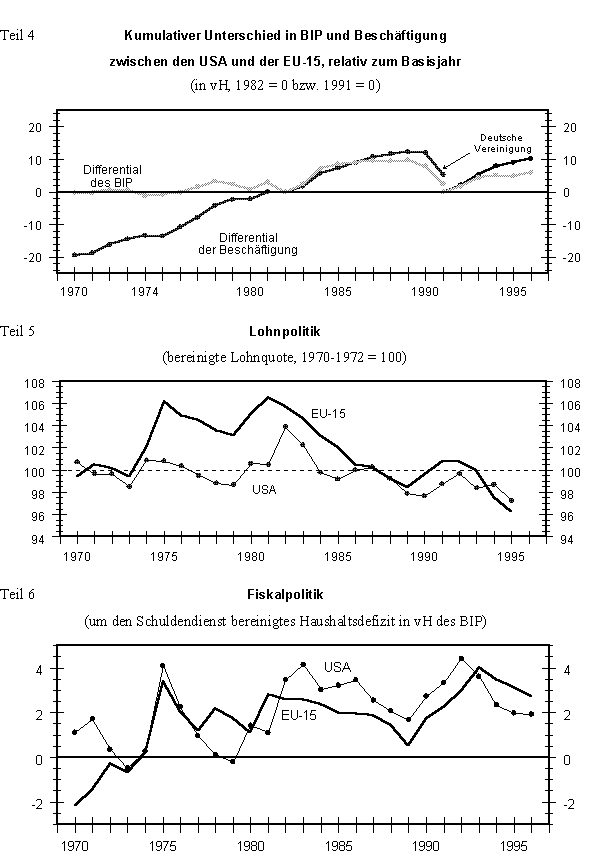
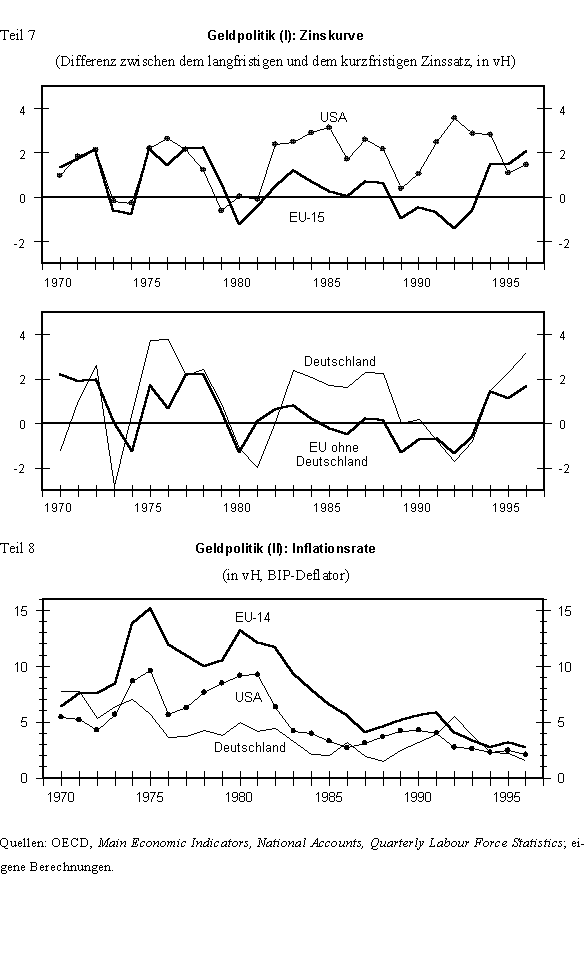
Der Gleichlauf von Wachstumsdifferential und Beschäftigungsdifferential zwischen den USA und Europa in den 80er Jahren (Abbildung 5, Teil 4) bietet den Schlüssel zum Verständnis der Probleme: Offenbar muß es eine völlig neue Dimension der Wirtschaftspolitik in Europa gegeben haben, die eine Abkoppelung der europäischen von den amerikanischen Wachstumsraten erzwang.
Die Schaffung wie auch der Verlust von Arbeitsplätzen sind offenbar eng mit dem wirtschaftlichen Wachstumsprozeß verknüpft. Der neoklassische Nexus, bei dem die Schaffung von Arbeitsplätzen das Resultat sinkender Reallöhne (bzw. der Lohnquote in einer wachsenden Wirtschaft) und einem dazugehörigen Rückgang der Arbeitsproduktivität (bzw. deren Wachstumsrate) ist, ist nicht zu erkennen. Ebensowenig läßt sich die Auffassung belegen, daß die vorhandene Arbeitslosigkeit das Resultat einer „ rationalen Entscheidung" der Arbeitnehmer ist, Freizeit anstelle der Arbeit zu wählen.
Die Dynamik der Prozesse, um die es beim Entstehen von Arbeitslosigkeit geht, läßt sich sehr gut an dem weitgehenden Gleichlauf von Investitionstätigkeit und Beschäftigung in Westdeutschland von 1960 bis heute zeigen (Abbildung 6). Keine der Strukturtheorien kann eine Erklärung dafür liefern, weshalb Investitionsschwäche und Beschäftigungsschwäche so unmittelbar zusammenfallen. Warum beschließt der Unternehmer genau zum gleichen Zeitpunkt, weniger zu investieren, in dem er entscheidet, Arbeitsplätze abzubauen, und umgekehrt?
Die Zyklik dieses Phänomens legt eine Erklärung nahe. [ Vgl. zu diesem Abschnitt auch Flassbeck et al. (1997).] Für alle Industrieländer kann nachgewiesen werden, daß Nachfrageschocks, einschließlich geldpolitischer Schocks, in der Regel die wesentliche treibende Kraft hinter Rezessionen und Aufschwüngen sind. Wenn sich ein asymmetrisches Verhalten der Zentralbanken in verschiedenen Phasen des Zyklus wie auch eine unterschiedliche Dauer der Phasen der Restriktion und Expansion in verschiedenen Ländern nachweisen läßt, könnte dies letztendlich zu einer Erklärung der unterschiedlichen zyklischen Entwicklungen bei Investitionen und Arbeitsplätzen führen.
Abbildung 6
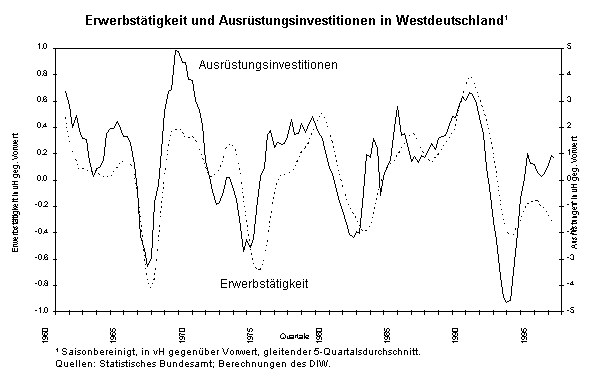
Die Zentralbanken der Welt übernehmen in zunehmendem Maße explizit die Rolle, jederzeit ein stabiles Preisniveau aufrechtzuerhalten. Indem sie dies tun, haben sie jedoch auch implizit die Verantwortung für die Beschäftigungspolitik übernommen. Wenn die Preise und die Nominallöhne im Sinne der Theorie rationaler Erwartungen keine umfassende Flexibilität aufweisen, greift eine Geldpolitik, die ausschließlich auf die Preisstabilität ausgerichtet ist, auch in die reale Wirtschaft und den Prozeß der Schaffung und Zerstörung von Arbeitsplätzen ein. Nun war die Inflationsrate in Europa und in den USA Anfang der 80er Jahre sehr hoch, während sie in Westdeutschland weit unterhalb dieser Länder lag (Abbildung 5, Teil 8). Während es den USA relativ schnell gelang, sich dem westdeutschen Niveau zu nähern, war Europa erst Anfang der 90er Jahre so weit. Das heißt, Europa mußte viel länger als die USA und Westdeutschland eine restriktive Geldpolitik betreiben, um zur Stabilität zurückzukehren.
Wenn, wie die neoklassischen Ökonomen behaupten, die Preise und Löhne so flexibel wären, daß reale Effekte einer andauernden geldpolitischen Restriktion vermieden würden, könnte unfreiwillige Arbeitslosigkeit überhaupt nicht entstehen. Doch wissen wir, daß sie sehr wohl existiert. In der realen Welt, in der zwischen der Beschäftigung von Arbeitskräften und dem Wachstum der Investitionen ein enger Zusammenhang besteht, kann die Geldpolitik, wenn sie strikt auf Preisstabilität ausgerichtet ist, schwerwiegende und negative Konsequenzen haben.
Welche Rolle spielen dabei die Löhne? Damit auf der Nachfrageseite wirkende expansive Maßnahmen, also auch die Geldpolitik, von Erfolg gekrönt sind, müssen die Nominallöhne, in Reaktion auf die Beschäftigung, relativ starr sein, das heißt, sie müssen, wie wir es derzeit in den USA erleben, erst spät im Zyklus auf die verbesserte Beschäftigungssituation reagieren. Ist dies der Fall, sind die Reallöhne relativ flexibel, wenn sich die Preise im Verlauf des Zyklus oder als Folge von Angebotsschocks ändern. Damit die Reallöhne flexibel sein können, müssen also die Nominallöhne starr sein, wenn die Preise flexibel sind.
Folglich sind inflexible Nominallöhne sowohl für Nachfragepolitik wie auch bei Schocks auf der Angebotsseite eindeutig wünschenswert. Wenn die Preise z. B. infolge eines sinkenden Angebotes („Öl") steigen und die Nominallöhne keine Reaktion zeigen, wird der Schock absorbiert, ohne daß dabei eine Inflationsspirale entsteht. Wenn sich aber die Löhne mit den Preisen ändern, bewirkt ein Angebotsschock entweder einen Anstieg der Inflation oder einen Rückgang der Nachfrage und der Investitionen, sobald die Geldpolitik versucht, Inflation zu vermeiden. Daher ist (nominale) Rigidität der Löhne in einer Welt, die mit positiven und negativen realen Schocks bombardiert wird, ein der nominalen Flexibilität überlegenes System. Flexible Nominallöhne, d.h. Nominallöhne, die sich an den Preisen der Vergangenheit orientieren (wie im typischen Fall der Indexierung), führen zur Inflexibilität der Reallöhne - der schlechtesten aller Welten. Restriktive geldpolitische Schocks haben dann schwerwiegende Konsequenzen, da die Preise nur mit großer Verzögerung auf den Rückgang der Nachfrage und der Beschäftigung reagieren.
Flexibilität der Nominallöhne und somit starre Reallöhne kennzeichneten aber das Regime, mit dem Europa die beiden Ölpreisexplosionen zu überstehen hatte. In den meisten der großen Länder, mit der wichtigen Ausnahme Deutschlands, waren zu Beginn der achtziger Jahre Indexierungsmechanismen bei den Nominallöhnen das vorherrschende Merkmal des Arbeitsmarktes. Gleichzeitig wurde aber mehr und mehr anerkannt, daß Inflation nicht die Lösung für die aufkommenden Arbeitsmarktprobleme darstellt. Anstelle einer zügigen Beseitigung der realen Inflexibilitäten der Löhne war durchweg eine restriktive Geldpolitik die Antwort. Das Resultat war eine extrem lange Phase der Desinflation, die erst Mitte der neunziger Jahre mit der Angleichung an das in Deutschland und den Vereinigten Staaten herrschende Inflationsniveau endete (Abbildung 5, Teil 7 und 8).
Das Ausmaß und die Dauer der in den achtziger und neunziger Jahren in Europa herrschenden Restriktion von seiten der Geldpolitik wird hier durch einen allgemein anerkannten Maßstab für geldpolitische Restriktion bzw. Expansion, die Zinsspanne, d.h. die Differenz zwischen den lang- und kurzfristigen Zinssätzen, demonstriert. Wenn diese Zinsspanne invers ist, wenn also die kurzfristigen Zinssätze über den langfristigen liegen, hat die Geldpolitik stark restriktiven Charakter und umgekehrt. Diesem Indikator zufolge war die Geldpolitik nach dem 2. Weltkrieg bis Mitte der siebziger Jahre in der ganzen Welt jeweils nur über sehr kurze Zeit, nämlich höchstens für ein oder zwei Quartale lang, restriktiv. In den Vereinigten Staaten und in Deutschland beispielsweise war die Geldpolitik bis dahin praktisch nie restriktiv. Bis 1982 waren die Phasen der Restriktion in Europa ebenso lang wie in den USA. Aber nach 1982 kam es zu einer drastischen Änderung. In den Vereinigten Staaten und in Deutschland wurde die Zinsstruktur relativ schnell wieder normal. In vielen europäischen Ländern blieb sie aber noch bis 1988 invers. Zu Beginn der neunziger Jahre ergab sich ein sehr ähnliches Muster. In den Vereinigten Staaten währte die Restriktion drei Quartale, ehe die Geldpolitik wieder auf einen expansiven Kurs einschwenkte. In Europa, Deutschland sogar mit eingeschlossen, hielt die Geldpolitik erneut lange an einem restriktiven Kurs fest. Bei einem Vergleich, der den ganzen Zeitraum von 1982 bis 1996 abdeckt, zeigt sich, daß die Geldpolitik in den USA nicht in einem einzigen, in Europa ohne Deutschland aber mehr als sieben Jahre lang restriktiv war (Abbildung 5, Teil 7). Ein derart langer Zeitraum geldpolitischer Restriktion ist in der Geschichte ohne Beispiel und in keinem anderen Land der Welt bekannt. Das ist der wichtigste Faktor, der die anhaltende und noch zunehmende Arbeitslosigkeit in Europa erklärt.
Für die „strukturelle" Erklärung der Arbeitslosigkeit mit Hilfe der Globalisierung gilt damit ähnliches wie für den in jüngster Zeit häufig bemühten "Modernisierungsstau" oder die "unzureichende Förderung des Strukturwandels" in Deutschland. Niemand hat bisher zeigen können, wie eine Beschleunigung des Strukturwandels mehr Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen kann. Nicht ausreichend gedanklich getrennt wird dabei die Allokation der Ressourcen bei der Produktion schon vorhandener Güter von der Schaffung zusätzlicher Aktivitätsfelder und dem Entstehen neuer Arbeitsplätze quasi aus dem Nichts. Die Verbesserung der Allokation oder, was dasselbe ist, die Erhöhung der Effizienz bzw. die Ausnutzung aller Rationalisierungschancen, ist eine Daueraufgabe für die Wirtschaftspolitik wie für die Unternehmen. Sie führt üblicherweise zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität, weil die gleiche Menge an Gütern wie vorher nun mit weniger Arbeitskräften oder eine größere Menge mit der gleichen Zahl der Arbeitskräfte hergestellt werden kann. Das ist reales Wachstum ohne Beschäftigungswachstum.
Aus einer reinen Verbesserung der Allokation kann aber keine zusätzliche Beschäftigung entstehen. Das heißt, man kann nicht zeigen, daß Marktwirtschaften nur einen hohen Beschäftigungsstand halten können, wenn sie ein bestimmtes Tempo des Strukturwandels zulassen. Im Gegenteil, die Gesellschaft ist prinzipiell frei, das Tempo zu wählen, das sie für angemessen hält. Verlangt ist in einer Marktwirtschaft allerdings Konsistenz der Ziele. Dazu gehört auch die Bereitschaft, sich der Nebenbedingung der Erhaltung internationaler Wettbewerbsfähigkeit auszusetzen, wenn die Einkommensvorteile des Freihandels genutzt werden sollen. Konsistenz der wirtschaftlichen Ziele verlangt insbesondere die Anpassung der Einkommensansprüche an das Verteilbare. Die Reallöhne dürfen nicht stärker steigen als die Arbeitsproduktivität. Ist das gewährleistet, ist jedes Tempo der Zunahme der Produktivität zulässig. Ist es nicht gewährleistet, gibt es - wiederum bei jedem Tempo der Zunahme der Produktivität - Konflikte, die sich in der Regel in Inflation entladen. Gemessen daran war Westdeutschland in der gesamten Nachkriegszeit eine der konfliktärmsten Gesellschaften der westlichen Hemisphäre.
Mehr Beschäftigung entsteht also nicht dadurch, daß in einer Gesellschaft z.B. viele Dienstleistungen hergestellt werden, die Regulierungsdichte gering, die Forschungsintensität hoch ist oder mehr oder weniger Umweltschutz vom Staat verordnet wird. Beschäftigung wird sogar abgebaut, wenn die Gesellschaft daran gehindert wird, die Früchte ihrer Anstrengungen (ihres Produktivitätsfortschritts also) in Form höherer Realeinkommen zu genießen, wenn sie also „den Gürtel enger schnallt". Dann wird der technische Fortschritt nämlich lediglich genutzt, um die gleiche Menge an Gütern, d.h. bei unverändertem Realeinkommen, mit weniger Arbeitskräften herzustellen. Gleichbleibende Beschäftigung ist nur möglich, wenn der Zuwachs der Realeinkommen mit dem Tempo der technischen Entwicklung bzw. der Produktivitätszunahme Schritt hält. Mehr Beschäftigung entsteht nur, wenn darüber hinaus - unabhängig vom spezifischen Güterbündel einer Gesellschaft und dem Tempo ihres Produktivitätsfortschritts - neue, zusätzliche Aktivitäten entfaltet werden.
Der enge Zusammenhang zwischen Beschäftigung und Investitionen ist zwingend, weil für die Unternehmen die Einstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft ebenso eine Investition in einem weiteren Sinne ist wie der Kauf einer zusätzlichen Maschine, sie binden sich damit in der Erwartung, daß der Einsatz lohnt. Es gilt also, allgemein günstige Investitionsbedingungen zu schaffen. Diese sind zwar abhängig von der Produktion bestimmter Güter oder der Regulierungsdichte; für den Investor schlägt sich das in einer zunehmenden Attraktivität von Sach- und Humankapitalinvestitionen aber nur nieder, wenn die von ihm erwartete Rendite des eingesetzten Kapitals unter Berücksichtigung des einzugehenden Risikos höher ist als die Zinsen, die für das Kapital zu zahlen sind. Eine Verbesserung der Angebots- oder Nachfragebedingungen kann daher nur erfolgreich sein, wenn gleichzeitig Gewähr dafür gegeben ist, daß Zinserhöhungen dies nicht konterkarieren.
4. Standortkrise in Deutschland?
Mit dem Beginn der Rezession im zweiten Halbjahr 1992 setzte eine Debatte über den „Standort Deutschland" ein, die an Schärfe und Dauer ihre Vorläufer [ Diese hatten - jeweils im Gefolge konjunktureller Schwächephasen und verbunden mit einer Aufwertung der D-Mark - Anfang der 80er Jahre und Mitte der 80er Jahre stattgefunden.] bei weitem übertroffen hat. Hierzu hat nicht nur die Schwere der Rezession von 1993 beigetragen. Die unerwartete Abschwächung der Wachstumskräfte nach dem Aufschwung von 1994 und die weiter steigende Arbeitslosigkeit hat Argumenten Nahrung gegeben, daß die wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Westen Deutschlands keine konjunkturellen, sondern weitgehend strukturelle Ursachen haben. Diese stünden wiederum im engen Zusammenhang mit der Position des „Standorts Deutschland" im internationalen Wettbewerb. Zwei Grundthesen werden dazu vorgebracht: Erstens, die „zu hohen" inländischen Kosten machten es der deutsche Exportwirtschaft zunehmend schwerer, sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Zweitens, wegen der hohen Kosten habe Deutschland als Investitionsstandort deutlich an Attraktivität verloren; eine massive Produktionsverlagerung ins Ausland verschärfe daher die Arbeitsmarktprobleme. Wolle Deutschland auch künftig im härter werdenden internationalen Wettbewerb bestehen und seine Arbeitslosigkeit deutlich abbauen, sei eine massive Kostenentlastung der deutschen Wirtschaft notwendig, etwa durch eine mehrjährige Lohnpause, eine stärkere Lohndifferenzierung, flexiblere Arbeitsmärkte, eine spürbare Steuer- und Abgabenentlastung der Unternehmen und weniger staatliche Regulierung.
4.1 Standortkrise und deutsche Vereinigung
Bemerkenswert ist zunächst, daß die Standortdebatte geführt wird, als habe es 1990 keine deutsche Vereinigung mit all ihren Konsequenzen für die ostdeutsche wie die westdeutsche Wirtschaft gegeben.
Abbildung 7
Bereinigte Lohnquote in Deutschland 1960-1995
(einschließlich Sozialversicherungsbeiträge, in vH des BSP)
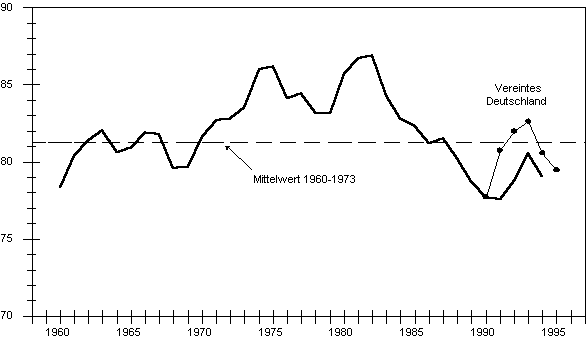
Abbildung 8
Steuern und Sozialversicherungsabgaben in Westdeutschland 1970-1994
(in vH der jeweiligen Faktoreinkommen)
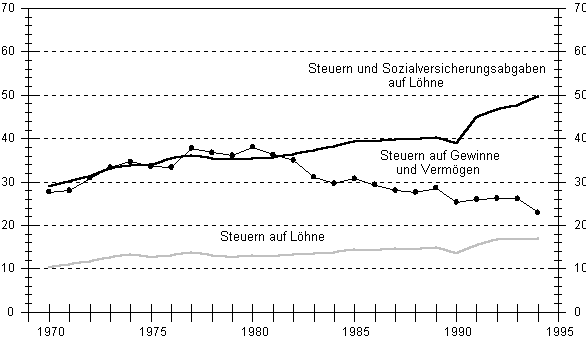
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.
Abbildung 9
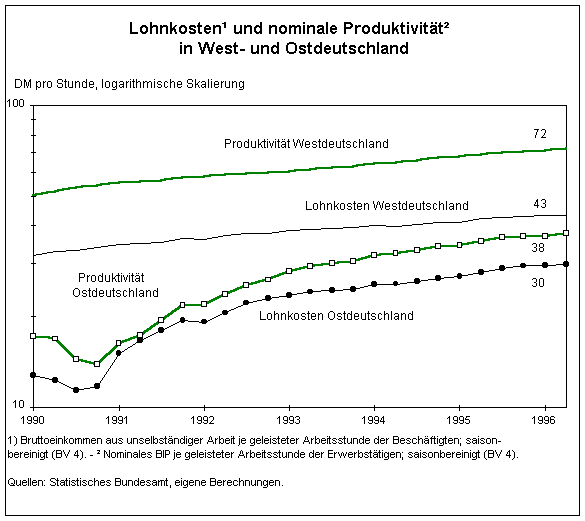
In Ostdeutschland kam es im Anschluß an die Einführung der D-Mark im Juli 1990 zu einem starken Produktions- und Beschäftigungseinbruch. Aufgrund des für die ostdeutsche Wirtschaft extrem ungünstigen Umtauschkurses von 1 : 1 und einer unmittelbar vor der Vereinigung einsetzenden massiven Kostenerhöhung durch starke Lohnerhöhungen verschlechterte sich die Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Wirtschaft in nur als dramatisch zu bezeichnender Weise. Auch in den Jahren 1991 bis 1994 haben die starken, die reale Produktionsentwicklung weit übersteigenden Reallohnerhöhungen das Wettbewerbsproblem der ostdeutschen Wirtschaft weiter verschärft. Zugleich setzte sich der Aufbauprozeß nur zögerlich in Gang. Im Ergebnis mußte es zu einem massiven Beschäftigungsabbau kommen.
Da der Bevölkerung in Ostdeutschland mit der Vereinigung fast die gleiche soziale Absicherung wie in den alten Bundesländern garantiert worden war, mußte die sich zunehmend ausweitende Lücke zwischen Produktionsergebnis und Einkommensansprüchen in Ostdeutschland durch staatliche Transfers von West nach Ost gedeckt werden. Zwar wurde davon wiederum ein erheblicher Teil kreditfinanziert, doch die Belastung mit Steuern und Sozialabgaben in Deutschland stieg erheblich. Betroffen waren davon in erster Linie die Arbeitnehmer (Abbildung 8). Zwar mußten auch die Unternehmen höhere Sozialabgaben zahlen, die Steuerbelastung der Unternehmen, die seit 1980 ständig zurückgegangen war, stieg jedoch nicht und geht zuletzt sogar wieder kräftig zurück. Daß die Gewinnentwicklung ab 1992 ungünstig und in der Industrie sogar sehr schlecht war, ist zu einem Teil der spezifischen Belastung der deutschen Unternehmen im Zuge der deutschen Einheit zuzurechnen.
Daß Deutschland insgesamt vorübergehend an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt hat, ist vor allem auf das rasche Aufholen der Löhne in Ostdeutschland und die Aufwertung der D-Mark in den Jahren 1992 und 1995 zurückzuführen. Vom Wettbewerbsverlust in Ostdeutschland profitierten allerdings westdeutsche Unternehmen. Gleichwohl erhöhten sich aber angesichts des von der staatlichen Nachfrage initiierten Wachstumsschubes auch die Importe sehr stark, so daß ausländische Unternehmen in erheblichem Maße am Vereinigungsboom teilnahmen. Schließlich schwenkte die deutsche Leistungsbilanz von einem sehr hohen Überschuß 1989 vorübergehend in ein leichtes Defizit.
Das spezifisch ostdeutsche Wettbewerbsproblem hat sich mit dem Anstieg von Produktion und Produktivität etwas abgemildert, verschwunden ist es aber noch nicht. Vergleicht man die Stundenlöhne in Ost und West mit der jeweiligen Produktivität pro Stunde, zeigt sich, daß die Gewinne in den neuen Bundesländern noch immer weit niedriger als im Westen sind. Während sie in Westdeutschland mit steigender Tendenz bei etwa 48 vH der Wertschöpfung liegen, erreichen sie in Ostdeutschland nur 30vH (Abbildung 9).
4.2 Die Standortkrise und das internationale Währungssystem
Entscheidend für die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland insgesamt ist in den 90er Jahren die Veränderung der Wechselkurse gewesen. In Westdeutschland sind die Löhne nämlich nicht zu hoch. Weder lassen sich belastbare Belege dafür finden, daß die in Deutschland pro Stunde gezahlten Löhne gemessen an der Arbeitsproduktivität zu hoch sind, noch dafür, daß sie im internationalen Vergleich zu hoch sein könnten. Insbesondere die Behauptung, die Löhne oder die Lohnnebenkosten seien im Vergleich zu den wichtigsten Handelspartnern zu hoch, prägt dennoch wie kaum eine andere Aussage die wirtschaftspolitische Debatte. Daß die Löhne auch in Westdeutschland in dem einen oder anderen Jahr unter Berücksichtigung der Produktivitätszunahme stärker als im Ausland gestiegen sind, ist kein Beleg für diese Position. In den letzten 35 Jahren sind die Lohnstückkosten in Westdeutschland in nationaler Währung nur in vier Jahren stärker gestiegen als im Ausland (Abbildung 10). Wer behauptet, Westdeutschland habe ein Kostenproblem im internationalen Vergleich, muß offenbar unterstellen, schon Anfang der 60er Jahre habe ein solches Kostenproblem bestanden, das seitdem immer weitergewälzt wurde. Das ist offensichtlich absurd. Demgegenüber hat die Deutsche Bundesbank jüngst zu Recht festgestellt: „In den letzten zwanzig Jahren hat sich die D-Mark gegenüber den Währungen der wichtigsten Handelspartner nominal kräftig aufgewertet. Im wesentlichen war dies Reflex des über viele Jahre kumulierten internationalen Stabilitätsvorsprungs der deutschen Währung" [ Deutsche Bundesbank (1997), S. 43.] . Wer aber einen dauerhaften Stabilitätsvorsprung, eine sinkende Lohnquote (vgl. Abbildung 7) und eine Aufwertung der eigenen Währung zu verzeichnen hat, kann nicht gleichzeitig im internationalen Wettbewerb, was die intern bestimmten Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit angeht, dauerhaft zurückgefallen sein.
Daß ein Land wegen seines Stabilitäts- und Wettbewerbsvorsprungs im internationalen Wettbewerb dennoch immer wieder erhebliche Probleme haben kann, liegt an einem Währungssystem, dessen Steuerungsfunktion seit seiner Einführung Anfang der 70er
Abbildung 10
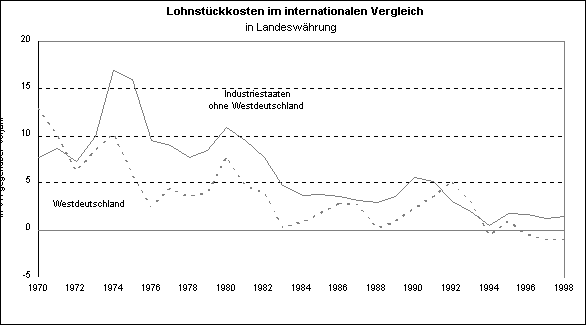
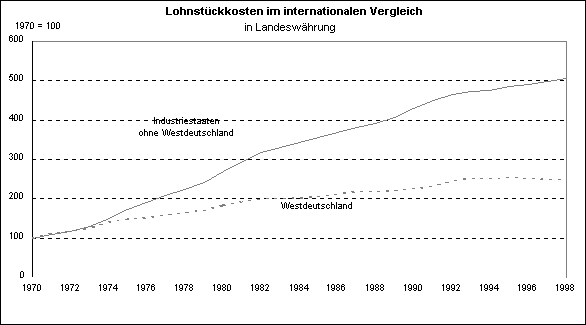
Jahre zu wünschen übrig läßt. Flexible Wechselkurse haben nicht nur, wie das allgemein in der Wissenschaft erwartet worden war, Wettbewerbsvorsprünge einzelner Volkswirtschaften ausgeglichen, sondern haben eigenständige Auswirkungen auf die Wettbewerbsposition von Volkswirtschaften gehabt, weil die Wechselkursänderungen häufig weit über die Differenzen in den Preis- und Kostenverhältnissen hinausgegangen sind.
noch Abbildung 10
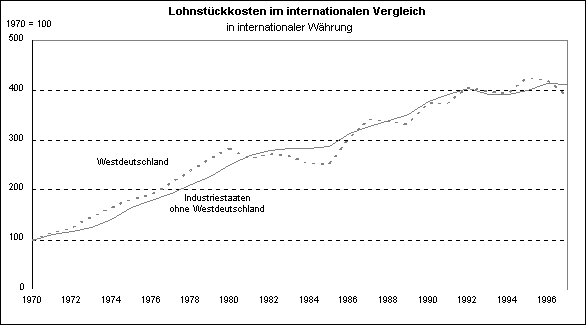
Solche realen Wechselkursänderungen sind es wohl, die immer wieder der Diskussion um den Verlust von Wettbewerbsfähigkeit einer ganzen Volkswirtschaft neue Nahrung geben. Es ist durchaus bezeichnend, daß diese Diskussionen vor allem in den Ländern geführt werden, die eigentlich sehr wettbewerbsfähig sind. Trotz der Probleme einer gesamtwirtschaftlich angemessenen Informationsverarbeitung an den Devisenmärkten ist aber nur als abwegig zu bezeichnen, daß offenbar von vielen Seiten in Deutschland geglaubt wird, die Lohnstückkosten könnten in Deutschland wegen zu hoher Löhne oder Lohnnebenkosten und nicht wegen des Wechselkurses deutlich über dem Niveau der wichtigsten Konkurrenten auf dem Weltmarkt liegen.
Eine Volkswirtschaft, deren Löhne und Lohnnebenkosten sehr viel stärker als im Ausland steigen, ohne daß sich die Währung abwertet, stößt rasch an wirtschaftliche Grenzen. Der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit zeigt sich schon unmittelbar nach Beginn des „Über-die-Verhältnisse-Lebens". Die Handels- und Leistungsbilanz passiviert sich, und die Arbeitslosigkeit steigt in einer offenen Volkswirtschaft im Vergleich zu der der Handelspartner. All dies ist in Westdeutschland (im Gegensatz zu Ostdeutschland) nicht zu beobachten: Die Handels- und Leistungsbilanz war bis zum Beginn der 90er Jahre in Westdeutschland wie in Japan von stark steigenden Überschüssen gekennzeichnet, und die Situation am Arbeitsmarkt war bis zum Jahr 1993 deutlich besser als in fast allen industrialisierten Ländern der Welt einschließlich der USA. Im Jahre 1996 hat Deutschland trotz des anhaltenden Importsogs, der von Ostdeutschland ausgeht, wieder einen Handelsbilanzüberschuß von knapp 100 Mrd. DM erzielt. In diesem Jahr wird der Handelsbilanzsaldo weiter steigen, so daß die Leistungsbilanz 1997 wieder ausgeglichen sein wird.
Einen erheblichen Rückstand bei den Lohnkosten aufzubauen, ohne daß sich die eigene Währung abwertet, ist folglich praktisch unmöglich. In der Tat haben ja auch die beiden Länder, die in den vergangenen Jahrzehnten zumeist hohe Überschüsse im Außenhandel erzielten, nämlich Deutschland und Japan, permanent auf- und nicht abgewertet. Wäre in Deutschland tatsächlich ein Rückstand bei den Lohnkosten entstanden, könnte es nicht bei den anderen wirtschaftlichen Zielen - im Außenhandel, bei der Preisstabilität und bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit - besser abschneiden als die meisten Handelspartner. Insofern leidet die Standortdebatte in Deutschland nicht nur an einem Mangel an Kenntnis der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge und der Genesis der Probleme, sondern auch an einem eklatanten Mangel an internationaler Perspektive.
Nur kurzfristig können massive, spekulativ verstärkte Aufwertungen die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes so nachhaltig beeinträchtigen, daß selbst bei dem Versuch der Geldpolitik, dies durch Zinssenkungen auszugleichen, spürbare negative gesamtwirtschaftliche Wirkungen zu beobachten sind. Das war etwa 1995 in Deutschland und, in noch weit größerem Maße, in Japan der Fall. Auf solche spekulativ verstärkten Wechselkursschwankungen kann und sollte die Lohnpolitik nicht reagieren. Die Volatilität der Wechselkurse ist viel zu groß und die Gefahr einer nochmaligen Verstärkung einer Aufwertung durch Lohnsenkung viel zu virulent, als daß man in der Wissenschaft - also außerhalb der interessengeleiteten Debatte in der Öffentlichkeit - den Ausgleich von wechselkursbedingten Veränderungen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch die Lohnpolitik überhaupt ernsthaft diskutieren könnte. So kommt auch ein Autor, der der Lohnpolitik aus seiner neoklassischen Grundauffassung heraus eine bedeutende Rolle für die Determination der Beschäftigung zuweist, zu dem Ergebnis: „Seriöserweise kann man bei beweglichen Wechselkursen nicht behaupten, daß die Lohnpolitik allemal das letzte Wort hat bei der Bestimmung des Kostenniveaus, das für eine Volkswirtschaft im internationalen Wettbewerb zählt. Dann darf man sich nicht wundern, wenn die Lohnpolitik eine solche Rolle als unzumutbar ablehnt. Die Lohnpolitik soll und muß beschäftigungspolitische Verantwortung tragen. Sie muß dabei für Fehler einstehen. Aber doch nur für eigene Fehler, nicht für Fehler, die in anderen Ländern gemacht werden und die ein beweglicher Wechselkurs ihr mit vor die Füße legt". [ Sievert (1997), S. 11.]
Alles in allem war die deutsche Lohnpolitik in den vergangenen Jahrzehnten im internationalen Vergleich von einer großen Zurückhaltung gekennzeichnet. Nur wegen dieser dauerhaften Zurückhaltung konnte Deutschland sowohl im Außenhandel als auch bei der Preisstabilität und lange Zeit sogar bei der Beschäftigung - wiederum im internationalen Vergleich - außergewöhnlich gut abschneiden. Diese Aussage gilt sowohl für die eigentlichen Lohnkosten als auch für die Lohnnebenkosten. Die gesamten Arbeitskosten in Westdeutschland haben sich immer weit besser an die von der Produktivitätsentwicklung vorgegebenen Verteilungsspielräume angepaßt, als das bei den wichtigsten Handelspartnern der Fall war. Alles, was heute als Arbeitskosten je Stunde zu Buche schlägt, ist durch die Arbeitsproduktivität je Stunde voll gedeckt; diese Arbeitskosten sind heute sogar in höherem Maße gedeckt als jemals zuvor in den letzten 15 Jahren, d. h. die Verteilungssituation für die Unternehmen (was nicht in jedem Fall mit der Gewinnsituation gleichzusetzen ist) hat sich in dieser Zeit dauernd verbessert. Mehr kann die Lohnpolitik niemals erreichen. Wenn es ein Problem der Lohnnebenkosten gibt, dann nur in dem Sinne, daß eine Finanzierung versicherungsfremder Leistungen über die Sozialversicherungen unter Effizienzgesichtspunkten nicht optimal ist. Dafür, daß eine Senkung der Lohnnebenkosten und die Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen etwa über Steuern große Beschäftigungseffekte haben könnte, gibt es allerdings wenig handfeste Belege. Jedenfalls müßte man dazu auf eine neoklassische Beschäftigungstheorie zurückgreifen, deren theoretische Basis, wie dargelegt, nichts mit den Bedingungen zeitlich und räumlich offener Volkswirtschaften zu tun haben, in denen wir leben.
Das System der Lohnfindung in Deutschland hat sich damit bewährt. Ein Land, das im internationalen Vergleich so erfolgreich ist, kann im Ganzen kein ungeeignetes Lohnregime aufweisen. Das gilt für den Flächentarifvertrag ebenso wie für die paritätische Finanzierung der sozialen Absicherung. Beide haben den zentralen Test für jede Art der Lohnpolitik, nämlich die Anpassung an die Produktivität ohne inflatorische Übersteigerung, weit besser als die weitaus meisten Systeme im Ausland bestanden. Das bedeutet freilich nicht, daß jedes Detail des deutschen Systems damit bestätigt wäre. Sicherlich lassen sich im einzelnen Möglichkeiten der Flexibilisierung finden, die das Gesamtergebnis noch verbessern. Die bewährten Systeme aber aufzugeben und gegen unerprobte Reißblattvorstellungen auszutauschen, mit der zentralen Begründung, die deutschen Lohnkosten seien „zu hoch", kann allerdings nur unverantwortlich genannt werden.
Die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland ist also nicht Ausdruck einer Standort-, sondern einer Wachstumsschwäche. Wäre sie Ausdruck einer Standortschwäche, bliebe aus Sicht der Vertreter der „Standortdebatte" wie aus derer, die die These von der strukturellen Arbeitslosigkeit vertreten, unerklärlich, warum der Westen Deutschlands bis Anfang der 90er Jahre eine im internationalen Vergleich weit unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote hatte, die in etwa derjenigen der USA entsprach. Auch bliebe unerklärlich, warum Gesamtdeutschland trotz des vereinigungsbedingten Anstiegs der Arbeitslosenquote immer noch besser abschneidet als Frankreich, Italien, Spanien und andere westeuropäische Länder.
5. Wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen
5.1 Angebotspolitik in den Industrieländern ist nicht ausreichend
Die Ursachen der Arbeitslosigkeit in Europa liegen also nicht in „strukturellen Verhärtungen" am Arbeitsmarkt oder mangelnder Flexibilität der Wirtschaft insgesamt. Die entscheidende Ursache der Arbeitslosigkeit in Europa ist ein sich über 15 Jahre erstreckender Anpassungsprozeß, der schließlich zu einer Angleichung der Inflationsraten nach unten im Vorfeld der Europäischen Währungsunion geführt hat. Hysteresis-Effekte spielen beim Entstehen des hohen Sockels an Arbeitslosigkeit sicher eine nicht unbedeutende Rolle, sie sind aber, wie der immense Beschäftigungsaufbau im Zuge der deutschen Vereinigung bewiesen hat, nicht unüberwindbar. Zwar ist ein solches nachfrageseitiges Fiskalprogramm nicht wiederholbar, aber die monetären Bedingungen lassen sich, wie das Beispiel USA in den 90er Jahren zeigt, so gestalten, daß über eine hohe Investitionsdynamik ein vergleichbarer Beschäftigungsaufbau eingeleitet werden kann.
Die Möglichkeiten der Angebotspolitikhingegen hingegen sind weitgehend ausgereizt. Während der gesamten 80er Jahre verfolgten alle westeuropäischen Länder - mehr oder weniger ausgeprägt - eine Politik des knappen Geldes, der Konsolidierung der Haushalte, der steuerlichen Entlastung der Gewinne und der Deregulierung von Güter-, Kapital- und Arbeitsmärkten. Unter dem Druck der hohen Arbeitslosigkeit mäßigten die Gewerkschaften durchweg ihre Lohnforderungen. In Folge dieser Entwicklung haben sich zwar die Sachkapitalrenditen in ganz Europa stark verbessert. Doch die Arbeitsmarktentwicklung blieb hinter den Erwartungen zurück. Schließlich hat die Rezession Anfang der 90er Jahre alle angebotsseitigen Anstrengungen zur Senkung der Arbeitslosigkeit wieder zunichte gemacht. Jetzt wiederholt sich die Entwicklung von Anfang der 80er Jahre: Anhaltend hohe Realzinsen und eine schwache Konsumnachfrage bremsen die Investitionstätigkeit und vergrößern den Schuldendienst der öffentlichen Haushalte. Die steigende Massenarbeitslosigkeit führt über mehr Sozialausgaben und Steuerausfälle zu einem weiteren Anstieg der Staatsverschuldung. Die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung werden europaweit fortgesetzt und bremsen die verhaltene Aufwärtsentwicklung. Die Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften dämpft zwar den Preisanstieg und verbessert die internationale Wettbewerbsfähigkeit, dies geht aber zu Lasten einer Expansion der Binnennachfrage. Derzeit versucht Kontinentaleuropa insgesamt, mit einer Strategie der realen Abwertung gegenüber dem Rest der Welt seine Beschäftigungsprobleme zu mildern.
Die europäische Arbeitslosigkeit kann nicht abgebaut werden, wenn die Wirtschaftspolitik nur auf der Angebotsseite ansetzt und die Geldpolitik - weitgehend ohne Abstimmung mit der übrigen Wirtschaftspolitik - nur auf die Erhaltung von Preisstabilität ausgerichtet ist. Um es an der gegenwärtigen Lage zu illustrieren: Es werden Jahr für Jahr im Inland hohe Ersparnisse gebildet, aber niemand ist bereit, sich zu verschulden: Die privaten Haushalte nicht, weil sie keine günstigen Einkommensperspektiven haben, die Unternehmen nicht, weil die Nachfrageerwartungen schlecht und die Realzinsen noch immer hoch sind, der Staat nicht, weil er europaweit versucht, die laufenden Defizite im Zuge der Anpassung an die Maastricht-Kriterien drastisch abzubauen. Bleibt das Ausland! Alle Länder in Europa setzen darauf, daß sich das Ausland verschuldet, und versuchen, über Kostensenkung und Sozialabbau dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Das kann nicht gutgehen. Europa insgesamt kann auf diesem Weg seine Probleme nicht lösen, da der Anteil des Außenhandels am Inlandsprodukt mit weniger als 10 vH zu gering ist und die übrigen Länder dies nicht hinnehmen können. Eine Aufwertung der europäischen Währungen ist daher unvermeidbar, setzt Europa diese Politik fort, ist gar ein Zerfall der Welthandelsordnung durch einen Abwertungswettlauf zu befürchten.
Die kurz- und mittelfristige Lösung liegt aber in Europa selbst und ist ganz einfach: Entweder es gelingt, über forcierte Zinssenkungen die Unternehmen zum Investieren zu bewegen, oder die Staaten Europas müssen den Versuch aufgeben, ihre Verschuldung zu vermindern, weil sie damit die Nachfrageseite weiter destabilisieren.
Die hohe Arbeitslosigkeit bedroht nicht nur die Fortführung des europäischen Integrationsprozesses; sie gibt zudem neuen Heilslehren Auftrieb. Die Lehre des Protektionismus á la Le Pen und Haider verspricht, den nationalen Wohlstand durch eine teilweise Abschottung des eigenen Landes zu erhöhen oder wenigstens zu sichern. Tatsächlich lehrt die historische Erfahrung, daß sich hierdurch sowohl die inländischen als auch die ausländischen Einkommen vermindern. Die Auffassung, man könne nur über tiefe Einschnitte in das soziale Netz die internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern und den eigenen Lebens- und Sozialstandard wahren, ist ebensowenig erfolgversprechend. Tatsächlich gerät hierdurch die soziale Stabilität in Gefahr, ohne daß sich die „Wettbewerbsfähigkeit" steigern ließe. Beiden Lehren fehlt eine ökonomische Basis; indes scheint ihnen die hohe Arbeitslosigkeit und das schwache Wachstum eine gesellschaftliche Basis zu verschaffen.
Die aktuelle Lageanalyse ist vom Kopf auf die Füße zu stellen: Nicht die Verringerung der Weltmarktintegration vermindert die Arbeitslosigkeit, sondern die Verminderung der Arbeitslosigkeit durch eine geeignete Wachstumspolitik ist die Voraussetzung für die Bewahrung des erreichten Integrationsniveaus und seiner Fortführung. Gerät dieses in Gefahr, leidet nicht nur der Wohlstand der Industrieländer, sondern auch derjenige der Entwicklungsländer - mit unabsehbaren politischen Folgen.
Nach allen vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen ist die weitverbreitete Vorstellung, die Industrieländer seien durch den Konkurrenzdruck der Entwicklungsländer gezwungen, ihre Produktivität stärker zu steigern und gleichzeitig ihre Kosten zu senken, in dieser pauschalen Form unzutreffend. Ebensowenig zu halten ist die Vorstellung, wegen des zunehmenden Konkurrenzdrucks habe sich die Arbeitslosigkeit im Norden verhärtet. Zwar geraten im Zuge des weltwirtschaftlichen Strukturwandels die arbeitsintensiven Branchen unter Konkurrenzdruck, doch entstehen in den humankapital- und technologieintensiven Branchen neue Absatzchancen. Beispielsweise konnte Deutschland im Handel mit Südostasien und Osteuropa seine Exporte von Erzeugnissen des Maschinenbaus, des Straßenfahrzeugbaus, der Elektro- und der Nachrichtentechnik besonders stark steigern. Die Industrieländer insgesamt verzeichnen gegenüber den Entwicklungsländern hohe - und zuletzt sogar steigende - Exportüberschüsse gerade im Bereich der hochwertigen Industriegüter. Das spricht eher für den Export von Arbeitslosigkeit als für den von Arbeit.
Im Zuge des Strukturwandels fallen natürlich Arbeitsplätze in bestimmten Regionen und Branchen sowie bei bestimmten Qualifikationen weg, während in anderen Regionen und Branchen neue entstehen; damit kann die Arbeitslosigkeit in einigen Arbeitsmarktsegmenten steigen, während sie in anderen abnimmt. Das war immer so. In Zeiten schwachen Wachstums und hoher Arbeitslosigkeit fallen diese Kosten des Strukturwandels allerdings stärker ins Gewicht als bei großer wirtschaftlicher Dynamik. Damit entsteht für die Wirtschaftspolitik größerer Druck, Arbeitsplätze in bestimmten Regionen und Branchen zu erhalten. Politiker folgen diesem Druck, weil es um ihre eigene regionale politische Basis geht. Langfristig kann man hierdurch aber nichts erreichen. Es werden lediglich immer mehr Steuergelder für Subventionen gebunden.
Angebotspolitik stößt auch deswegen auf Grenzen, weil für Europa insgesamt - mit seinem geringen Außenhandelsanteil - mit der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit nichts zu gewinnen ist. Notwendig ist vielmehr, von der Geld- und Finanzpolitik auf der einen Seite sowie der Lohnpolitik auf der anderen die Voraussetzungen für eine dynamische Investitionstätigkeit zu schaffen. Notwendig ist darüber hinaus, frühzeitig die Folgen des Strukturwandels im allgemeinen abzuschätzen, Problembranchen und -regionen zu identifizieren und die Ansiedlung neuer Branchen, insbesondere des Dienstleistungssektors, zu begünstigen. Auch müssen Anreize für eine größere intersektorale und interregionale Mobilität der Arbeitnehmer gegeben werden.
5.2 Sozialstandards, Sozialdumping und der internationale Handel
Die Wirtschaftskraft der Entwicklungsländer ist deutlich geringer als diejenige der Industrieländer. Der wirtschaftliche Austausch zwischen dem „Norden" und dem „Süden" ist für den Süden daher von wesentlich größerer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung. Im Süden sind 11 vH aller Erwerbstätigen für den Export in den Norden tätig, im Norden hingegen nur 6 vH für den Export in den Süden. 10 vH des gesamten Kapitalstocks des Südens ist aus Mitteln des Nordens finanziert worden; dies entspricht nur 2 vH des Vermögens im Norden. Der Norden trägt daher eine besondere Verantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung des Südens: Durch offene Märkte und unbeschränkten Kapitalverkehr erleichtert er die exportgetragene Industrialisierung der aufstrebenden Schwellen- und Entwicklungsländer und ermöglicht dort die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und steigenden Einkommen. Für die Entwicklungsländer ist der unbehinderte Zugang zu den Märkten der Industrieländer von wesentlich größerer Bedeutung als dessen Entwicklungshilfe („trade, not aid").
Die Förderung des Wirtschaftswachstums in den ärmeren Ländern ist nicht nur aus entwicklungs-, sondern auch aus stabilitätspolitischen Gründen notwendig. Der politische Einfluß der bevölkerungsreichen Entwicklungsländer wird in den nächsten Jahrzehnten deutlich zunehmen. Nach westlichen Schätzungen werden bis zum Jahr 2000 bereits drei Dutzend von ihnen Massenvernichtungswaffen besitzen. Die überwiegende Mehrzahl dieser Länder verfügt, bedingt durch das rasche Bevölkerungswachstum, über eine sehr junge Bevölkerung. Wenn es nicht gelingt, die Voraussetzungen für angemessene Beschäftigung und steigende Einkommen dieser Menschen zu schaffen, kann sich aus dem Problem der großen weltweiten Einkommensunterschiede ein nicht zu unterschätzender sozialer und politischer Sprengsatz entwickeln.
Das niedrige Lohn- und Sozialleistungsniveau der Entwicklungsländer ist Voraussetzung für deren internationale Wettbewerbsfähigkeit in arbeitsintensiven Branchen. Es ist unmittelbar Reflex des im Vergleich zu den Indsutrieländern wesentlich niedrigeren wirtschaftlichen Entwicklungs- und damit Produktivitätsniveaus. Oftmals wird das geringe Lohn- und Sozialleistungsniveaus aber mit anderen Faktoren erklärt. Genannt werden etwa das Verbot gewerkschaftlicher Betätigung und Arbeitsformen sowie die Nichterfüllung von Mindestanforderungen an den Schutz der Gesundheit und menschlichen Würde. Dies betrifft insbesondere die Kinderarbeit. In den Industrieländern wird daher vielfach gefordert, daß die Entwicklungsländer bestimmte Sozialstandards einhalten und daß dies von Seiten der Industrieländer über Handelssanktionen durchgesetzt wird.
Im Rahmen der Globalisierungsdebatte in Deutschland kommt der Frage, welche Rolle Sozialstandards in Entwicklungs- und Industrieländern im Hinblick auf ihre Wettbewerbsfähigkeit spielen, große Bedeutung zu. Von Arbeitgeberseite wird mit dem Argument zunehmenden Konkurrenzdrucks auf dem Weltmarkt eine Verringerung der Sozialstandards in den Industrieländern gefordert, von Gewerkschaftsseite wird die Verbesserung der Sozialstandards in den Entwicklungsländern angemahnt, wobei dieser Forderung u.U. auch durch Handelssanktionen Nachdruck zu verleihen sei. Welche Erfolgs - und Realisierungschancen haben diese beiden gegensätzlichen Strategien? Was bedeuten sie für Wachstum und Einkommensverteilung in und zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern?
5.2.1 Sozialstandards sind Lohnsubstitute
Sozialstandards sind unter Kostengesichtspunkten Lohnsubstitute. Eine Gesellschaft kann sich entscheiden, soziale Absicherung und Partizipation am Produktionsergebnis stärker über soziale Regelwerke wie die Renten-, Gesundheits- und Arbeitslosenversicherung oder über rein individuelle Versorgungsmaßnahmen zu betreiben. Sieht man von möglichen Ineffizienzen der Sozialversicherungssysteme, die Wachstumsverluste mit sich bringen könnten, einmal ab, spielt die Aufteilung der Arbeitskosten in Sozialstandards und Lohnhöhe bzw. die Umsetzung von Produktivitätswachstum in Erhöhung der Sozialstandards und/oder in Lohnzuwächse aus Unternehmer- wie Arbeitnehmersicht keine Rolle. Denn insgesamt kann in einer Periode niemals mehr verteilt werden, als erwirtschaftet worden ist.
Diese Budgetrestriktion gilt in einer geschlossenen Volkswirtschaft dauernd, in einer offenen zumindest längerfristig. Ein Land mag sich vorübergehend bei anderen verschulden, um Importüberschüsse zu finanzieren und damit mehr als das eigene Produktionsergebnis verteilen zu können. Das funktioniert dann, wenn andere Länder Kredite vergeben, also Exportüberschüsse erwirtschaften. Die Bereitschaft zur Kreditvergabe hängt aber vom Vertrauen der Gläubigerländer in die Fähigkeit des Schuldnerlandes ab, auf Dauer seine Schulden bedienen zu können. Dazu ist das Schuldnerland nur in der Lage, wenn es früher oder später selbst Exportüberschüsse erzielt. Das heißt, auf lange Sicht müssen alle gesellschaftlichen Gruppen eines Landes ihre Einkommensansprüche an das inländische Produktionsergebnis anpassen. Nur durch Umvertei-lung innerhalb eines Landes kann sich eine Gruppe zu Lasten einer anderen langfristig besser stellen.
Welche Aufteilung des Produktionsergebnisses auf Löhne, Sozialstandards und Gewinne ist dem Wohlstand der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen am förderlichsten? Diese Frage ist nicht unabhängig von der Ausstattung einer Nation mit wirtschaftlichen Ressourcen und ihrer politischen Kultur, d.h. ihrer Identität im Hinblick auf soziale, religiöse und politische Gegebenheiten und Traditionen, zu beantworten. Solange eine Nation souverän ist, muß sie selbst entscheiden, welche Verteilungsregeln in ihren Grenzen gelten sollen. Andere Nationen oder Individuen aus anderen Nationen können beratend tätig werden, Nachteile bestimmter Lösungen aufzeigen, auf die Wechselwirkungen von Verteilungsregeln und Wachstum – gerade im Zusammenhang mit der Globalisierung – aufmerksam machen und Alternativen anbieten. Welchen Preis hinsichtlich der Verteilung beispielsweise eine Gesellschaft für ein höheres Wachstumstempo zu zahlen bereit ist, müssen die Berater den Betroffenen überlassen.
Letzten Endes dürften sich aber – das hat etwa die jüngste Entwicklung in Südkorea gezeigt – Verteilungsregeln einstellen, die den ökonomischen Knappheitsverhältnissen Rechnung tragen. Das bedeutet, daß das Lohnniveau eines Landes (unter Einbeziehung der Sozialstandards) in der Regel das Niveau der Arbeitsproduktivität widerspiegelt. Treiben Länder mit niedrigen Löhnen freien Handel mit Ländern, in denen vergleichsweise hohe Löhne gezahlt werden, sind erstere daher nicht systematisch im Vorteil.
5.2.2 Sozialdumping als Instrument?
Warum fühlen sich dennoch Unternehmen aus Hochlohnländern einem zunehmenden Konkurrenzdruck am Weltmarkt von seiten der Niedriglohnländer ausgesetzt? Die Technologie, die den Produktivitätsvorsprung der Hochlohnländer begründet, diffundiert Schritt für Schritt in die Niedriglohnländer, in denen ein entsprechender Kapitalstock aufgebaut wird. Folglich verlieren die Industrieländer laufend Teile der Produktion an die Entwicklungsländer. Zwar gewinnen sie gleichzeitig neue Märkte (sie liefern z.B. die zum Kapitalstockaufbau benötigten Investitionsgüter an die Entwicklungsländer), das wird aber nicht zur Kenntnis genommen, wenn gleichzeitig der Druck auf die Unternehmen in den Hochlohnländern aus ganz anderen Gründen, wie einer allgemeinen Rezession oder verschärftem intertemporalen Strukturwandel, zunimmt. Dem spezifischen Druck des internationalen Strukturwandels kann man sich bei offenen Warenmärkten aber letztlich ebensowenig entziehen wie dem Strukturwandel, der sich durch Neuerungen der Technik oder durch den Wandel der Nachfragestrukturen ergibt. Dennoch stehen hier defensive Strategien, wie allgemeine Kostensenkung, viel häufiger im Zentrum der politischen Diskussion als sonst.
Eine defensive Strategie besteht darin, heimische Produktivitätssteigerungen nicht in entsprechende Lohnsteigerungen oder höhere Sozialstandards umzusetzen, sondern die Lohnstückkosten zu senken. Die Unternehmen des Landes, das eine solche Strategie wählt, können am Weltmarkt zu günstigeren Preisen anbieten und auf diese Weise Marktanteile gewinnen, ohne im Bereich der Innovation erfolgreich gewesen zu sein. Die dabei entstehenden Exportüberschüsse müssen mittel- bis langfristig aber zu einer nominalen Aufwertung der eigenen Währung oder zu einer vergleichbaren Kostensenkung der anderen Länder führen. Ein auf diesem Wege erzielter Marktanteilsgewinn der Unternehmen des real abwertenden Landes kann nicht auf Dauer gehalten werden. Im Endergebnis ist für alle Länder zusammen keine Wachstumssteigerung entstanden, je nach mittel- bis langfristiger Währungskonstellation allenfalls eine temporäre Umverteilung zwischen den Ländern (beggar-my-neighbour-Politik).
Eine offensive Strategie hingegen setzt darauf, durch Innovationen neue Märkte zu finden und sich so an der Spitze der Produktivitäts- und damit der Lohn- bzw. Einkommenshierarchie zu halten. Nur dadurch kann es zu dauerhaftem Wachstum für alle Beteiligten bei freiem Handel kommen.
So sehr die Überlegung einleuchtet, daß die Weltwirtschaft durch innovatives Unternehmerverhalten wächst, während ein Kostensenkungswettlauf, soweit er nicht Ergebnis der Beseitigung von Ineffizienzen ist, bestenfalls ein Null-, wenn nicht gar ein Negativsummenspiel bedeutet, so schwer ist es, sie in konkret anwendbare Regeln des internationalen Handels umzusetzen. Ob ein Land dadurch, daß Produktivitätswachstum nicht an die Löhne weitergegeben wird, mittels realer Abwertung eine Art Dumping am Weltmarkt veranstaltet und sozusagen unter seinen Verhältnissen lebt, kann zwar anhand des realen Außenwertes seiner Währung festgestellt werden. Ob einer solchen Verhaltensweise jedoch mit Protektionismus der davon in negativer Weise betroffenen Länder begegnet werden sollte, ist eine ganz offene Frage. In der Regel wird man im Rahmen der WTO erst reagieren, wenn diskriminierende Praktiken hinsichtlich einzelner Güter oder einzelner Anbieter zur Anwendung kommen. Abwertungsstrategien oder kompetitive Steuer- und Abgabensenkungen jeglicher Art sind jedenfalls bisher nicht Gegenstand der Verhandlungen über den internationalen Handel gewesen. Fraglich ist nämlich, ob den negativ von z.B. Abwertungsstrategien betroffenen Ländern gleiche „Waffen" zur Verfügung stehen wie den „Aggressoren", und welche Gruppe(n) in dem Land, das die Abwertungsstrategie praktiziert, ein entsprechendes Abwehrverhalten der übrigen Länder träfe.
Wie starkem Druck ein Land ausgesetzt ist, die Löhne und/oder die Sozialstandards der Produktivitätsentwicklung anzupassen, hängt wesentlich vom vorherrschenden Lohnverhandlungssystem ab. In Ländern, in denen die Lohnverhandlungen hauptsächlich auf Betriebsebene stattfinden, ist eine zentrale Kontrolle des landesweiten Ergebnisses und ein bewußtes Zurückbleiben hinter der durchschnittlichen oder der betrieblichen Produktivitätszunahme kaum durchsetzbar, weil beispielsweise Informationen über die zu erwartende Geschäftsentwicklung oder Lohnerhöhungen in anderen Betrieben in die Verhandlungen einfließen. Länder mit einer wenig stark verankerten Tarifautonomie bzw. einem großen Einfluß des Staates auf die Ergebnisse der Tarifverhandlungen (Beispiel Niederlande oder Österreich) und/oder stark zentralisierten Lohnverhandlungen können dagegen eine Abwertungsstrategie viel leichter umsetzen.
Dem Schutz, den ein Lohnverhandlungssystem auf Betriebsebene gegen eine Abwertungsstrategie bietet, steht allerdings der Nachteil gegenüber, daß ein solches System Pioniergewinne in weit geringerem Maße honoriert als Systeme zentraler Verhandlungen und insofern innovations- und damit wachstumsfeindlich ist. Bei einem zentralisierten Verhandlungssystem sind die Pioniergewinne größer, weil sie nicht sofort in betrieblichen Lohnverhandlungen zur Disposition stehen. Länder mit starker Tarifautonomie und einem mittleren Zentralisierungsgrad, wie er bei branchenweiten Tarifverhandlungen vorliegt, dürften gegen die Gefahren beider Extreme am besten geschützt sein.
Da in vielen Entwicklungsländern dezentrale Lohnverhandlungssysteme vorherrschen und darüberhinaus der Ausgleich der Preissteigerungsraten üblicherweise durch Indexierungsklauseln gesichert ist, steht diesen Ländern eine Abwertungsstrategie kaum zur Verfügung. Insofern ist die Erwartung, daß sich das Wachstum in den Entwicklungsländern auf Dauer in Lohnsteigerungen und/oder einer Verbesserung von Sozialstandards niederschlägt, durchaus realistisch. Eine dauerhafte Niedriglohnkonkurrenz von Seiten eines einzelnen aufholenden Landes gibt es nicht.
5.2.3 Sozialstandards und Menschenrechte
Wenn jedoch kurzfristig die Verteilungsmechanismen in den aufholenden Ländern Lohnanpassungen deutlich unterhalb des Produktivitätswachstums zulassen und so die Unternehmen der Hochlohnländer und mit ihnen die dortigen Arbeitnehmer unter Dumping - Druck geraten, oder andere Tatbestände vorliegen, die gegen allgemein anerkannte Regeln in den Industrieländern verstoßen, sind dann Handelssanktionen sinnvoll, um die Verhaltensweisen und die institutionellen Voraussetzungen in den Niedriglohnländern zu verändern?
Entsprechend den Regeln des Zusammenlebens zwischen Bürgern und sozialen Gruppen in einem demokratischen Rechtsstaat werden Nationen höchstens dann politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Druck auf eine andere Nation ausüben, wenn diese gegen allgemein akzeptierte Verhaltensregeln verstößt. Solch eine Regel ist die Einhaltung der Menschenrechte. Ob der Druck der Gemeinschaft auf einzelne oder andere Gemeinschaften allerdings etwas bewirkt, schlicht verpufft oder die Lage sogar verschärft, kann nicht allgemein, sondern nur nach Lage der Dinge im Einzelfall beurteilt werden.
Wer generell für richtig hält, daß bei der Verletzung von Menschenrechten Druck auf andere Nationen ausgeübt wird, muß das für alle Arten von Menschenrechtsverletzungen vertreten. Wirtschaftlicher Druck im Sinne von negativen Sanktionen ist das Mittel, mit dem jedoch häufig gerade weniger die andere Nation im Ganzen, sondern bestimmte Gruppen getroffen werden, weil es fast immer vielen unmittelbar Betroffenen möglich ist, die Lasten auf andere abzuwälzen.
Die Beschränkung der Ausübung von Druck auf die Nichteinhaltung von Menschenrechten, die in engem Zusammenhang mit wirtschaftlicher Tätigkeit stehen (die Zulassung von Gewerkschaften, Verbot von Kinder- oder Zwangsarbeit), wirft zusätzliche Probleme auf. Eine gut funktionierende gewerkschaftliche Dachorganisation etwa wie in Deutschland gibt es in vielen Ländern nicht, wohl aber Gewerkschaftsvertreter auf Betriebsebene. In manchen Ländern wiederum gibt es beide Arten von Gewerkschaftsorganisationen, aber ein Verbot gewerkschaftlicher Arbeit in öffentlichen Betrieben. Welche Art von gewerkschaftlicher Betätigung erfüllt den Tatbestand, den beispielsweise die Sozialklausel „kein Verbot von gewerkschaftlicher Arbeit" beschreiben will? Zu berücksichtigen ist auch, daß die Betriebe in einigen Entwicklungsländern auch ohne Gewerkschaften häufig eine echte Patronatsfunktion für die Arbeitnehmer übernehmen, denen sie sowohl Rentenvorsorge als auch eine Absicherung bei Krankheit und gegen Arbeitslosigkeit bieten. Es gibt gut belegbare Beispiele dafür, daß sich selbst in sehr armen Ländern die Unternehmen nicht von Arbeitnehmern trennen können, ohne extrem hohe Abfindungen (bis zu 10 Jahresgehältern) zu zahlen.
Ähnlich ist es beim Verbot von Kinderarbeit. Für Kinder, die ansonsten in großer Armut oder gar in existentieller Not leben, können verschiedene Formen der Kinderarbeit lebensrettend für sich und unter Umständen sogar für ihre Familie sein. Wer wirtschaftlichen Druck ausübt, um die Einhaltung eines generellen Verbots von Kinderarbeit zu erzwingen, ohne eine Alternative für die Kinder direkt zu bieten oder zumindest zu finanzieren, verschlechtert unter Umständen die Situation der Kinder und ihrer Familien in dramatischer Weise. Das rechtfertigt natürlich nicht jede Art von Kinderarbeit, aber es setzt Grenzen für glaubhafte Sanktionsmöglichkeiten der reicheren Länder, wenn sie nicht bereit sind, für die finanziellen und humanitären Folgen ihrer normativen Ziele einzustehen.
Verbot von Kinderarbeit und Umweltschutzstandards, die die westlichen Industrieländer unter dem Druck von Handelssanktionen einfordern wollen, werden auch von den Gewerkschaften in den Entwicklungsländern abgelehnt. Die Gewerkschaften dort kämpfen zwar wie die Gewerkschaften in den Industrieländern um höhere Löhne und eine Verbesserung der sozialen Leistungen der Unternehmen oder des Staates. Wegen der zwingenden Logik, daß nicht mehr verteilt werden kann, als erarbeitet wird, kann man aber mit Druck von Seiten der Industrieländer lediglich versuchen, die Verteilungssituation in den Entwicklungsländern zugunsten der Arbeitnehmer zu beeinflussen. Wie das in jedem Fall sachgerecht zu bewerkstelligen wäre, kann angesichts völlig unterschiedlicher Voraussetzungen in diesen Ländern nicht allgemein entschieden werden. Es ist durchaus möglich, daß Handelssanktionen letztlich sogar zu einer Ver-schlechterung der Situation der Arbeitnehmer führen, weil durch Absatzeinbußen die Lohnstückkosten möglicherweise stark steigen. Je nach Macht- und Marktkonstellation können die Arbeitgeber diese Kostenentwicklung entweder in den Preisen weitergeben und so inflationäre Prozesse in Gang setzen, oder es entsteht unmittelbar Arbeitslosigkeit.
5.2.4 Wer im Glashaus sitzt...
In Anbetracht der Tatsache, daß viele Länder der westlichen Hemisphäre versuchen, über einen Abbau der sozialen Standards (Senkung der Lohnnebenkosten z.B.) und massiven Druck auf die Löhne „wettbewerbsfähig" zu bleiben oder zu werden, ist es kein Wunder, wenn die armen Länder einen wie auch immer gearteten Druck der reichen Länder, die sozialen Standards in den armen auszubauen, als eine neue Variante des Kampfes der Reichen um Weltmarktanteile ansehen. Glaubwürdig wären Forderungen der Industrieländer zum beschleunigten Aufbau sozialer Absicherung, des Verbots der Kinderarbeit oder der Einhaltung von Umweltschutzstandards nur, wenn diese Länder für die Einhaltung dieser globalen Standards zahlen. Das heißt: Die westlichen Länder haben ihren heutigen Wohlstand im Hinblick auf Konsumgüter zu einem erheblichen Teil der Ausbeutung von Menschen und Umwelt in der Vergangenheit zu verdanken. Wer den armen Ländern diese Möglichkeit nehmen will, muß bereit sein, sich für den Gewinn an globalem Nutzen, der damit verbunden ist, finanziell in Anspruch nehmen zu lassen. Tut er das nicht, ist er nur zynisch und verliert seine Glaubwürdigkeit. Forderungen zur Einhaltung sozialer Standards oder von Umweltstandards gehören daher vor die ILO, die UNO, die UNESCO oder sollten im Rahmen der UNCTAD diskutiert werden; sie dürfen aber nicht in die Verhandlungen der WTO Eingang finden.
Auch die häufig anzutreffenden Forderungen westlicher Unternehmen an ihre Lieferanten in Entwicklungsländern, vielfältige Standards einzuhalten, ist in dieser Weise zu beurteilen. Wenn der westliche Kunde wegen der Einhaltung solcher Standards höhere Preise akzeptiert bzw. eine langfristige Lieferbindung eingeht, die sonst nicht zustandegekommen wäre, sind seine Auflagen, die ihm ja im Westen einen Imagegewinn und damit geldwerte Vorteile bringen, gerechtfertigt. Ob die Lieferanten aus den Entwicklungsländern die entsprechenden Kosten allerdings auf den Abnehmer überwälzen können, hängt von der Marktmacht der Verhandlungspartner ab und kann daher nicht generell unterstellt werden. Erhalten die Entwicklungsländer keine Kompensation für die entstehenden Kosten, werden - wofür es leider eindeutige Beispiele gibt - Kinderarbeit und gravierende Umweltverschmutzung in die Sektoren abgedrängt, die nicht direkt für den Export produzieren. Den westlichen Unternehmen wie deren Kunden dienen solche „Auflagen" zur Gewissenberuhigung, ohne daß sich die Situation der Kinder oder der Umwelt in den armen Ländern insgesamt verbessert. Sie kann sich sogar verschlechtern, weil der Schutz der Kinder oder der Umwelt beispielsweise im sog. inoffiziellen Sektor viel weniger gut kontrolliert werden kann als bei exportierenden Betrieben.
Die Kontrolle von Maßnahmen, die der Westen in Entwicklungsländern durchzusetzen versucht, dürfte ohnehin schlicht unmöglich sein. Man stelle sich einmal vor, wie umgekehrt die Kontrolle in den Industrieländern, die von seiten der Entwicklungsländer dann zu recht eingefordert würde, aussehen sollte. Was geschähe, wenn z.B. die USA von Deutschland verlangten, kein Dumping über den Abbau von sozialen Leistungen zu betreiben? Dumping-Vorwürfe nachzuweisen ist – wie viele Fälle in der WTO zeigen – in der Regel schon auf der Ebene von einzelnen Unternehmen nahezu aussichtslos: Auf der Ebene der deutschen Wirtschaft und der Wirtschaftpolitik insgesamt ist es ausgeschlossen Hier Dumping nachzuweisen bedeutete nicht weniger, als die gesamte Diskussion um das Entstehen von Arbeitslosigkeit in Deutschland neu aufzurollen und z. B. darzulegen, daß die hiesige Arbeitslosigkeit nichts mit der Standortqualität zu tun hat. Das wäre ein gravierender Eingriff in die nationalen Belange Deutschlands, die eine souveräne Nation niemals akzeptieren würde.
Noch aussichtsloser wäre eine Quantifizierung von Sozialstandards. Welches etwa ist der Grad der Umweltverschmutzung und der Ausbeutung bestimmter Gruppen der Gesellschaft in einem wohlhabenden Land? In welcher Relation dazu sollte ein Land Menschen und Umwelt schützen, das nur ein Zehntel des Einkommens pro Kopf hat und in dem die Präferenzen der Menschen naturgemäß ganz andere sind?
Insgesamt gesehen führt die Diskussion um die Einhaltung von Menschenrechten sowie um Sozial- und Umweltstandards in den Entwicklungsländern in Verbindung mit internationalem Handel nicht weiter. Die Einhaltung von Menschenrechten sollte immer wieder angemahnt und auf die Vorteile dieser Einhaltung auch und gerade unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwiesen werden. Menschenrechte gleich welcher Art durch wirtschaftlichen Druck durchzusetzen ist moralisch fragwürdig, höchstwahrscheinlich wenig effizient und verleitet zum Mißbrauch. Die sozialen Standards werden sich in den Enwicklungsländern mit der Zunahme der Produktivität letztlich verbessern, selbst wenn der Weg dorthin langwierig und steinig ist. Untersuchungen internationaler Organisationen zeigen aber, daß in den Schwellenländern – wie früher in den Industrieländern – die Reallöhne in der Regel im Einklang mit der Produktivität steigen. Die westlichen Länder oder die westlichen Gewerkschaften können die Entwicklungsländer beraten, welcher Weg der sozialen Absicherung und der Erhöhung des Lebensstandards sinnvoll ist. Entscheiden müssen diese allein.
Nicht sinnvoll ist es auch, wenn Industrie- wie Entwicklungsländer in einen Kampf um Marktanteile treten, indem sie von Seiten der Politik die Löhne oder die realisierten Sozialstandards zu drücken versuchen, um die Kostenzunahme unter der Produktivitätszunahme zu halten. Dieser Versuch, die eigene Währung real, d.h. unter Berücksichtigung der Preissteigerungsdifferenzen abzuwerten, ist nichts anderes als ein Rückfall in die beggar-my-neighbour Politik der 30er Jahre. Dabei kann am Ende niemand gewinnen, weil nicht alle real abwerten können. Die Folge dieser Politik ist Deflation, weltweit steigende Arbeitslosigkeit und sinkende Absicherung der sozial Schwachen. Aber auch die Einhaltung von Regeln gegen den realen Abwertungswettlauf kann im internationalen Wettbewerb letztlich nicht über Handelssanktionen erzwungen werden. Die Folge wären neue Abwertungs- und Protektionismuswettläufe.
Bean, Charles R. 1989. ²Capital Shortages and Persistent Unemployment.² Economic Policy 10 : 12-53.
• 1994. ²European Unemployment: A Survey.² Journal of Economic Literature 32: 573-619.
Bertola, G./Ichino, A. 1995. ²Wage Inequality and Regional Unemployment Persistence: US vs. Europe.² NBER Macroeconomics Annual 1995.
Blanchard, Olivier Jean. 1990. ²Unemployment: Getting the Questions Right – and Some of the Answers.² In: Drèze/Bean 1990, pp. 66-89.
• 1996. ²How to Decrease Unemployment.² In: The 1990s Slump: Causes and Cures, Mario Baldassarri/Luigi Paganetto/Edmund S. Phelps, (eds.), pp. 281-291. Basingstoke/London: MacMillan.
––/Summers, Lawrence H. 1986. ²Hysteresis and the European Unemployment Problem.² NBER Macroeconomics Annual 1986: 15-78.
Borjas, George J. 1994. „The Economics of Immigration." Journal of Economic Literature 32: 1667-1717.
Bruno, Michael/Sachs, Jeffrey D. 1985. The Economics of Worldwide Stagflation. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Deutsche Bundesbank. 1997. Wechselkurs und Außenhandel. Monatsbericht Januar 1997, S. 43-62.
Drèze, Jacques H./Bean, Charles R., eds. 1990. Europe’s Unemployment Problem. MIT Press.
––/Malinvaud, Edmond. 1994. ²Growth and Employment: The Scope for a European Initiative.² European Economic Review 38: 489-504.
Flassbeck, Heiner 1996. "Die Weltwirtschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts und die Herausforderungen für den Westen". In: Produzieren im 21. Jahrhundert. Herausforderungen für die deutsche Industrie. Ergebnisse des Expertenkreises Zukunftsstrategien Band I, eds: Burkhart Lutz, Matthias Hartmann, Hartmut Hirsch-Kreinsen. ISF, München.
Flassbeck, Heiner/Brian Henry/Pierre Jacquet und Robert Levine. 1997. „Unemployment in the United States, Germany, France, and the United Kingdom: First Ideas, Common Features, Differences, and a Coherent Explanation". Manuskript.
Freeman, Richard B. 1995. „Are Your Wages Set in Beijing?" Journal of Economic Perspectives 9: 15-32.
Helliwell, John F. 1988. ²Comparative Macroeconomics of Stagflation.² Journal of Economic Literature 26: 1-28.
ILO. 1995. World Employment 1995: An ILO Report. Geneva: ILO.
IMF. 1997. „Globalization: Opportunities and Challenges." World Economic Outlook, May 1997: 45-116.
Jaeger, Albert und Martin Parkinson. 1994. ²Some evidence on hysteresis in unemployment rates.² European Economic Review 38: 329-342.
Kenen, Peter B. (Hg.). 1995. Understanding Interdependence: The Macroeconomics of the Open Economy. Princeton: Princeton University Press.
Krugman, Paul. 1995. ²Growing World Trade: Causes and Consequences.² Brookings Papers on Economic Activity 1/1995, pp. 327-377.
Landmann, Oliver/Jerger, Jürgen. 1993. ²Unemployment and the Real Wage Gap: A Reappraisal of the German Experience.² Weltwirtschaftliches Archiv 129: 689-717.
Lawrence, Robert Z. 1996. Single World, Divided Nations? International Trade and OECD Labor Markets. Paris: OECD.
Layard, Richard/Nickell, Stephen/Jackman, Richard. 1991. Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. Oxford: Oxford University Press.
Lindbeck, Assar. 1996. „The West European employment problem." Weltwirtschaftliches Archiv 132: 609-637.
––, und Dennis Snower. 1986. ²Wage Setting, Unemployment, and Insider-Outsider Relations.² American Economic Review 78, Papers and Proceedings: 235-239.
Modigliani, Franco. 1995. ²The Shameful Rate of Unemployment in the EMS: Causes and Cures.² Massachusetts : MIT, Manuskript.
Nickell, Stephen und Brian Bell. 1995. ²The Collapse in Demand for the Unskilled and Unemployment Across the OECD.² Oxford Review of Economic Policy 11, No. 1: 40-62.
OECD. Employment Outlook. Paris: OECD, verschiedene Ausgaben.
• 1994. The OECD Jobs Study: Evidence and Explanations, 2. Vol. Paris: OECD.
• 1995. The OECD Jobs Study: Implementing the Strategy. Paris: OECD.
• 1996. Technology, Productivity and Job Creation, Vol. 2: Analytical Report. Paris: OECD.
––, Hg., 1996. Macroeconomic Policies and Structural Reform. Paris: OECD.
Rowthorn, Robert. 1995. ²Capital Formation and Unemployment.² Oxford Review of Economic Policy 11, No. 1: 26-39.
Saint-Paul, Gilles. 1995. Dual Labor Markets: A Macroeconomic Perspective. Cambridge, M.A.: MIT Press.
Schumpeter, J.A. 1964. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 6. Auflage, Berlin
Sievert, Olaf. 1997. „Währungsunion und Beschäftigung". Vortrag, Veranstaltung der Leipziger Wirtschaftspolitischen Gesellschaft, Universität Leipzig.
Snower, Dennis J., und Guillermo de la Dehesa, Hg., 1997. Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Tanzi, Vito. 1995. Taxation in an Integrating World. Washington, D.C.: Brookings Institution.
Temin, Peter. 1997. „The Golden Age of European growth: A review essay". European Review of Economic History, I, 127-149.
Trabold, Harald. 1997). „Globalisierung: Falle oder Wohlstandsquelle? Wochenbericht des DIW. Nr. 23/97. Berlin.
Wood, Adrian. 1994. North-South Trade, Employment and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-Driven World. Oxford: Clarendon Press.
World Bank. 1995. World Development Report 1995: Workers in an Integrating World. New York: Oxford University Press.
![]()