

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

Flasche leer! : Die new economy des europäischen Profifußballs / Michael Ehrke ; Lothar Witte - [Electronic ed.] - Bonn, 2002 - 19 S. = 80 KB, Text & Image files . - (Globalisierung und Gerechtigkeit) - ISBN 3-89892-086-0
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2002
© Friedrich-Ebert-Stiftung
- Fußball und Fernsehen
- Fußball, ein Produkt sui generis
- Vom Stadion ins Wohnzimmer: Veränderte Konsumgewohnheiten
- Geburtsfehler des Pay-TV: Es gibt ein Leben jenseits des Decoders
- Wie gewonnen, so zerronnen: Die neue Ökonomie des Profifußballs
- Der Fußball-Arbeitsmarkt: Winner-takes-all
- Die Europäisierung des Profifußballs: Eine Lösung wird zum Problem
- Shareholder vs. Stakeholder: Ware Fußball vs. wahrer Fußball?
- Die politische Ökonomie des Profifußball: Der öffentliche Sektor
Flasche leer!Die new economy des europäischen Profifußballs
[Seite der Druckausg.: Titelblatt]
Michael Ehrke, Lothar Witte
Flasche leer!
Die new economy des europäischen Profifußballs
Mai 2002
Der europäische Profifußball droht in den Krisenstrudel
der privaten Medien zu geraten – siehe Kirch, den britischen
Privatsender ITV oder den französischen Canal+.
Doch die Seifenblase des Medienbooms, die den Fußball-Unternehmen astronomische
Zahlungen für die Übertragungsrechte von Fußballspielen bescherte,
überdeckte nur die strukturellen Defizite einer Branche, die nun eine Anpassungskrise
zu bestehen hat.
Der Profifußball ist mehr als eine Wirtschaftsbranche
unter anderen, er ist der Inbegriff akzeptierter Globalisierung - und Europäisierung:
Fußball ist eines der wenigen globalen Phänomene, bei denen die USA keine
führende Rolle spielen.
Was in den Netzwerken der großen Unternehmen als Tendenz angelegt ist,
ist im Profifußball Realität: Ein globaler Arbeitsmarkt,
ein globales Publikum, ein globales Produkt, das unter global geltenden Regeln erzeugt wird.
Der Profifußball ist eine Zukunftsbranche par excellence.
Er unterliegt aber wie andere Zukunftsbranchen den Krisen der Globalisierung –
wie die derzeitigen Probleme des europäischen Profifußballs zeigen.
[Seite der Druckausg.: 2]
Redaktionelle Verantwortung:
Michael Ehrke / Lothar Witte
Internationale Politikanalyse
Friedrich-Ebert-Stiftung, D-53170 Bonn
ISBN: 3-89892-086-0
Internationale Politikanalyse:
http://www.fes.de/indexipa.html
Internationale Politik und Gesellschaft:
http://www.fes.de/ipg/
Die Illustrationen zur Entwicklung der Aktienkurse wurden
übernommen von der website der comdirect bank, www.comdirect.de
Flasche leer!
Die new economy des europäischen Profifußballs
Michael Ehrke / Lothar Witte
"Und Sie sind sicher der Torwart".
Theodor Heuss, Bundespräsident, 1949-1959
"Ja, Herr Bundespräsident, ich bin der Torwart".
Max Morlock, Held von Bern, seit 1954
[Zitiert bei Norbert Seitz, Doppelpässe: Fußball & Politik, Frankfurt 1997, S. 8]
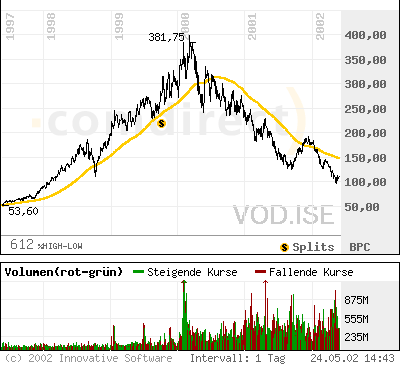
Vodafone, Aktienkurs seit Mai 1997
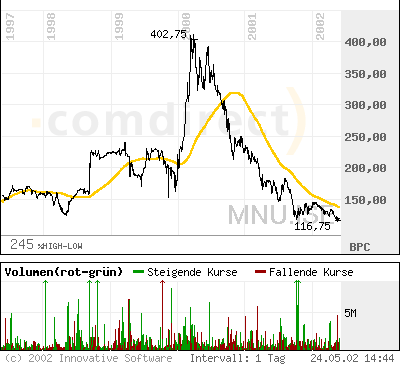
Manchester United, Aktienkurs seit Mai 1997
Fußball und Fernsehen
Die Pleite des Kirch-Konzerns und die Krise des englischen Pay-TV-Senders ITV sowie des französischen Canal+ hat in allen europäischen Ländern die Frage nach den wirtschaftlichen Perspektiven des Profifußballs aufgeworfen. Der Profifußball hatte sich in der vergangenen Dekade finanziell von den privaten Medienunternehmen abhängig gemacht, er hatte von den ins Astronomische steigenden Zahlungen für Übertragungsrechte profitiert, wurde damit aber auch zu einem Teil jener bubble economy, die von den drei Branchen Hochtechnologie (in erster Linie Informationstechnologie), Medien und Telekommunikation (TMT-bubble) ausging. So wie der Fußball von der Seifenblase profitierte, so hat er jetzt Anteil an deren Platzen und der ihm folgenden Bereinigungskrise.
Eine bubble entsteht, wenn "überzogene" Erwartungen und kumulativ wirkende Fehlentscheidungen wirtschaftlicher Akteure (die meist auf der Projektion aktueller Trends in die Zukunft
[Seite der Druckausg.: 4]
basieren) über einen längeren Zeitraum hinweg die wirtschaftlichen Rahmenbedingen bestimmen. In einer bubble entsteht ein gravierendes Missverhältnis zwischen dem Volumen der Transaktionen mit assets und dem Volumen der künftigen Einkommen, die sich aus der Nutzung dieser assets erzielen lassen. Im Fall der TMT-bubble war der Auslöser die sogenannte informationstechnische Revolution, die angesichts ihres technologischen Potentials wirtschaftliche Erwartungen auslöste, die sich unter anderem in den astronomischen Börsenkursen hochtechnologischer start-ups widerspiegelten, und die sich angesichts der realen Wirtschaftswachstums als nicht gerechtfertigt erwiesen. Die Erwartungen der Investoren wurden folgerichtig durch den Zusammenbruch der "Neuen Märkte" korrigiert.
Die an die Informationstechnologie geknüpften hochgespannten Erwartungen haben sich auf die Medienwirtschaft übertragen. Die informationstechnologische Revolution – die exponentiell wachsende Leistungsfähigkeit bei der Verarbeitung und Übertragung von Daten – bot eine neue Kommunikationsinfrastruktur für kommerziell verwertbare Inhalte. Die content provider – unter anderem die Medien – konnten für den Verkehr sorgen, den die neue Dateninfrastruktur möglich gemacht hatte. Neue Medienunternehmen profitierten zunächst ebenso von dem high tech-Boom wie die start-ups der informationstechnologischen Industrie selbst – und mussten mit dem Platzen der Seifenblase vergleichbare Einbrüche hinnehmen.
Und auch der Profifußball – ein content provider für die content provider – entging diesem Schicksal nicht. In Erwartung enormer künftiger Wachstumsraten versorgten die privaten Medien den Profifußball mit dramatisch steigenden Einnahmen – die für die Übertragungsrechte für Fußballspiele gezahlten Summen spiegeln in gewisser Hinsicht die Börsenkurse der TMT-Unternehmen wider –, und aufgrund der spezifischen Arbeitsmarktstruktur des Profifußballs setzten sich die mit dem Medienboom steigenden Einnahmen der Fußball-Unternehmen automatisch in astronomische Gehälter für die Arbeitskräfte (die Spieler) um, die sich heute als nicht mehr tragbar erweisen. Dem Markt des Profifußball steht nun die Korrektur bevor, die die neuen Märkte hochtechnologischer start-ups bereits hinter sich gebracht haben.
Es ist das Kennzeichen einer bubble, dass strukturelle Defizite der von ihr erfassten Branchen für eine gewisse Zeit verdeckt werden und sich kumulativ verschärfen können. So hat der Boom der Medien die Strukturdefizite des Profifußballs als Wirtschaftsunternehmen überdeckt und verschärft, aber er traf auf Strukturen, die von vornherein nicht tragfähig waren. Unter den spezifischen Wettbewerbsbedingungen des Profifußballs führen steigende Einnahmen quasi automatisch zu überproportionalen Ausgabensteigerungen und damit zu Verlusten. Der Medienboom hat dieses Muster verstärkt, ist aber nicht ursächlich.
Fußball, ein Produkt sui generis
Hätte Gary Lineker mit seiner Einschätzung recht, dass "Fußball ist, wenn 22 Mann dem Ball hinterherlaufen, und am Ende immer die Deutschen gewinnen", würden nur ausgesprochene hardcore-Fans regelmäßig Fußballspiele am Bildschirm oder im Stadion betrachten. Tatsächlich hat Gary Lineker unrecht.
Das Besondere am Fußball ist nämlich erstens die Unvorhersehbarkeit der Resultate (hierin vielen Kriminalromanen und –filmen ähnlich, die ihren Wert verlieren, wenn das Ergebnis bekannt ist). Für den einzelnen Verein mag es verlockend sein, eine beherrschende Position aufzubauen. Für den Fußball als Zuschauersport und Teil der Unterhaltungsindustrie wäre die Monopolstellung eines Vereins fatal. Daher wird im Fußballsport ein Wettbewerb organisiert, der – anders als der Wettbewerb auf Produktmärkten – keine Externalität ist, sondern Teil des Ange-
[Seite der Druckausg.: 5]
bots selbst. Der Wettbewerb darf sich nicht so weit selbst überlassen werden, dass er zu einem Monopol oder einem stabilen Oligopol führt, er muss ein gewisses Gleichgewicht (competitive balance) erzeugen, das ein Minimum an Ungewissheit und Überraschung enthält. Der Wettbewerb im Profisport ist daher durch ein Maß an "Absprachen" – nicht in Bezug auf die Spielergebnisse, sondern die Regeln des Wettbewerbs – gekennzeichnet, das in anderen Wirtschaftsbranchen die Gerichte oder die Kartellbehörden auf den Plan rufen würde. [Unter gewissen Bedingungen ist es wettbewerbs fördernd, wenn der Wettbewerb durch den Zusammenschluss der Unternehmen/Vereine zu einem Joint Venture gleichzeitig eingeschränkt und reguliert wird, wenn also die Liga anstelle der einzelnen Vereine als Unternehmen fungiert. Siehe z.B. Stefan Szymanski und Stephen F. Ross, Open Competition in League Sports , http://www.ms.ic.ac.uk/stefan/prdiscuss.pdf]
Zweitens wird ein Fußballspiel – ähnlich der Dienstleistung eines Masseurs oder einer Prostituierten – im Augenblick ihrer Erstellung in Echtzeit konsumiert. Während in der Musikbranche Live-Aufführungen ein Vehikel sind, um den Markt für "Konserven" (CDs, Videos) zu stimulieren, sind "konservierte" Fußballspiele nur für eine kleine Gruppe von Spezialisten von Interesse. Ein Musikstück wird oft durch wiederholtes Hören attraktiver, und auch ein Film wird durch einmaliges Sehen nur begrenzt entwertet. Ein Fußballspiel aber verliert für den Konsumenten deutlich an Wert, wenn sein Ergebnis bekannt ist. Dieser Sachverhalt begrenzt die Mehrfachverwertung von Fußballspielen, erweist sich aber auch als Vorteil, da die Rechte an den Spielen durch deren sofortigen Wertverlust geschützt sind. [Der Schutz geistiger Eigentumsrechte hat sich – wie die Auseinandersetzung um die Internet-Musikbörse Napster gezeigt hat – als ein zentrales rechtliches Problem der Informationsökonomie erwiesen.]
Drittens ist ein Fußballspiel kein in sich geschlossenes Produkt wie ein Film oder ein Rockkonzert. Sein Wert für die Konsumenten (und deren Bereitschaft, dafür zu zahlen) hängt von seinem Stellenwert als Glied einer Ereigniskette anderer Spiele ab. Das Spiel der Nationalmannschaften Georgiens und Namibias wird für die meisten Konsumenten auch dann wertlos sein, wenn der georgische und namibische Fußball höchstes Qualitätsniveau erzielen. Ein qualitativ schlechteres Spiel dagegen, von dem aber die Position der Mannschaften in einer Liga oder einem Tournier abhängt, wird weitaus mehr Aufmerksamkeit (und Zahlungsbereitschaft) auf sich ziehen. Der Reiz eines Fußballspiels liegt also nicht (oder in nur begrenztem Umfang) in sich selbst (würde ein Spielfilm so reizarm sein wie manches Fußballspiel, kämen als Konsumenten ausschließlich hartnäckige Cineasten in Frage), sondern in seiner Funktion als Teil einer langen – im Grunde unendlichen – Ereigniskette.
Viertens bedient der Profifußball zu einem hohen Anteil einen Kundenkreis von Fans, der durch seine dauerhafte Identifikation mit dem Unternehmen/Verein charakterisiert ist. In dieser besonders engen Markenbindung der Konsumenten konserviert der Profifußball die Eierschalen seiner soziohistorischen Entstehung: Die spezifisch lokale Dimension der Markenbindung sowie – damit im Zusammenhang – die Einbindung des "Geschäfts" in die lokale Öffentlichkeit, Sozialstruktur, Ökonomie und Lebenswelt.
Aufgrund der genannten Besonderheiten eignet sich der Fußball in hervorragender Weise als content provider der Unterhaltungsmedien. Er gilt als killer content, als Programminhalt, der jede Alternative "killt" und von dem der Erfolg eines privaten Medienunternehmens zu einem hohen Anteil abhängt. Die Kombination von Echtzeitkonsum, Ungewissheit und Ereignisketten sorgt von selbst für jene kleineren und größeren cliffhanger, die bei anderen Programmen mühsam von Drehbuchautoren erdacht werden müssen. Die Frage ist nur, wie lässt sich dieses Spektakel am besten, d.h. gewinnbringend, präsentieren?
[Seite der Druckausg.: 6]
Vom Stadion ins Wohnzimmer: Veränderte Konsumgewohnheiten
Die Antwort: Die Dienstleistung eines Fußballspiel wird zum einen durch den Verkauf der an den Konsumenten vermarktet, der mit dem Erwerb Eintrittskarten oder der Zahlung von Fernsehgebühren auch das Recht erwirbt, sich das Spiel anzusehen, zum anderen durch die Nutzung der Aufmerksamkeit, die ein Fußballspiel auf sich zieht, als Projektionsfläche für Werbung.
Die erste und simpelste Form der Vermarktung eines Fußballspiels ist die Vorführung im lokalen Stadion, für die ein Eintrittspreis erhoben wird. Die Erlöse hängen ab von der Fassungskapazität des Stadions und vom Preis der Eintrittskarten, der wiederum vom Stellenwert des Spiels abhängt. Ähnlich wie bei Rockkonzerten oder Aufführungen des Ohnsorg-Theaters können die Vorführungen zusätzlich im Fernsehen übertragen werden. Hier hängen die Einnahmen, die den Vereinen entstehen, von den Vereinbarungen zwischen Sendern und Vereinen bzw. den von ihnen ernannten Verhandlungsführern, normalerweise den nationalen Fußballverbänden, ab.
Darüber hinaus lässt sich die Aufmerksamkeit, die ein Fußballspiel auf sich zieht, als Projektionsfläche für Werbung verwenden, sei es im Stadion, sei es bei der Übertragung des Spiels in den Medien. Dem Kalkül der Werber zufolge registriert eine große Zahl von Zuschauern neben dem Spiel, auf das die eigentliche Aufmerksamkeit gerichtet ist, bewusst oder unbewusst, dass sie auch in den Genuss des Angebots von Baumärkten und Bierbrauereien kommen können.
Eine besondere Form der Werbung ist das Sponsoring, durch das ein Unternehmen seinen Namen in der Öffentlichkeit zu verbreiten sucht, indem es sich mit dem Schicksal eines Vereins verbindet. Ob sich die direkte Werbung oder das Sponsoring für das Unternehmen in der Form höherer Umsätze auszahlen, kann dem Verein letztlich gleichgültig sein. Für ihn zählen die Werbeeinnahmen, deren Höhe von den Zuschauerminuten abhängen wird.
Die Zahl der Zuschauerminuten und damit die potentiellen Werbeeinnahmen steigen exponentiell, wenn ein Spiel im Fernsehen übertragen wird. Wird ein Spiel im free-TV ausgestrahlt, sind die Werbeeinnahmen für den Sender – anders als für den Verein bei einer Vorführung des Fußball-Theaters im Stadion – keine zusätzliche Einnahmequelle, sondern die einzige. Da (fast) alle Haushalte über einen Kabelanschluss verfügen, kann niemand vom Genuss der Dienstleistung "Fußballspiel" ausgeschlossen werden. Die Zuschauer des free-TV sind somit allesamt Trittbrettfahrer, sie konsumieren ein Gut, für das sie (obwohl seine Erstellung mit Kosten verbunden war) keinen Preis entrichten.
[Mit der Übertragung im Fernsehen gerät das Fußballspiel auf einen besonderen Markt, der gegenüber dem vom Stadion begrenzten Originalschauplatz des Spiels spezifischen Verzerrungen unterliegt. Der generelle Nutzen des Marktes kann sich der klassischen Theorie zufolge nur dann entfalten, wenn der Erwerb eines Gutes Nicht-Eigentümer vom Genuss dieses Gutes ausschließt. Beim Fußballspiel im Stadion zahlt jeder Zuschauer für die Dienstleistung, die ihm geboten wird; die Stadionarchitektur garantiert, dass Trittbrettfahrer ferngehalten werden.]
Der Anbieter eines Fußballspiels im free-TV kann für sein Angebot selbst keinen Preis erheben, er kann nur die geballte Aufmerksamkeit, die er auf sich zieht, einem Dritten – dem werbenden Unternehmen – als Projektionsfläche zur Verfügung stellen.
[Das private free-TV tendiert daher zu einem Angebot, das auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner eine möglichst große Zahl von Augäpfeln zu fesseln sucht. Das free-TV verfügt über keine Möglichkeit, 10.000 Konsumenten, die an einem Programm stark interessiert sind und daher auch bereit wären, hierfür einen Preis zu zahlen, zu bedienen; es kann aber 20 Millionen Zuschauer bedienen, auch wenn deren Interesse an dem Programm sie gerade noch davon abhält, an die Decke zu starren. Das private Fernsehen ist daher ein imperfekter Markt, auf dem Angebot und Nachfrage keine Wechselwirkung eingehen, sondern systematisch aneinander vorbeizielen. S. Brad DeLong und A. Michael Fromkin, Speculative Microeconomics for Tomorrow’s Economy , http://www.j-bradford-delong.net/]
Und da ein Fußballspiel in der Lage ist, bei attraktiven Spielen Millionen von Zuschauern 90 Minuten lang zu fesseln, ist es eine nahezu ideale Projektionsfläche für Fernsehwerbung.
[Auf der anderen Seite sind die Möglichkeiten der Instrumentalisierung des Spiels für Werbung begrenzt: Sie kann zu Beginn des Spiels, in der Halbzeitpause und nach Abpfiff auftreten, im Extremfall in den kurzen Spielunterbrechungen, hinzu kommt die Trikot- und Bandenwerbung. Parallele Einblendungen am Bildschirmrand würden bei der gängigen Bildschirmgröße zu verärgerten Zuschauern führen, und ein Zerstückeln des Spiels in durch Werbeblöcke unterbrochene Segmente, wie bei Spielfilmen und bei anderen Sportarten möglich, würde den Spannungsbogen eines Spiels so stark beeinträchtigen, dass sich der Werbeeffekt möglicherweise in sein Gegenteil verkehrte. Eventuell stellen die für die Fußball-WM in Japan und Korea vereinbarten Trinkpausen den ersten Schritt hin zu werbegerechten, von Anzahl und Dauer her vorhersehbaren Auszeiten dar.]
Bei
[Seite der Druckausg.: 7]
einer Übertragung im Pay-TV zahlt der Konsument dagegen wie im Stadion für die Dienstleistung, die zudem von den störenden Nebenwirkungen der Werbung befreit ist. Trittbrettfahrer sind weitgehend ausgeschlossen, der Fernsehsender sollte seine Kosten decken und Gewinne erwirtschaften können, ohne auf die Werbung angewiesen zu sein.
Das um Zuschauer und Einnahmen konkurrierende Privatfernsehen ging mit dem ebenfalls um Zuschauer und Einnahmen konkurrierenden Fußball-Unternehmen eine Beziehung ein, die auf den ersten Blick symbiotischen Charakter hatte: Die Fußballspiele liefern den Medien das Bildmaterial, mit dem diese ihre Zuschauerzahlen und Gewinne erhöhen können,
[Allerdings: Eine Mehrfachverwertung erübrigt sich, wie bereits bemerkt. Selbst "historische" Spiele (wie Deutschland-Italien in der Weltmeisterschaft in Mexiko 1970) werden ein zweites Mal in der Regel nur in der Form von Zusammenschnitten konsumiert: Die Ästhetik des Fußball lebt vom Unvorhergesehenen, das sich nicht konservieren lässt.]
und die Medienunternehmen übernehmen mit den Zahlungen für die Übertragungsrechte der Spiele den wesentlichen Anteil an der Finanzierung des Profifußballs.
[Gleichzeitig wird aber auch der Anreiz geschwächt, ein Spiel im Stadion zu besuchen. Die Vereine müssen daher eine gewisse Balance halten. Sie müssen dafür eintreten, dass im Fernsehen nicht „zu viel Fußball„ gesendet wird, sind aber auf die Multiplikation der Zuschauerminuten und damit der Werbeeinnahmen angewiesen.]
Warum kam es anders?
Geburtsfehler des Pay-TV: Es gibt ein Leben jenseits des Decoders
Das Pay-TV hat sich, wie das Schicksal des Kirch-Konzerns und des britischen ITV zeigt, wirtschaftlich als Fehlschlag erwiesen. Auch der Erwerb von auf den ersten Blick hoch attraktiven Rechten an Fußballspielen hat die entstehende Branche nicht zur Blüte gebracht.
Zum einen hat das Pay-TV (noch) keine exklusive Verfügung über den Fußball gewinnen können. Der Anreiz, für den Genuss eines Fußballspieles im Fernsehen einen Preis zu zahlen, ist schwach, wenn der Konsument auch ohne diesen Preis in den Genuss derselben oder einer ähnlichen Dienstleistung kommen kann. Die öffentlich-rechtlichen Sender wie das private free-TV stellen – so muss man schließen – die Dienstleistung Fußballspiel in einer Qualität und Quantität zu Verfügung, die vom Erwerb eines Decoders und der Zahlung einer Gebühr für pay-Dienstleistungen abhält. Die Qualitätsdifferenz zwischen pay-Dienstleistungen (wie Spiele ohne Werbung) und Fußballspielen im öffentlichen wie privaten free-TV ist nicht so groß, dass sie eine ausreichend große Zahl von Konsumenten motivierte; der Grenznutzen des Pay-TV ist angesichts alternativer Konsummöglichkeiten gering. Beim Pay-TV war die Initialmenge zumindest in Deutschland nicht ausreichend, um kostendeckende Erlöse zu garantieren. In anderen europäischen Ländern mit einer geringeren Medienvielfalt konnte das Pay-TV zwar größere Erfolge verbuchen, das Beispiel von ITV und Canal+ zeigt jedoch, dass sich auch unter günstigeren Angebotsbedingungen kein überwältigender Markterfolg erzielen ließ.
Ein zweiter Faktor ist ebenfalls zu berücksichtigen. Obwohl viele Fußballspiele – gerade die vom Tabellen-Stellenwert her wichtigsten – kostenlos im Fernsehen verfolgt werden können, besuchen nach wie vor viele Zuschauer die Stadien und entrichten einen Preis für eine Dienstleistung, in deren Genuss sie auch gratis kommen könnten. Warum zahlen Konsumenten für einen Stadionplatz, weigern sich aber, die Gebühr für das Pay-TV zu entrichten? Hier kommt die
[Seite der Druckausg.: 8]
öffentliche Dimension des Fußballsports ins Spiel: Ein wichtiges Fußballspiel ist ein öffentliches Ereignis in Echtzeit. Das deutsche Fernsehwesen – in erster Linie die öffentlich-rechtlichen, aber auch die großen privaten Sender – können in einem gewissen Ausmaß Öffentlichkeit suggerieren. Wer einem Spiel zusieht, kann sicher sein, dass er auch in seiner privaten Wohnung nicht individualisiert ist, sondern Teil einer fiktiven Aufmerksamkeits-Gemeinschaft. Pay-TV dagegen ist fast definitionsgemäß ein Medium der Vereinzelung. Ein dem Pay-TV angemessener Inhalt ist der Pornofilm oder ein auf spezielle Nischengruppen zugeschnittenes Programm (wie Avantgarde-Filme, Dokumentationen). Ein Vorteil des Pay-TV – insbesondere in der Form des video on demand – ist zudem die Anpassbarkeit des Programms an den Zeithaushalt des Konsumenten. Ein Fußballspiel nimmt aber auf den Zeithaushalt der Konsumenten keine Rücksicht. Wer es nicht live verfolgen, sondern später sehen will, kann fast sicher sein, dass ihm das Ergebnis verkündet und damit der Spaß am Spiel verdorben wird.
Drittens schließlich ist zu bedenken, dass ein neues Medium wie das Pay-TV sowohl um das Geld als auch um die Lebenszeit seiner Konsumenten mit anderen Angeboten konkurriert.
Der Medienkonsum macht einen bestimmten Anteil der Haushaltsausgaben aus. Wenn ein neues Medium wie Pay-TV eingeführt werden soll, setzt dies voraus:
- Entweder die Einkommen wachsen und die Nachfrage nach Medienkonsum reagiert elastisch auf die Einkommenssteigerung.
- Oder: bei schwach wachsenden, stagnierenden oder sinkenden Einkommen verschiebt sich die Nachfrage der Haushalte auf Kosten anderer Sparten wie Ernährung, Reisen oder Kleidung zugunsten der Medienkonsums.
- Oder: innerhalb des Medienkonsums findet eine Verschiebung zugunsten neuer Medien statt.
Auf jeden Fall muss der Spielraum der Nachfrageentwicklung, der vom Wirtschaftswachstum gesetzt wird, berücksichtigt werden.
Neben dem verfügbaren Einkommen kommt aber auch die Ökonomie der Aufmerksamkeit ins Spiel: Der Tag hat nun einmal nicht mehr als 24 Stunden, von denen der Großteil für Berufs- und Hausarbeit, Schlaf und alltägliche Verrichtungen reserviert ist. Um die wenigen verbleibenden Stunden, in denen die Konsumenten ihre Aufmerksamkeit (und ihr Geld) ausgewählten Anwendungen zuwenden können, konkurriert eine fast unendliche Zahl privater Anbieter auf dem Markt (Restaurants, Fitness-Center, Kinos, Reiseveranstalter, Computerspiel-Vertreiber, etc.) sowie ein nicht marktmäßig organisiertes "lebensweltliches" Angebot (Familie, Freundeskreise, Nachbarschaft usw.).
Wie gewonnen, so zerronnen: Die neue Ökonomie des Profifußballs
In der guten alten Zeit des europäischen Profifußballs bestanden die Einnahmen der Fußballvereine im wesentlichen aus Eintrittsgeldern und den Zuwendungen lokaler Sponsoren. Die großen Summen flossen dabei vor allem in Spanien und Italien, wo Fußballvereine das Hobby (aber nicht nur das) mehr oder weniger respektabler Unternehmerfamilien waren und sind, wie unter anderem Juventus Turin (Agnelli) und AC Mailand (Berlusconi) zeigen. Entsprechend zog es bereits seit den sechziger Jahren deutsche Fußballer zu italienischen Vereinen, und die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die 1990 in Italien den WM-Titel gewann, fühlten sich in den Stadien wie zu Hause, da sie ohnehin in ihrem Hauptberuf für italienische Vereine spielten ("Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien!").
[Seite der Druckausg.: 9]
Seit Mitte der neunziger Jahre hat sich die Situation jedoch stark verändert. Italienische und spanische Vereine machen zwar weiterhin mit Rekordgehältern Schlagzeilen, doch etwas abseits vom Schuss ist eine massive Arbeitsmigration europäischer Top-Fußballer zu englischen Vereinen zu beobachten. In der Besetzungsliste des neuen englischen Meisters Arsenal London sind französische Namen vorherrschend, beim FC Liverpool haben ehemalige Spieler des FC Bayern München ihre neue Heimat gefunden, und die skandinavischen Nationalmannschaften könnten ihre Trainingslager ohnehin auf die Insel verlegen. Selbst italienische Spieler tauchen vereinzelt auf.
Diese Entwicklung beruht zum einen auf dem Sachverhalt, dass sich mit dem Bosman-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (s.u.) ein funktionierender, stärker deregulierter Arbeitsmarkt für europäische Fußballspieler entwickelt hat, zum andern auf dem Geldregen, der mit dem Medienboom über die Vereine kam. Im Wettbewerb um die besten Spieler und damit um die besten sportlichen und ökonomischen Erfolgsaussichten stiegen die Spielergehälter rasch an. Die englischen Vereine waren auf diese Entwicklung besser vorbereitet als die anderer Länder, da sie schon seit Beginn der achtziger Jahre ihre Finanzierungsbasis um ein wichtiges Element bereichert hatten: Sie hatten sich zu Aktiengesellschaften umgewandelt und damit aus der Zwangsjacke der Sponsoren befreit.
Am Ende der Saison 1999/2000 verzeichneten die 92 englischen (und walisischen) Profivereine der obersten vier Divisionen eine Bilanzsumme von ca. 1,3 Milliarden Pfund Sterling bzw. über 2 Milliarden Euro.
[Die Daten zum englischen Fußball wurden übernommen von Deloitte & Touche, Annual Review of Football Finance, August 2001, London , sowie dem Fact Sheet 10, The ´New´ Football Economics, des Sir Norman Chester Centre for Football Research, University of Leicester, http://www.le.ac.uk/snccfr/resources/factsheets/]
Der Anteil von Eigenkapital und Rückstellungen betrug ca. 50%, Bankkredite schlugen mit weniger als 10% und sonstige Verbindlichkeiten mit etwa 40% zu Buch. Die Einnahmen überstiegen in der genannten Saison zum ersten Mal die Marke von 1 Milliarde Pfund Sterling (1,6 Milliarden Euro). Allein die 20 Vereine der ersten Liga, der Premier League, erzielten Einnahmen in Höhe von 772 Millionen Pfund Sterling (über 1,2 Milliarden Euro), wozu Eintrittsgelder, TV-Einnahmen und sonstige kommerzielle Aktivitäten (Werbung, Sponsoring, Merchandising etc.) zu jeweils etwa einem Drittel beitrugen.
Zum Vergleich: Die Vereine der ersten Bundesliga realisierten in der Saison 1999/2000 einen Umsatz von ca. 1,5 Milliarden Mark; dabei entfielen etwa ein Drittel auf TV-Einnahmen, jeweils etwa ein Viertel auf Eintrittsgelder und Sponsoring, der Rest auf andere Posten wie z.B. Merchandising.
[Für diese und weitere Daten zum deutschen Fußball siehe Lothar Hübl / Detlef Swieter, Fußball-Bundesliga: Märkte und Produktbesonderheiten, in: Hübl/Peters/Swieter (Hrsg.), Ligasport aus ökonomischer Sicht, Aachen 2002.]
Zu Beginn der Saison 2001/2002 machten die erwarteten TV-Einnahmen dagegen bereits über die Hälfte der Etats aus. In der italienischen Serie A beläuft sich der Wert der TV-Rechte inzwischen auf 540 Millionen Euro, während die Sponsorenzahlungen lediglich 120 Millionen ausmachen, die Eintrittsgelder 150 Millionen.
Der englische Profifußball hat sich also zur umsatzstärksten und finanziell diversifiziertesten Liga des europäischen Profifußballs entwickelt. Das Interesse eines Unternehmens ist langfristig aber nicht in erster Linie der Umsatz, sondern der Profit. Hier sehen die Zahlen schon weniger erfreulich aus: Von den 92 englischen Proficlubs haben nur 15 die Saison 1999 /2000 mit Profit abgeschlossen. Zehn dieser Vereine spielen in der Premier League, die auch insgesamt einen Profit erzielte (53 Millionen Pfund Sterling), während die Vereine der drei anderen Profiligen nur in Ausnahmefällen profitabel operierten und insgesamt einen Verlust von über 100 Millionen Pfund Sterling hinnehmen mussten.
[Seite der Druckausg.: 10]
Die prekäre finanzielle Situation verdanken die Fußballvereine der Insel in erster Linie ihren Angestellten, und hier v.a. den Spielern. Der Anstieg der Gehälter in der Premier League betrug in den letzten zehn Jahren stets mindestens 20%, von 1996 bis 1999 erreichte er 35% bis 40% pro Jahr. Das Resultat: In der Saison 1999/2000 betrug die Gehaltssumme 319% des Wertes der Saison 1995/96! Parallel stieg der Anteil der Gehälter am Gesamtumsatz der englischen Premier League in wenigen Jahren von 47% (Saison 95/ 96 sowie 96/97) auf 63% in der Saison 1999/2000 an. Werden alle Profivereine der ersten vier Divisionen berücksichtigt, lag der Anteil der Gehälter sogar bei 69%, in der zweiten Division erreichte er den unglaublichen Wert von 95%.
Die Entwicklung in Italien sieht ähnlich aus: 65% der Ausgaben der Serie A entfallen auf Gehälter. In der Saison 2000/2001 lagen die Gehaltskosten - nach einem Anstieg von über 30% gegenüber dem Vorjahr - bei ca. 870 Millionen Euro im Jahr, wovon der Löwenanteil auf Spielergehälter entfiel. Die Bilanzdefizite der Serie A haben sich in den letzten drei Jahren mehr als verdreifacht, sie sind inzwischen bei über 700 Millionen Euro angelangt. Die höchsten Schulden weisen dabei die sportlich erfolgreichen Clubs auf - AC Parma über 150 Millionen, Lazio Rom mehr als 100 Millionen, Inter Mailand und AS Rom jeweils 50 Millionen, etc. [Die genannten Daten beruhen größtenteils auf einer Untersuchung von Deloitte & Touche, wiedergegeben z.B. im Handelsblatt vom 10.4.2002.]
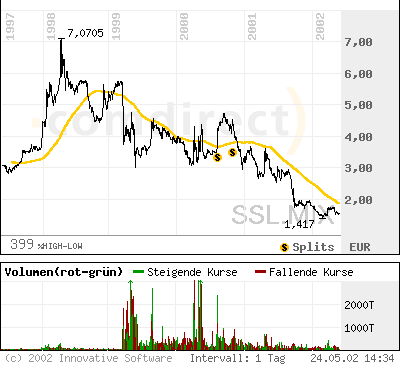
Lazio Rom, Aktienkurs seit Mai 1997
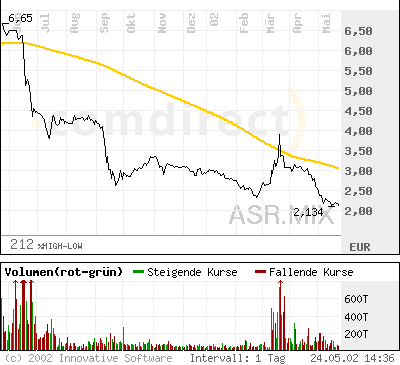
AS Rom, Aktienkurs seit Mai 2001
In Deutschland bewegen sich die Gehälter sowohl absolut als auch relativ noch in anderen Sphären. Mit ca. 650 Millionen Mark waren die Gehaltskosten in der Saison 1999/2000 nicht einmal halb so hoch wie in Italien oder England, ihr Anteil am Gesamtumsatz betrug moderate 44%. Auch hier sind die Gehälter in den letzten Jahren aber deutlich gestiegen: In der Saison 1995/1996 gaben die Bundesligavereine im Durchschnitt weniger als 20 Millionen Mark für Gehälter aus, in der Saison 1999/2000 bereits gut 36 Millionen Mark.
Dass die Gehälter steigen, wenn die Einnahmen steigen, ist auf den ersten Blick nicht weiter verwunderlich. Jeder Arbeitnehmer möchte angemessen an einer Verbesserung der Einkom-
[Seite der Druckausg.: 11]
menssituation seines Arbeitsgebers beteiligt werden. Aber warum steigen die Gehälter der Fußballprofis nicht nur absolut in bis vor kurzem noch unvorstellbare Höhen, sondern auch relativ zu den Gesamtausgaben – und warum nehmen die Gehaltserhöhungen die Einnahmesteigerungen sogar oft vorweg? Handelt es sich nur um schlechtes Management?
Der Fußball-Arbeitsmarkt: Winner-takes-all
Der Arbeitsmarkt für Profi-Fußballspieler gleicht einem "Winner-takes all"-Markt. Ein Winner-takes-all-Markt liegt vor, wenn die relative Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte für den Unternehmenserfolg absolut entscheidend ist. Auf einem normalen Güter- und Dienstleistungsmarkt wird auch der zweit- und drittbeste Anbieter sein Produkt absetzen können, wenn auch zu einem niedrigeren Preis. Anders hier, denn so wie der bessere Anwalt einen Gerichtsprozess gewinnt, der zweitbeste dagegen verliert, gilt auch beim Fußball am Ende des Wettbewerbs: Einer wird gewinnen, nicht zwei. Leistungsdifferenzen können auch nicht durch Preisnachlässe kompensiert werden. Unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten mag es vorteilhaft erscheinen, anstelle eines sehr guten zwanzig schlechte Torhüter ins Tor zu stellen, die Regeln des Wettbewerbs untersagen dies jedoch. Die Gewinnchance ist abhängig von der individuellen Leistungsfähigkeit der Wettbewerber, und da es nur einen Sieger geben kann, führen geringfügige Unterschiede in der Leistungsfähigkeit zu immensen Einkommensdifferenzen.
Ein typischer Winner-takes-all-Markt ist die Kunstszene, in der vielleicht nur einer von 100 Kunststudenten im späteren Berufsleben ein hohes Einkommen erzielt, während die 99 anderen, die als Klavierlehrer oder Taxifahrer enden, ihre Ausbildungsinvestition fehlgeleitet haben. Dabei ist es unerheblich, ob sich die Leistungsfähigkeit (wie im Sport) quantitativ messen lässt. Film- und Rockstars müssen nicht die besseren Schauspieler oder Musiker sein. Es ist jedoch ein Kennzeichen der Aufmerksamkeitsökonomie, dass Individuen Aufmerksamkeit wie Kapital akkumulieren können: Ein einmal erzielter Aufmerksamkeitserfolg legt die Grundlage vieler weiterer Erfolge (ein Film mit Julia Roberts und Bruce Willis hat mehr Chancen, das Publikum zum Kinobesuch anzureizen, als ein Film mit zwei exzellenten, aber unbekannten Hauptdarstellern). [Winner-takes-all-Märkte können auch in Unternehmen simuliert werden. Wenn Chefposten im Vergleich zu durchschnittlichen Jobs hoch dotiert sind (wenn das Einkommen deutlich über der individuellen Produktivität liegt), wird für alle Bewerber um den Job, der Anreiz geschaffen, ihre gesamte berufliche Karriere in die Dienst des künftigen Chefjobs zu stellen (sich also mit niedrigen Einkommen zufrieden zu geben, um später ein extrem hohes Einkommen beziehen zu können). Da nur einer der Wettbewerber Erfolg haben kann, gehen die abgeschlagenen Mitbewerber leer aus. ]
Der Arbeitsmarkt für Profifußball ist ein Winner-takes-all-Markt, vergleichbar dem Arbeitsmarkt für Künstler, insofern von der Vielzahl junger Talente, die Zeit und Energie in den Fußballsport investieren, nur eine relativ kleine Zahl irgendwann einmal von den attraktiven Profiligen aufgenommen wird. Der große Rest ist verurteilt, in weniger attraktiven Ligen geringe Einkommen zu erzielen oder Fußball als Hobby zu betreiben. Die wenigen winner dagegen beziehen die Einkommen von "Stars", allerdings von "All Stars". Und da gerade im Fußball das Ergebnis vom selten eintretenden Ereignis eines Tores abhängt, werden diejenigen Ballkünstler, deren Fähigkeiten die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis eintritt (bzw. vermieden wird), deutlich steigern, entsprechend gut bezahlt.
Dass geringfügige Leistungsunterschiede erhebliche Einkommensunterschiede zur Folge haben können, ist nicht unproblematisch, da die Kooperation des Teams mehr noch als im anderen Branchen Vorbedingung des Erfolgs ist. Das Produkt eines Fußballspiels – ein Tor bzw. die
[Seite der Druckausg.: 12]
Verhinderung eines Gegentors – ist das Produkt eines komplexen und flexiblen Kooperationsprozesses. Der Wettbewerb der Spieler innerhalb der Mannschaften um Rang und Einkommen muss mit dem Wettbewerb der Mannschaften um den Rang in den Ligen (und damit ebenfalls um Einkommen) kompatibel bleiben. Die Lohnbildung muss neben der individuellen Leistung also auch die "Mannschaftsdienlichkeit" berücksichtigen, der individuelle Wettbewerb muss hinsichtlich seiner Kompatibilität mit dem kollektiven Erfolg eingeschränkt werden. Der Zwang zum kollektiven Erfolg schließt auch aus, dass der Status eines "Stars" auf Dauer unabhängig von der spielerischen Leistung honoriert wird. Zwar können die Fußballunternehmen von den Erlösen, die sich aus dem akkumulierten Aufmerksamkeitskapital ihrer "Stars" erzielen lassen – wenn etwa Ehekrisen der Spieler medial verarbeitet werden – profitieren (eine Form der Gratiswerbung), anders als im Film reicht Popularität allein aber nicht aus, um einen Spieler unter Vertrag zu halten. Ihre Leistung wird wie die von kaum jemand anderem mehrmals wöchentlich von Millionen beobachtet und (mit der Bereitschaft, für Fußballprodukte und Dienstleistungen zu zahlen) bewertet.
Die Europäisierung des Profifußballs: Eine Lösung wird zum Problem
Weitere Faktoren, die zur Kostenexplosion und zur Verschärfung der finanziellen Probleme der Vereine beigetragen haben, sind die Europäisierung der Wettbewerbe und des Arbeitsmarktes. Das Paradoxe daran: Eigentlich hatten die Verantwortlichen gedacht, dass diese Veränderungen ihre Finanzprobleme lösen würden.
Die Europäisierung der Wettbewerbe ist allwöchentlich im Fernsehen zu betrachten. Auf europäischer Ebene erfolgreiche Vereine wie Bayern München und in diesem Jahr Bayer Leverkusen treten inzwischen fast ebenso häufig auf der europäischer Bühne in Erscheinung wie in den deutschen Wettbewerben, und was ihre Präsenz in den Medien angeht, hat sich der Schwerpunkt bei diesen Vereinen ohnehin auf die europäische Ebene verschoben.
Von den Anfängen der europäischen Wettbewerbe in den fünfziger Jahren, als nur wenige Vereine überhaupt an europäischen Wettbewerben teilnahmen und meist nur eine sehr begrenzte Zahl von Spielen austrugen, hat sich der Profifußball in den 90er Jahren weit entfernt. Der vorher ausgetragene Europapokal der Landesmeister, der tatsächlich den jeweiligen Landesmeistern vorbehalten war und nach dem K.O.-Modus ausgetragen wurde, fand seinen Nachfolger in der Champions League. An dieser Veranstaltung nimmt nach einem Schlüssel, der sich an der relativen Spielstärke der einzelnen nationalen Ligen bemisst, eine unterschiedliche Anzahl von Vereinen pro Land teil. Der Wettbewerb enthält einen hohen Anteil an Gruppenspielen und gewährleistet damit, dass jedes Team mindestens sechs Spiele auf europäischer Ebene austrägt, die Hälfte der Vereine mindestens zwölf. Erst danach kommt der K.O.-Modus zur Anwendung.
Diese Reorganisation des Wettbewerbs hat die Beteiligung planbar gemacht, was v.a. den Interessen der erfolgreichsten und kapitalkräftigsten Vereine entgegenkommt, die darauf angewiesen sind, regelmäßig in den europäischen Wettbewerben mitzuspielen. Die Champions League erwirtschaftete in der Saison 2000/2001 Einnahmen von 670 Millionen Euro – eine Summe, die in etwa dem Etat sämtlicher Bundesliga-Vereine in der Saison 2001/2002 entsprach –, von denen 490 direkt den Vereinen zugute kamen. Am meisten erhalten natürlich die Vereine, die am weitesten kommen; Bayern München etwa fielen aus Spielen der Champions League 49 Millionen Euro zu, dem zweitplazierten FC Valencia 27,5 Millionen Euro.
Die Gründung der Champions League lässt sich auf der einen Seite als spezifisch europäischer (und erfolgreicher) Ausweg aus der partiellen Blockierung der competitive balance in den natio-
[Seite der Druckausg.: 13]
nalen Ligen – ihrer Verkrustung zu stabilen Oligopolen weniger Vereine – verstehen. Sie ist ein qualitativer Sprung, auch hinsichtlich der Präsenz in den Medien (der Absorption von Aufmerksamkeit). Damit wird sie aber auch zum Problem, denn wie bereits erläutert besteht das Leben zwar ganz wesentlich, aber doch nicht nur aus Fußball, und die Aufmerksamkeit für die Champions League muss zu Lasten der nationalen Ligen gehen und dort zu finanziellen Einbußen führen. Die Teilnahme an europäischen Wettbewerben entscheidet also, wer in großem Stil Einnahmen realisiert und wer nicht. Da die Chancen, die europäischen Wettbewerbe zu erreichen, vor allem eine Funktion der Investitionen sind, die in Spieler getätigt werden, wird die Attraktivität der Champions League zu einem Problem für die Finanzierung der Vereine, die ihr Ziel regelmäßig nicht erreichen. Für sie besteht nur die Möglichkeit, "bescheiden" zu bleiben und sich im Lichtschatten der europäischen Wettbewerbe auf den langfristigen Verbleib in der höchsten nationalen Division zu konzentrieren.
Die sich parallel vollziehende Europäisierung des Arbeitsmarktes für Profifußballer beruht zum einen auf der Öffnung Osteuropas, zum anderen auf dem Bosman-Urteil des Europäischen Gerichtshofes aus dem Jahr 1995, das einen einheitlichen europäischen Arbeitsmarkt für Profi-Spieler herstellte und das sich im Osten öffnende Potential erst in Wert setzte.
Anlass des mit seinem Namen verbundenen Urteils war eine Klage des belgischen Profifußballers Jean-Marc Bosman gegen seinen Verein Royal Club Liege und den belgischen Fußballverband. Bosmans Vertrag beim RC Liege war abgelaufen, der Verein bot dem Spieler eine Fortsetzung zu einem stark verringerten Gehalt an. Folgerichtig sah sich Bosman nach einem neuen Arbeitgeber um und fand diesen im französischen Zweitligisten US Dünkirchen. Dem UEFA-Regelement zufolge hätte Dünkirchen für Bosman eine Transfersumme entrichten müssen und machte auch ein entsprechendes Angebot. Der RC Liege lehnte dieses jedoch aufgrund der befürchteten Zahlungsunfähigkeit des französischen Vereins ab, Bosman wurde arbeitslos. Er klagte vor einem belgischen Gericht, das die Klage an den Europäischen Gerichtshof weiterleitete, indem es an diesen zwei Fragen richtete: Widersprechen a) das UEFA-Regelement der Transferzahlungen für Spieler und b) die von der UEFA ebenfalls reglementierte Begrenzung des Ausländeranteils der Mannschaften (maximal drei Ausländer plus zwei assimilierte Ausländer pro Mannschaft) in internationalen Begegnungen dem Gebot der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und der Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen?
Der Europäische Gerichtshof beantwortete beide Fragen positiv und stellte somit einen Widerspruch zwischen der Praxis der UEFA und dem europäischen Recht fest. Die UEFA wurde aufgefordert, von ihrer Praxis Abstand zu nehmen. Transferzahlungen für Spieler nach Auslaufen des Vertrages wurden für unzulässig erklärt, ebenso die Begrenzung des Ausländeranteils der Mannschaften nach dem Muster "drei plus zwei". Der Arbeitsmarkt für Fußballprofis wurde per Gerichtsbeschluss dereguliert. Die Spieler konnten nun nach dem Auslaufen ihres Vertrages einen neuen Arbeitgeber suchen, ohne dass dieser eine Ablösesumme an den früheren Verein hätten zahlen müssen.
Ursprünglich wurden sowohl die sich öffnenden Grenzen im Osten als auch das Bosman-Urteil von den deutschen Profivereinen begrüßt. Die Erwartung war, dass eine große Reservearmee billiger und williger Spieler aus Osteuropa nun die Preise auf dem deutschen Fußball-Arbeitsmarkt drücken und die Disziplin fördern würde.
[Einige entsprechende Äußerungen von Trainern und Managern deutscher Vereine können im Spiegel 40/1996 nachgelesen werden.]
Tatsächlich standen bereits am ersten Spieltag der Saison 1996/97, also noch nicht einmal ein Jahr nach Verkündung des Urteils, zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga bei einem Verein (Borussia Mönchengladbach) mehr ausländische als deutsche Spieler auf dem Platz. Nur wenige Jahre später ging Energie
[Seite der Druckausg.: 14]
Cottbus dadurch in die Annalen des deutschen Fußballs ein, dass unter den eingesetzten Spielern gar kein Deutscher mehr vertreten war. Dies ist zwar ein Extremfall, aber in der Mehrheit der deutschen Vereine der ersten Bundesliga ist es inzwischen zur Gewohnheit geworden, dass Deutsche als Minderheit auftreten.
Zwar wurde mit dem Bosman-Urteil die Verhandlungsposition der Arbeitgeber erhöht, da das zur Verfügung gestellte Reservoir an Arbeitskräften wuchs, gleichzeitig jedoch wuchs die Verhandlungsmacht der Spieler, die einen Vertrag erhalten und sich zu wichtigen Aktivposten der Vereine entwickelt hatten. Da sie ohne Einschränkungen mit dem Wechsel des Arbeitgebers drohen können, können sie auch für den Fall ihres Bleibens höhere Gehälter erzwingen. Für die Leistungsträger der Vereine öffnete das Bosman-Urteil das Tor zu einer enormen Steigerung der Spielergagen. Die Gehälter der Wasserträger zogen jedoch ebenfalls stark an, nicht immer ihrem externen Marktwert entsprechend, sondern zwecks Wahrung des Betriebsfriedens. [Gleichzeitig wird dieser Betriebsfrieden regelmäßig von außen gestört, indem einzelnen Spielern für den Fall eines Wechsels attraktive Angebote unterbreitet werden. Diese Angebote werden strategisch eingesetzt, um die Vereine zu höheren Zahlungen an die bereits bei ihnen beschäftigten Spieler zu zwingen – was ihre finanzielle Konkurrenzfähigkeit auf dem externen Spielermarkt natürlich schwächt. Da der Erfolg von der Qualität der Spieler abhängt, erhöhen derartige Angebote die eigenen Erfolgsaussichten auf Kosten anderer Vereine. Nach Erik Lehmann / Jürgen Weigand, Fußball als ökonomisches Phänomen: Money makes the Ball go Round, Rostock 1997 hat in Deutschland v.a. der FC Bayern München diese Strategie verfolgt. Dies hindert den Verein aber offensichtlich nicht daran, auch die alternative Strategie einzusetzen, direkte Konkurrenten dadurch zu schwächen, dass deren beste Spieler auch tatsächlich abgeworben werden.]
In wenigen Jahren haben Deregulierung und Europäisierung des Arbeitsmarktes mit Winner-Takes-All-Charakteristika dazu geführt, dass die Spielergehälter exorbitante Höhen erreicht haben. Dass diese Mechanismen auch nach dem Platzen der Medien-bubble weiter wirken, zeigt das Beispiel der erst kürzlich erfolgten Abschlüsse des Vorzeigevereins Manchester United mit seinen Angestellten Roy Keane und David Beckham, die in Zukunft annähernd 20.000 Euro pro Tag erhalten sollen (jeder von ihnen). Manchester United kann es sich leisten, Real Madrid ebenso, Bayern München könnte es vielleicht – aber wie sieht es bei anderen Vereinen aus?
Shareholder vs. Stakeholder: Ware Fußball vs. wahrer Fußball?
Trotz der Europäisierung des Profifußballs via Champions League und Bosman-Urteil sind die europäischen Fußball-Unternehmen noch sehr unterschiedlich organisiert. In Deutschland dominieren nach wie vor die unabhängigen (bzw. von Sponsoren abhängigen) Vereine, in Italien gleichen die großen Vereine den Dependenzen von Großunternehmen, und nur in England hat sich die in der Wirtschaft gängige Unternehmensform der Aktiengesellschaft auch im Fußball durchgesetzt. In Deutschland hat Borussia Dortmund hierbei eine Pionierrolle übernommen, andere werden folgen, wobei das Ende der Euphorie an den Börsen sowie die Krise des Profifußballs verzögernd wirken.
Eine an den Interessen der shareholder orientierte Organisation der Fußball-Unternehmen wirft automatisch einen Zielkonflikt auf: sportliches Ziel jedes Fußballunternehmens ist fast definitionsgemäß ein möglichst hoher Platz auf der Rangliste der Vereine (als nationaler Meister, Cupsieger usw.). Dieses Ziel ist ein Maximierungsziel, das dem Ziel der Umsatzmaximierung eines traditionellen Unternehmens entspricht – wobei das Unternehmen wie der Verein davon ausgehen, dass eine Maximierung der Umsätze bzw. der Marktanteile irgendwie auch die Gewinne steigern wird. Dieses Ziel kann aber in Widerspruch treten zum Optimierungsziel jedes kapitalistischen Unternehmens, auf das eingesetzte Kapital einen möglichst hohen Ertrag zu erwirtschaften. Für ein seinen shareholdern verpflichtetes Fußball-Unternehmen wären zum Beispiel
[Seite der Druckausg.: 15]
möglichst viele nationale Meistertitel kein Selbstzweck, sondern allenfalls Mittel zum Zweck. So wird es vielleicht nach dem Titelgewinn die besten Spieler verkaufen, da deren Kurswert zu diesem Zeitpunkt besonders hoch ist.
[So geschehen im Falle von Lazio Rom nach dem Gewinn des Titels im Jahre 2000. Auffällig auch die Gewinnmitnahmen nach Titelgewinnen, in der Vergangenheit zu beobachten bei Manchester United und gegenwärtig bei Borussia Dortmund – sell on good news!]
Ein im Interesse der shareholder optimales Management würde unter Umständen auch auf den Meistertitel verzichten, wenn der Einsatz der hierfür notwendigen Mittel (für den Einkauf der besten Spieler und Trainer) die aus dem Titel zu erzielenden Erträge überschritte. Auch für die shareholder mag sportlicher Erfolg emotional wichtig sein. Im Sinne der Erträge aber kann es vorteilhafter sein, mit gesunden Finanzen Zweiter zu werden, als mit enormem Aufwand Erster.
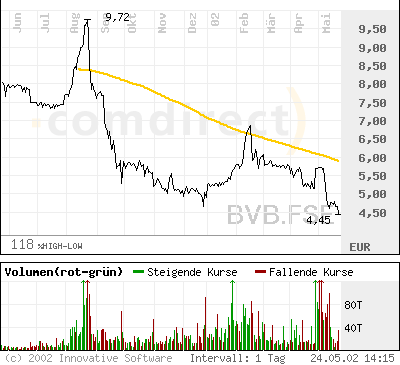
Borussia Dortmund, Aktienkurs seit Börsengang
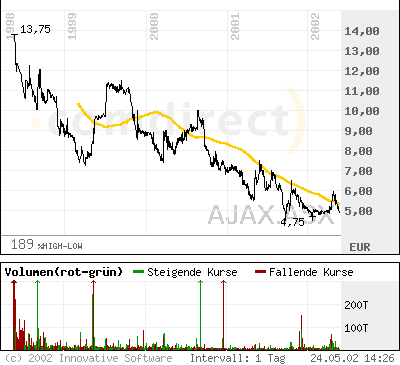
Ajax Amsterdam, Aktienkurs seit Börsengang
Der Zusammenhang zwischen sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg findet seine Parallele auch in anderen Wirtschaftsbereichen: So ist ein Unternehmen, dass die technisch besten Produkte und Dienstleistungen anbietet, nicht notwendig wirtschaftlich erfolgreicher als eine technisch weniger ambitionierte, aber ökonomisch besser gemanagte Firma. Auf jeden Fall müssen die Fußball-Unternehmen eine unter Umständen prekäre Balance zwischen sportlichen und wirtschaftlichen Zielen – und diese in einem unter dem Gesichtpunkt der competitive balance stark regulierten Umfeld – halten. Die wirtschaftlichen Daten der meisten Fußball-Unternehmen (soweit sie als Aktiengesellschaften zur Offenlegung ihrer Finanzen gezwungen sind) zeigen aber, dass diese Balance in der Regel nicht gelingt. Nur sehr wenige europäische Spitzenvereine erwirtschaften regelmäßige Überschüsse; in der Regel sind die Vereine hoch verschuldet und/oder auf erhebliche Zuschüsse privater Sponsoren bzw. die Unterstützung durch eine Firma angewiesen. Der Geldregen der Medien in der letzten Dekade hat viele Vereine wahrscheinlich dazu verführt, eine mehr oder weniger uneingeschränkte Maximierungsstrategie zu verfolgen – die sich abzeichnende Krise dagegen wird den Zwang zur Ertragsoptimierung verstärken.
Was würde es aber für den Fußballsport bedeuten, wenn der wirtschaftliche Optimierungszwang in Zukunft höheres Gewicht erhält, wenn sich die Fußballunternehmen mit anderen Worten we-
[Seite der Druckausg.: 16]
der auf unbegrenzt sprudelnde Einnahmen aus dem Verkauf von Übertragungsrechten, noch auf die Zahlungsbereitschaft von Sponsoren stützen können, sondern die Mittel der von ihnen getätigten Investitionen (in Spieler) vorwiegend selbst erwirtschaften müssen?
Eine erste denkbare Perspektive ist die Fortsetzung eines Trends, der sich bereits in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts abzeichnete: Die Umwandlung des Fußballsports vom Volksvergnügen zur Konsumalternative der Mittelschichten – eine Entwicklung, die letztlich die Transformationen der europäischen Gesellschaften widerspiegelt. Dabei könnte das noch nicht erfolgreiche Pay-TV eine gewisse Rolle spielen, aber auch eine stärkere Ausrichtung der Fußballspiele auf den Erlebnisbedarf einer zahlungsfähigen Kundenschicht ("Lachsbrötchen statt Bratwurst").
Eine zweite (nicht alternative) Perspektive ist die stärkere Differenzierung und Segmentierung des europäischen Profifußballs. Bislang folgt der europäische Fußball (anders als die populären amerikanischen Sportarten) dem Prinzip der offenen Ligen: Der Kampf um die Ränge innerhalb einer Liga wird durch die zusätzliche Aussicht eines Aufstiegs in eine höhere bzw. des Abstiegs in eine niedrigere Liga intensiviert (woraus die Kunden in der Form höherer Spannung aus dem Wettbewerb zusätzlichen Gewinn ziehen können). Trotz des Prinzips der offenen Ligen hat sich aber auch in Europa eine (wenn auch durch bestimmte Umverteilungsmechanismen moderierte) de facto-Segmentierung der Branche durchgesetzt. Deren Kategorien sind: "Die Europäer", also zwei bis fünf Mannschaften pro Land, die in der Champions League spielen bzw. die Chance hierzu haben; der nivellierte Mittelstand der jeweiligen ersten Liga; die Fahrstuhlvereine zwischen der ersten und der zweiten Liga; die Arrivierten der zweiten Liga; die cliffhanger zwischen der zweiten Liga und den weiteren Ligen.
Diese Segmentierung könnte sich verstärken, ohne dass das Prinzip der "offenen Ligen" grundsätzlich zur Disposition gestellt werden müsste. Eine stärkere Segmentierung hätte den wirtschaftlichen Vorteil, dass die Ausgaben und Einnahmen der Fußball-Unternehmen stabiler und besser planbar würden. Heute dagegen bedeutet der Auf- oder Abstieg eines Vereins einen Wechsel zwischen zwei vollständig verschiedenen Märkten, der das Management häufig überfordert. Der Abstieg eines Vereins führt meist zu erheblichen Einkommenseinbußen, die nicht unmittelbar durch Kostensenkungen kompensiert werden können. Umgekehrt macht die relativ schlechte finanzielle Ausstattung eines Vereins, der den Aufstieg in die erste Liga schafft, ihn augenblicklich zum Kandidaten für den sofortigen Abstieg. Für Vereine, die sich als Zweitligisten definieren und die ihre Finanzplanung darauf abstellen, mag ein kurzer Ausflug in die erste Liga eine willkommene und profitable Ausnahme vom Alltag darstellen – für alle anderen ist er ein großes Risiko.
Der drastischste Schritt wäre der Ausstieg der finanzstärksten "europafähigen" Vereine aus den jeweils ersten nationalen Ligen. Damit würde sich auch formell eine (nach wie vor im Prinzip offene) europäische Spitzengruppe von Vereinen etablieren, die mit der höchsten Aufmerksamkeit rechnen, die höchsten Einnahmen erwirtschaften und in die besten Spieler investieren könnten. Gleichzeitig würde der Wettbewerb in den nationalen Ligen intensiviert: Die Meisterschaften würden nicht mehr mit weitgehend absehbarem Ergebnis zwischen zwei oder drei "europäischen" Vereinen ausgetragen werden, der nivellierte Mittelstand der ersten Liga hätte seine Titelchancen, und die Fahrstuhlvereine könnten sich sicher in der ersten Liga platzieren.
Eine Alternative zur vertikalen Abspaltung, zur Gründung einer Europaliga, wäre die horizontale Abspaltung, die Auflösung der strikt nationalen Ligen zugunsten überregionaler Spielvereinigungen. In der schottischen Liga deutet sich eine solche Entwicklung an. Bislang haben zwei
[Seite der Druckausg.: 17]
Vereine, Celtic Glasgow und Glasgow Rangers, die Liga dominiert. Die competitive balance ist nicht mehr gegeben, außer den genannten Clubs hat keine Mannschaft eine reale Chance, die Meisterschaft zu gewinnen. Celtic und Rangers wollen sich nun der englischen Fußballliga anschließen, womit die competitive balance auf einer anderen Ebene für alle Beteiligten wieder hergestellt würde. Dass dies beispielsweise für dänische und belgische Vereine einen Präzedenzfall darstellen könnte, um die Aufnahme in die deutsche oder französische Fußballliga zu beantragen, ist naheliegend.
[Siehe hierzu The Economist, May 18th 2002 . Präzedenzfälle für eine Auflösung rein nationaler Strukturen unterhalb der europäischen Ebene gibt es übrigens bereits, denn walisische Clubs spielen seit langem in der englischen Liga mit. Und israelische Vereine nehmen an europäischen Wettbewerben teil, so dass auch auf dieser Ebene die Zuordnungen längst nicht mehr klar sind.]
Und nur konsequent, denn je stärker sich der Profifußball als Teil der Unterhaltungsindustrie auf dem europäischen Binnenmarkt etabliert, desto weniger wird es den etablierten Fußballverbänden gelingen, die beteiligten Unternehmen daran zu hindern, sich auf diesem Markt frei zu positionieren.
In der Tendenz würde sich eine Spaltung der Fußballbranche in europäisch orientierte shareholder und nationale/lokale stakeholder-Ligen abzeichnen. Die Abspaltung einer kommerzialisierten europäischen Spitzengruppe könnte dabei die auf den ersten Blick paradoxe Konsequenz haben, dass sie eine Renaissance des "wahren", lokal verwurzelten stakeholder-Fußballs einleiten könnte.
Die politische Ökonomie des Profifußball: Der öffentliche Sektor
Der private Markt für Profifußball wird ergänzt und verzerrt durch das öffentliche Interesse am Fußball. Dieses hat verschiedene Dimensionen. [Zum Zusammenhang von Fußball und Politik s. vor allem Norbert Seitz, Bananenrepublik und Gurkentruppe – Übereinstimmungen von Fußball und Politik, Frankfurt 1987; sowie ders., Doppelpässe: Fußball & Politik, Frankfurt 1997]
Der Fußball, auch der Profifußball, ist vor allem in Deutschland in Vereinen mit dem Status der Gemeinnützigkeit organisiert.
[Bis Oktober 1998 konnten nur gemeinnützige Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga spielen, seitdem sind auch Kapitalgesellschaften zugelassen.]
Das bedeutet, dass den Fußball-Unternehmen gewisse Privilegien zukommen: steuerpflichtige Gewinne der Lizenzspielerabteilung können durch die Verluste im Amateurbereich gemindert werden, Spenden können steuerlich abgesetzt werden (die Vereine sind in diesem Zusammenhang Teil einer komplexen Ökonomie der Steuerersparnis), die Vereine können auf die unbezahlte Arbeitskraft ehrenamtlicher Mitarbeiter zurückgreifen, etc.. Der Sport, den die Vereine fördern, gilt als eine Art höherer Tätigkeit, ebenso wie die Hochkultur, die staatlich subventioniert wird. Sport gilt als "öffentliches Gut", und es gibt keine systematischen Gründe, den Sport in diesem Zusammenhang anders zu bewerten als Opern oder Museen. Sportliche Betätigung, so könnte man darzulegen versuchen, fördert die Volksgesundheit und verringert die Kosten des Gesundheitswesens, bietet jungen Männern und Frauen ein Gemeinschaftserlebnis und hält sie von kriminellen Aktivitäten fern, fördert die Geselligkeit der Bürger (und ist damit, folgt man dem amerikanischen Soziologen Robert Putnam, die Grundlage eines zivilgesellschaftlichen Gemeinwesens), sie wirkt pädagogisch, indem sie Tugenden wie Fairness, Solidarität und Einsatzbereitschaft vermittelt usw..
Die Welt der Fußballvereine ist allerdings stark stratifiziert: Der Profifußball bedarf – anders als die geförderte Hochkultur der Theater und Opernhäuser– des Vereinsstatus’ im Grunde nicht, da er auch ohne Förderung auf dem Markt bestehen würde. Die Fußball-Unternehmen stehen daher
[Seite der Druckausg.: 18]
in einer gewissen Spannung, indem sie auf der einen Seite ihren Gemeinnützigkeitsstatus zu kultivieren und die aus ihm sich ergebenden Ressourcen zu nutzen versuchen, auf der anderen Seite aber ein "Geschäft" betreiben, das durch die Kultivierung der Gemeinnützigkeit auch beeinträchtigt werden kann. Bislang haben mehrere Profivereine hieraus den Schluss gezogen, sich als GmbH oder als Aktiengesellschaft zu organisieren. Auf längere Sicht könnte der Vereinsstatus auch ins Visier der Wettbewerbspolitik der EU geraten, da er – wie auf dem Felde der "Daseinsvorsorge" bereits inkriminiert wurde – eine Wettbewerbsverzerrung erzeugt.
Neben dem Status der Gemeinnützigkeit kommt den Fußballvereinen auch eine Funktion im lokalen Umfeld zu. Sie sind besonders dicke Knoten im Filz der lokalen Wirtschaft und Politik. Sie sind Infobörsen der lokalen Geschäftswelt in ihrer Verflechtung mit der Kommunalpolitik, Zentrum der Netzwerke, die Transaktionskosten und -risiken senken, Eintrittsbarrieren für Outsider erhöhen, marktwirtschaftliche Prinzipien durch Geselligkeit substituieren und öffentliche Mittel kanalisieren. Sie sind ein "Standortfaktor" und werden entsprechend subventioniert, durch öffentliche Bürgschaften, Zuschüsse zum Stadionbau, die kostenlose Gewährung von Sicher-heits-Dienstleistungen usw.. In ihrer Filz-Funktion stehen die Fußballvereine allerdings im Wettbewerb mit anderen Vereinigungen der lokalen Politik- und Geschäftswelt (philanthropische Clubs, Karnevalsvereine, politische Parteien), und es ist zu vermuten, dass sie diese Funktion um so weniger ausfüllen können, je stärker sich ihre Arbeitskraft internationalisiert und ihr Management professionalisiert.
Die Vereine müssen daher eine permanente Gratwanderung vollziehen. Sie müssen die lokale Verwurzelung aufrecherhalten, da diese eine Ressource ist (Spenden lokaler Sponsoren, Dienstleistungen der Kommune, Kartenverkauf, Merchandising usw.). Gleichzeitig zwingt sie der Wettbewerb zur Internationalisierung insbesondere ihres Arbeitsmarkts und – soweit technisch möglich – zur Nutzung individualisierender Medien wie Pay-TV. Altmodische lokale Vereinsmeierei koexistiert daher mit globalisierten Bennetton-Teams und semi-professionalisiertem Management.
Der öffentliche Status des Profifußballs kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass er durch die Mittel der öffentlich-rechtlichen Medien – also durch Steuermittel (die Rundfunk- und Fernsehgebühren sind eine Art Steuer, da sie auch dann erhoben werden, wenn der Konsument die öffentlich-rechtlichen Medien nicht nutzt) – subventioniert wird. Bestimmte Fußballspiele sind Ereignisse von nationalem Interesse bzw. werden durch die Beteiligung der öffentlich-rechtlichen Anstalten dazu gemacht. Die steuerfinanzierte Teilhabe einer Mehrheit der Bürger an nationalen oder internationalen Fußballereignissen kann als eine Art öffentlichen Gutes gelten. Die Umverteilung, welche die Fernsehsender hierbei vornehmen (von Nicht-Fußballbegeisterten zu den Fans) liegt in der Natur der öffentlich-rechtlichen Medien (die fast täglich die Volksmusik subventionieren). Zum Problem wird die Intervention der öffentlich-rechtlichen Medien insofern, als sie auf den privaten Markt für Fußballkonsum zurückwirkt und diesen zusätzlich verzerrt. Zwar haben sich ARD und ZDF ein Stück weit aus dem Profimarkt zurückgezogen, weil sie infolge ihres begrenzten Budgets mit der Preisentwicklung auf dem Markt der Fußballrechte nicht mehr Schritt halten konnten. Gleichwohl erhalten sie ein begrenztes Angebot (Länderspiele, Zusammenschnitte in den Nachrichtensendungen) aufrecht. Sie wirken als letzte Reserve gegenüber einem vollkommen privatisierten Markt. Sie haben eine "Grundversorgung" der Bevölkerung mit Fußball zu gewährleisten, was es den privaten Anbietern – in erster Linie dem Pay-TV – natürlich erschwert, ein wirklich exklusives Angebot zu unterbreiten. Wenn ARD und ZDF dafür sorgen, dass die Weltmeisterschaftsspiele sowie die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gratis übertragen werden, bleiben dem Pay-TV nur die weniger attraktiven Begegnungen, die – angesichts der Grenzen, die durch die verfügbaren Einkommen und die Öko-
[Seite der Druckausg.: 19]
nomie der Aufmerksamkeit gesetzt werden – nur eine vergleichsweise kleine Zahl von Konsumenten zu Zahlungen motivieren werden. [Vielleicht lässt sich die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien für den Profifußball mit der von internationalen Messen und Ausstellungen vergleichen, die vom Staat zugunsten der Wirtschaft finanziert oder subventioniert werden. Die öffentlich-rechtlichen Medien subventionieren vor allem das Segment des Profifußballs, das in der gegebenen Strukturierung des Marktes eher ein Fremdkörper ist, da es dem Vereinsfußball Energien und Ressourcen entzieht: Die internationalen Tourniere der Nationalmannschaften. Deren ökonomischer Sinn für die Spieler und Vereine entspricht dem einer Fachmesse, die allerdings enorme Aufmerksamkeitspotentiale mobilisiert. Hier werden keine wichtigen Geschäfte getätigt, wohl aber künftige Geschäfte vorbereitet. Es handelt sich also um eine nicht einträgliche, aber notwendige Ablenkung vom Business.]
Fußballkonsum ist ein Massenphänomen, und die Massen der Fans sind potentielle Wähler. Fußball ist daher auch ein ideales Medium für Populismus. Es ist kein Zufall, dass Berlusconi seinem Wahlbündnis den Schlachtruf der italienischen Fußballfans Forza Italia gab. Wenn sich ein Politiker als Fan, Vereinsmitglied oder ehemaliger Spieler outet, gibt er bekannt, dass er sich den Massen, den vielen kleinen Männern – und einigen Frauen - auf der Straße und in den Stadien, verbunden fühlt. Fußball ist m. a. W. eine ideale Projektionsfläche nicht nur für privatwirtschaftliche, sondern auch für politische Werbung. Das Gesicht des bekannten Politikers auf der Ehrentribüne geht ebenso in die Wahrnehmung der Zuschauer ein wie die Werbung für den Baumarkt auf der Bande. Politiker haben daher unabhängig von ihrer parteipolitischen Zugehörigkeit ein Interesse am Erhalt dieser Projektionsfläche. Daher dokumentieren sie nicht nur gern ihre Volksnähe durch einen Handschlag mit dem Kapitän der Nationalmannschaft, sondern nehmen auch öffentlich Stellung, um den Fußball im Interesse der von ihnen vertretenen Massen zu erhalten, zu fördern, vor Missbrauch zu schützen usw. Die Attraktivität des Fußballs für Spitzenpolitiker geht auf die zunehmende Bedeutung des personality-Faktors in der politischen Auseinandersetzung zurück – einen Sachverhalt, den man als Verflachung des Politischen beklagen mag, der in der Mediengesellschaft aber kaum umgangen werden kann. Politik, die ohne Inszenierung nicht mehr auskommt, bedarf des komplementären Spektakels aus Sport und Entertainment. Wenn die Politik aus der Gratisnutzung des Fußballs aber den Schluss zieht, es bedürfe zur Erhaltung oder Gestaltung des Sports spezieller politischer Initiativen, begibt sie sich, wie Norbert Seitz gezeigt hat, auf eine für die Politiker selbst gefährliche Gratwanderung: Wenn die Fans die Präsenz der Politiker als Anbiederung wahrnehmen, kann der populistische Schuss leicht nach hinten losgehen. Denn heute wird man es keinem Politiker so einfach verzeihen, einen Torschützen mit einem Torhüter zu verwechseln.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juni 2002