

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

Turkmenistan : Personenkult statt Demokratisierung / Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Industrieländer. - Bonn, 1997 (Politikinformation Osteuropa ; 70)
Turkmenistan hat fast die Fläche Spaniens, aber nur 4,3 Millionen
Einwohner. Es besteht zum großen Teil aus Wüstengebieten, die
aber beachtliche Öl- und Gasvorräte bergen. Turkmenistan erhielt
seine Unabhängigkeit im Umfeld des Zusammenbruchs der Sowjetunion
im Oktober 1991.
Bevölkerungsstruktur Turkmenistans
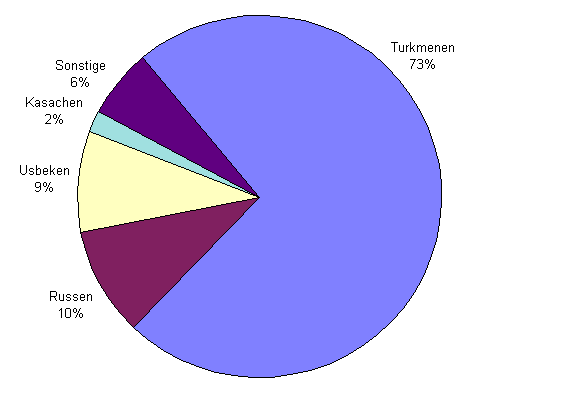
Turkmenistan ist ein Staat mit einer Reihe ethnischer Minderheiten,
deren stärkste die Russen sind (siehe obige Grafik). Die Regierung
betreibt eine relativ maßvolle Minderheitenpolitik, um die wirtschaftlich
wichtigen Russen im Lande zu halten. Ethnisch-nationale Identitäten
sind im Vergleich zu Stammes- und Familienloyalitäten gering ausgeprägt.
Wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland
Angesichts seiner großen Öl- und Gasvorräte erhoffte
sich Turkmenistan nach der Unabhängigkeit schnellen Reichtum durch
Verkauf zu Weltmarktpreisen. Dazu fehlt es aber an Pipelineverbindungen.
Auf absehbare Zeit haben Rußland und andere Nachfolgestaaten der
UdSSR das Abnahmemonopol und Turkmenistan keine andere Wahl, als die Rohstoffe
deutlich unter Weltmarktpreis an Abnehmer wie die russische Gazprom abzugeben.
In letzter Zeit versucht Turkmenistan die Abhängigkeit durch eine
offensive Politik der Anknüpfung wirtschaftlicher Beziehungen außerhalb
der GUS zu vermindern. So hat es besonders mit dem Iran Vereinbarungen
über Verkehrsprojekte und eine Gasleitung getroffen. In der GUS gehört
das Land zwar zu den Verweigerern einer engeren Kooperation. Es sucht aber
nicht die Konfrontation mit Moskau.
Die zweite große Einnahmequelle des Landes, die Baumwolle,
schafft noch größere Probleme. Auch hier sind fast alle Weiterverarbeitungskapazitäten
im Ausland angesiedelt. Außerdem sinkt die Produktivität. Die
ökologischen Probleme verschärfen sich ständig, da der bewässerungsintensive
Baumwollanbau in dem trockenen Wüstenklima zu hoher Verdunstung und
damit zu einer zunehmenden Versalzung der Böden führt.
Seit 1991 sank das Sozialprodukt um 40-50%. Die Inflation erreichte
vierstellige Raten. Die Arbeitslosigkeit stieg auf über 20% an, wobei
einer relativ konstanten Beschäftigung ein wachsendes Arbeitskräftepotential
gegenübersteht. Denn die Bevölkerung wächst mit 2,6% pro
Jahr (Deutschland dank Zuwanderung: 0,6%).
Der Präsident baut sich seine Republik
Wie andere zentralasiatische Republiken (z.B. Usbekistan) erlebte Turkmenistan
keinen wirklichen Machtwechsel. Der starke Mann des Staates war und ist
Saparmurad A. Nijasow, der seinen Aufstieg in der Kommunistischen
Partei gemacht hat. Seit 1985 war er Parteichef und Ministerpräsident
der Sowjetrepublik. 1990 wurde er Staatspräsident und Vorsitzender
des Obersten Sowjets Turkmenistans.
Nach der Unabhängigkeit 1991 gab sich das Land im Mai 1992 eine
neue Verfassung, die bei allen westlich-demokratisch wirkenden Rechten
und Regeln dem Präsidenten eine äußerst starke Stellung
einräumt. Bei den Präsidentschaftswahlen 1992 erzielte
Nijasow in bewährter kommunistischer Tradition 99,5% der Stimmen bei
einer Wahlbeteiligung von 99%. 1994 ließ er in einem Referendum seine
Amtszeit bis 2002 verlängern.
Um diese politische Macht rankt sich ein stalinistisch anmutender Personenkult,
bei dem sich alles um den "Turkmenbaschi", das "Oberhaupt
der Turkmenen", dreht. Diesen Titel verlieh ihm das Parlament 1993.
Sein Geburtstag wurde zum Nationalfeiertag erklärt. Sein Bild schmückt
die Banknoten der nationalen Währung.
Die Opposition wird unterdrückt
Neben vielen anderen Ämtern hat Präsident Nijasow seit Dezember
1991 auch den Vorsitz der "Demokratischen Partei Turkmenistans"
inne. Diese Nachfolgepartei der alten KP ist das parteipolitische Machtinstrument
des "Turkmenbaschi". Bei den Wahlen zum Parlament, dem "Mejlis"
oder "Madshlis", konnten die Wähler 1994 die 50 Sitze nur
mit 50 Kandidaten einer vom Präsidenten bestimmten Einheitsliste füllen.
Das Parlament ist praktisch machtlos. Die Wahlbeteiligung lag offiziell
bei 99,8%, Beobachtern zufolge aber erheblich niedriger.
Alle Oppositionsparteien bis auf die Bauerngerechtigkeitspartei
sind verboten. Diese Pseudo-Opposition ist ebenfalls ein Geschöpf
Nijasows. Die wirklichen Oppositionskräfte wie "Demokratische
Front Partei" von Durdu Murad oder die Gruppe Agzybirlik" (Einheit)
werden verfolgt und mußten ins Ausland, vor allem nach Moskau ausweichen.
Selbst dort sind sie vor Nachstellungen durch den turkmenischen Geheimdienst
nicht sicher.
Die Presse wird zensiert. Selbst die russische Iswestija mußte
ihr Büro in Aschchabad schließen, nachdem sie kritische Artikel
veröffentlicht hatte. Die "modernen" Eliten der Inteligenz
und der Unternehmer zeigen bisher wenig Initiative zur aktiven Oppositionspolitik
trotz der katastrophalen wirtschaftlichen Ergebnisse. Die wenigen Demonstrationen
in der Hauptstadt schlug die Polizei rasch nieder. Es gibt aber Anzeichen,
daß der Widerstand der "traditionellen" Eliten, der Führungspersönlichkeiten
der Stämme, Klans und Großfamilien, wächst.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | März 1998