

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
-
Bernd Vielhaber:
Sterbebegleitung und Hospizbewegung aus der Sicht der AIDS-Hilfe
- 1. Zur Situation des gesellschaftlichen Umgangs mit Tod und Sterben
-
2. Zur Situation der Sterbebegleitung im AIDS-Bereich
- 2.1. Epidemiologische Ausgangslage
- 2.2. Medizinisch-pflegerische Implikationen von AIDS
- 2.3. Bedingungen einer ambulanten Versorgung
- 2.4. Bedingungen einer stationären Versorgung
- 2.5. Psycho-soziale Implikationen von AIDS
- 2.6. Herkunftsfamilie und Wahlfamilie
- 2.7. Der Mythos vom würdigen/selbstbestimmten Sterben
- 2.8. Bilanz-Suizid im AIDS-Bereich
- 3. Fazit
Bernd Vielhaber:
Sterbebegleitung und Hospizbewegung aus der Sicht der AIDS-Hilfe
Lassen Sie mich Ihnen im ersten Teil „Zur Situation des gesellschaftlichen Umgangs mit Tod und Sterben" aus meiner Sicht einige grundsätzliche Gedanken zum Thema der Veranstaltung darlegen.
Anschließend möchte ich Ihnen im zweiten Teil „Zur Situation der Sterbebegleitung im AIDS-Bereich" eine Beschreibung der epidemiologischen Ausgangslage, der sozialen und medizinischen Bedingungen und Implikationen von AIDS geben, um Ihnen einen Eindruck von den vorhandenen Rahmenbedingungen zu vermitteln. Diese haben einen wesentlichen Einfluß auf die konkrete Ausgestaltung des Sterbens, ebenso, wie sie die institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen einer Sterbebegleitung im AIDS-Bereich bestimmen.
1. Zur Situation des gesellschaftlichen Umgangs mit Tod und Sterben
1.1. Der (fehlende) Aspekt der Organisation/Institution
Der Titel der Veranstaltung lautete: ‘Der gesellschaftliche Umgang mit Sterben und Tod – humane, medizinische und finanzielle Aspekte’. Erstaunlich finde ich, das der Aspekt der Organisation (Institution) nicht im Titel auftaucht, aber auch sonst nicht in Form von Referaten berücksichtigt wurde. Versteht sich doch die Hospizbewegung als eine Antwort auf das Sterben in Institutionen (Organisationen) – vornehmlich in Krankenhäusern.
In den letzten Jahren ist viel über dieses institutionalisierte Sterben und seine menschenunwürdigen Bedingungen geredet und geschrieben worden. Heftig wurden hierbei die Krankenhäuser kritisiert. Ich möchte an dieser Stelle für die Krankenhäuser eine Lanze brechen: Sie gehören zum medizinischen System, sind zur Gänze auf Heilung – wenn Sie wollen auch „Reparatur" – ausgerichtet. Nur dieses unbedingte Streben nach Heilung und Gesundheit hat die medizinischen Fortschritte der letzten 100 Jahre überhaupt erst möglich gemacht. In diese Kultur paßt der Tod nicht hinein und gehört es meiner Auffassung nach auch nur sehr begrenzt. Er stellt eine Kulturverletzung dar. Das medizinische System würde sich überfordern, wenn es seine vorhandene – notwendige – Kultur, um den Tod erweitern würde. Wer die Gleichwertigkeit von Heilung und Sterbebegleitung fordert, muß sich darüber im Klaren sein, daß dies nur um den Preis geht, das gesellschaftliche Bild von Gesundheit und Krankheit zu verändern und die gesellschaftlichen Forderungen an das medizinische System zu verändern.
Zum anderen ist die Ausgrenzung des Aspektes der Institution/Organisation um so befremdlicher, als Hospize (egal welcher Provenienz und konkreten Ausformung) nichts anderes als Organisationen/Institutionen darstellen. Sie sind Vereine, gGmbH’s oder ähnliches.
Hat man in der Vergangenheit die „Hospitalisierung" des Sterbens kritisiert, hat sie einer „Hospizialisierung" Platz gemacht. Eine Entwicklung, die ich in mehrfacher Hinsicht ausgesprochen problematisch finde, da sie einerseits mit einer Ideologisierung, Mythologisierung und auch einer Relativierung des Todes einhergeht. (Siehe hierzu auch unter: Der Mythos vom würdigen/selbstbestimmten Sterben weiter unten im Text.) Andererseits sind gegenüber der vorherrschenden, ausgesprochen starken, Betonung der unbedingten Konzentration auf die Bedürfnisse des Sterbenden, Zweifel angebracht. Einerseits werden mit dieser intellektuellen Konzentration die Rechte von Mitarbeitern vollständig wegkonzeptioniert, andererseits handelt es sich hierbei um nichts anderes als einen Mythos. Wie sieht es denn bitte schön – um einmal ein ideologisch, moralisch und gesellschaftlich unbedenkliches Beispiel zu bemühen – mit der Lust und den Möglichkeiten der Hospizbewohner aus, zu rauchen?
Lassen Sie mich an dieser Stelle ein Zitat von R. Gronemeyer anbringen. Er schreibt: [Gronemeyer, R.: Die Entfernung vom Wolfsrudel. Über den drohenden Krieg der Jungen gegen die Alten, S. 166-167.]
„Die Narkotisierung des Todes erreicht mit der Einführung der professionellen Sterbebegleitung eine neue Stufe. Nicht mehr das Schmerzmittel allein dämmt den Schrecken des Todes ein, sondern auch eine spezielle therapeutische Behandlung durch geschultes Personal. Der Sterbende muß sich nicht mehr nur mit den medizinischen Angriffen auf seine Souveränität auseinandersetzen, sondern auch mit subtilen psychotechnischen Versuchen, aus ihm ein Objekt der Behandlung zu machen. Die Pfleger kommen mit Schläuchen und mit Gesprächstechniken. Den Schlauch kann man abreißen, den Moribundenarbeiter (Vorschlag für eine Berufsbezeichnung analog dem Sozialarbeiter) wird man nicht los."
1.2. Der gesellschaftliche Aspekt
Es wird immer wieder über die sozio-demographische Situation, die drohende Umkehrung der Alterspyramide, die Zunahme von Single-Haushalten, die Unmöglichkeit, bei der sich abzeichnenden Entwicklung den Generationenvertrag noch einzuhalten und dergleichen mehr, geredet.
Leider wird diese Form der Diskussion der Realität überhaupt nicht gerecht. Sie stellt vielmehr nur einen kleinen Teil der Situation dar.
Neben der oben angeklungenen Dimension des gesellschaftlichen Bedeutungsrahmens für Gesundheit und damit auch für Krankheit, möchte ich an dieser Stelle die Dimension der Zeit näher beleuchten. Sie werden sich möglicherweise fragen, was will er denn jetzt bloß mit der Zeit; lassen Sie sich einmal ein:
Unsere postmoderne Gesellschaft löst tendenziell jene Ordnung der Zeit auf, über die die Differenz von Anfang und Ende zu erfahren ist. In einer Hochgeschwindigkeitsgesellschaft wird die Zeit selbst zum Gegenstand der Beschleunigung. Die Folge ist, daß uns häufig die notwendige Zeit fehlt, um eine sinnvolle soziale und individuelle gefühlsregulierende Architektur zwischen Anfang und Ende aufzubauen. Das Ende des Alten und der Anfang des Neuen fallen immer öfter zusammen. Das Neue wird hektisch durchs Neue ersetzt. Trennungen und Anbindungen, Anfänge und Schlüsse geschehen zeitgleich, sie verschwimmen zur Unkenntlichkeit ineinander.
Die neuen Technologien, die durch immer neuere abgelöst werden, verunmöglichen in wachsendem Maße die Erfahrung von Dauer. Veränderungen geschehen, ohne daß wir sie wahrnehmen (zum Beispiel bei einer Flugreise). Ohne Dauer gibt es auch keinen Anfang und kein Ende mehr, es bleibt nur mehr das Ab- und Einschalten, das Aus- und Einsteigen, oder – wie beim Umgang mit den neuen Informationstechnologien üblich – das Löschen statt aktivem Vergessen und Beenden. Wir verlieren die Distanz zu uns und unserer Umwelt, die im bewußten Beginnen und Beenden zum Ausdruck kommt, wir verlieren jenen langen Blick auf die Dinge und die Entwicklungen, der nach dem Anfang auch ein Ende mitbekommt. Wir müssen der Festigkeit und der Sicherheit eines Rahmens entbehren, in dem der Anfang und der Schluß eine Art Rhythmus bilden.
Unser Leben geschieht im „Trans"; wir werden transportiert – und wenn es der Beziehungstransit ist, der unser Leben zunehmend zu einem dem Endgültigen entfliehenden Provisorium macht. Grenzenlose Betriebsamkeit, für die sich die Wortschöpfung „Sozial-Zapping" anbietet, ist das Ergebnis. Diese Betriebsamkeit läßt das Scheiden, das Unterscheiden nicht mehr zu.
In jenem Umfang, wie sich die Zeitordnungen von der Natur (innerer und äußerer Natur) und von den sozialen Ereignissen abgelöst haben, verloren die Riten, die Zeremonien, die Symbole des Endes, ihre prägende Kraft. Diese Loslösung ist in der Idee des Fortschritts grundgelegt. Im heute gültigen Modell „Fortschritt" gibt es keinen Schluß, keine Voll-Endung. Stetig muß es weitergehen. Das Ziel menschlichen Handelns ist nicht-konkret, es ist der menschliche Fortschritt selbst. Das Ende des Wachstums ist in diesem Denken nicht etwa ein Ende, das feierlich begangen wird (eben die Vollendung), es ist die Katastrophe, vor der sich alle fürchten. Anfang und Ende, dies ist die Konsequenz, werden durch das vom Menschen gemachte Tempo bestimmt. Endlichkeitsdemut und neuzeitliches Fortschrittsdenken lassen sich, wie Blumenberg [Blumenberg, H.: Der Prozeß der theoretischen Neugierde, Frankfurt 1973.] herausgearbeitet hat, nicht mehr vereinbaren. [Geißler, K.-H.: Ich muß jetzt Schlußmachen. Über das Abschiednehmen in der Alltagskultur, in: Universitas 1994, 582: 1135-37.]
Was für ein konservativer Knochen, werden Sie möglicherweise denken, und dabei ist er noch so jung. Weit gefehlt. Mir geht es nicht um ein sozialromantisches Beklagen des Zustände unserer Gesellschaft. Mit geht es um nichts anderes, als deutlich zu machen, daß es sich bei dem emotionalen Bedürfnis und Bestreben der Hospizbewegung, den Tod und das Sterben wieder in den Schoß der Familie zu re-integrieren, um ein a priori zum Scheitern verurteiltes Unterfangen handelt.
1.3. Die Hospizbewegung
Um den Hospizgedanken – so, wie ihn die Hospizbewegung denkt und formuliert – wieder in die Gesellschaft zurückzutragen, müßte sie sich grundlegend ändern. Dies hätte weitreichende Konsequenzen – für alle gesellschaftlichen Bereiche, für zwischenmenschliche Beziehungen genauso wie für die wirtschaftliche Entwicklung.
Die Gesellschaft ist wie sie ist. Sie wird sich nicht verändern, denn die weltweiten Bedingungen unserer Existenz (Ökologie und Weltwirtschaft, um nur zwei Beispiele zu geben), machen eine Rückentwicklung im Sinne der Hospizbewegung unmöglich – darüber hinaus ist sie, meiner Auffassung nach, weder zweckmäßig noch sinnvoll – geschweige denn wünschenswert.
Man mag diese oft beklagte „Atomisierung" der Gesellschaft für den Fluch der Aufklärung, die logische Folge der Individualisierung, die Schattenseite des Kapitalismus, die Strafe Gottes für die Abkehr von christlichen Werten oder was auch immer halten. Sie ist jedoch unabdingbar mit Menschenrechten und Freiheit verknüpft und ermöglicht es homosexuellen und drogengebrauchenden Menschen überhaupt erst, ein menschenwürdiges Leben zu führen. In diesem Sinne ist die Hospizbewegung zutiefst konservativ. Sie hat nichts innovatives oder zukunftsweisendes.
Meiner Auffassung nach werden wir uns damit abfinden müssen, daß die Zeiten, in denen Sterben ein Bestandteil des Familienlebens oder des sozialen Lebens war, ein-für-alle-mal vorbei sind. Hospize werden um so dringender als Institutionen benötigt, die – besser als Krankenhäuser – dazu in der Lage sind, Bedingungen für ein menschenwürdigeres Sterben zu gestalten.
Hospizbewegung im beginnenden 21. Jahrhundert heißt, Abschied zu nehmen, von den überkommenen Idealen und Tod-und-Sterben-Mythen. Abschied von einer romantischen Vorstellung über unsere Gesellschaft, unser eigenes Leben und Sterben. Hospizbewegung heißt, auf dem Boden dessen, was ist, an einer zukunftsweisenden Veränderung des Umgangs mit Sterbenden und Tod zu arbeiten, das medizinische System um einen „Strang" zu erweitern ohne es einzuschränken.
2. Zur Situation der Sterbebegleitung im AIDS-Bereich
2.1. Epidemiologische Ausgangslage
In 1993 starben in der Bundesrepublik Deutschland 2.030 Personen an AIDS. Seit 1985 sind in der BRD 9.224 Personen an AIDS verstorben (Stichtag: 31.12.1993). Hierbei handelt es sich um Angaben des Statistischen Bundesamtes. Trotz alledem gibt dies nicht die wirkliche Zahl wieder, da wir aus langjähriger Erfahrung wissen, daß in etlichen Fällen – gerade, wenn die Bestattung in ruralen Gebieten stattfindet –, die Ärzte aus Rücksicht auf die Angehörigen die Diagnose AIDS nicht auf dem Totenschein erscheinen lassen und sich mit Diagnosen wir Exazerebation oder Marasmus nach Tumoren o.ä. behelfen. (Zum Vergleich: Das AIDS-Zentrum des Robert-Koch-Institutes gibt in seinem 116. Bericht die Zahl der – freiwillig gemeldeten – AIDS-Toten zum 31.12.1994 mit 7.522 an.)
Das folgende Diagramm zeigt die Verteilung der AIDS-Toten nach Altersgruppen von 1985 bis 1993.
Sterbefälle an AIDS (nach Altersgruppen)
1985-1993 (bis einschl. 1989 ohne ehem. DDR)
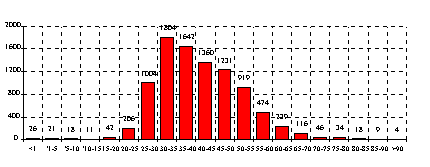
Sie können hier deutlich erkennen, daß der Hauptanteil der AIDS-Toten zwischen 30 und 35 Jahren alt ist. Das Durchschnittsalter der an AIDS Verstorbenen lag im Mittel (1985–1993) bei 39,91 Jahren.
Im Gegensatz dazu, liegt das Durchschnittsalter der HIV-Infizierten derzeit bei 33,89 Jahren. Die Infektionen verteilen sich wie folgt:
68,1% homo- und bisexuelle Männer,
14,1% drogengebrauchende Männer und Frauen,
5,6% Hämophile und Transfundierte,
5,1% Heterosexuelle,
7,1% Sonstige.
70,76% der bis zum 31.12.1994 beim AIDS-Zentrum registrierten (insgesamt 66.617) Fälle von HIV-Infektionen betreffen Männer, 16,01% Frauen. Bei 13,23% lagen keine Angaben zum Geschlecht vor. [Die Zahlenangaben sind dem 116. Bericht des AIDS-Zentrums entnommen. Sie beziehen sich allerdings auf die dem AIDS-Zentrum gemeldeten AIDS-Todesfälle. Da die Zahlenangaben des AIDS-Zentrums bezüglich der Verteilung der HIV-Infek tionen keinerlei Aussagekraft besitzen (so sind in 1994 ganze 38,8% und 1993 sogar nur 34,1% der eingegangenen Meldungen über bestätigte HIV-Antikörpertest bezüglich des möglichen Infektionsweges aussagekräftig gewesen), habe ich hier hilfsweise die Angaben der AIDS-Todesfälle verwendet.]
AIDS ist – trotz deutlich verbesserter medizinischer Therapiemöglichkeiten – nach wie vor eine lebensbeendende Erkrankung. Die durchschnittliche Überlebenszeit nach Diagnosestellung (dies meint nicht das positive Testergebnis des HIV-Test, sondern den Zeitpunkt des Ausbruchs der AIDS-Erkrankung!) lag für in 1994 Verstorbene bei 19,1 Monaten. (Zum Vergleich: Für in 1993 an AIDS Verstorbene lag die durchschnittliche Überlebenszeit bei nur 17,4 Monaten, zu Beginn der Pandemie bei weniger als drei Monaten.)
Wenn man das Durchschnittsalter der HIV-Infizierten zu dem Durchschnittsalter der an AIDS Verstorbenen in Beziehung setzt, ergibt sich hieraus eine mittlere Überlebenszeit von 6,02 Jahren ab Zeitpunkt des Testergebnisses (nicht ab Zeitpunkt der Infektion!).
2.2. Medizinisch-pflegerische Implikationen von AIDS
Die Krankheit AIDS verläuft nicht linear progredient. Sie verläuft vielmehr in Intervallen und Schüben, die nicht vorhersehbar sind. Nach der Infektion mit HIV kommt es in der Regel zu einer jahrelangen Phase, in der das Immunsystem die Infektion derart kontrollieren kann, daß es zu keinerlei Krankheitssymptomen kommt. Der „Patient" fühlt sich gesund und ist es insoweit auch, daß er keinerlei Symptome einer HIV-Erkrankung, erhöhte Infektanfälligkeit o.ä. hat. Diese Phase kann – nach bisherigem Stand der Forschung – 15 Jahre und länger dauern. Sie kann aber auch nur wenige Wochen oder Monate dauern. Niemand kann vorhersagen, wann das Gleichgewicht zwischen HIV-Virus und Immunsystem zusammenbricht und die Krankheitsprogredienz beginnt.
Die längste Überlebenszeit mit der Diagnose AIDS-Vollbild liegt – soweit ich die Literatur vollständig gesichtet habe – bei etwa 10 Jahren. Sie kann – in Fällen, in denen Patienten (mit oder ohne Wissen ihrer HIV-Infektion) sich erst zu einem Zeitpunkt in medizinische Behandlung begeben, zu dem eine opportunistische Infektion nicht mehr behandelbar ist – aber auch nur wenige Tage oder Stunden betragen. Dies hängt entscheidend vom Zugang zu medizinischen Behandlungsmöglichkeiten und medikamentösen Prophylaxen der sogenannten opportunistischen Infektionen ab, die schlußendlich das Krankheitsbild AIDS konstituieren und, aufgrund des immer schlechter arbeitenden Immunsystems, immer schwerer bis gar nicht mehr behandelbar sind.
Phasen relativer Gesundheit wechseln mit Phasen akuter Behandlungsbedürftigkeit ab. Mögen die ersten opportunistischen Infektionen noch ambulant behandelbar sein, kommt es doch zu immer häufigeren und länger dauernden Krankenhausaufenthalten. Die Rekonvaleszenzphasen werden immer länger, die Krankheitsphasen immer länger, die Phasen relativer Gesundheit oder gar Arbeitsfähigkeit immer kürzer.
Dieser intervallartige Verlauf der Erkrankung bleibt häufig bis zu Tode erhalten. So können Patienten mit einer Lebenserwartung von deutlich unter sechs Monaten durchaus Phasen relativer Gesundheit haben, in denen sie – soweit sie es noch können und wollen – am „normalen" Leben ihrer Szenen teilnehmen.
2.3. Bedingungen einer ambulanten Versorgung
Im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Ausbau ambulanter Hilfen für an AIDS-Erkrankte im Rahmen von Sozialstationen" wurde zwischen 1987 und 1990 modellhaft erprobt, inwieweit die pflegerische Betreuung von AIDS-Patienten im Rahmen des vorhandenen Systems von Sozialstationen und anderer ambulanter Einrichtungen versorgt werden können. In dem Dienst, in dem ich gearbeitet habe, lag im ersten Jahr die mittlere Verweildauer (= Überlebenszeit) der Patienten bei 2,34 Monaten, wobei das Spektrum ein Tag bis 16 Monate umfaßte. In 1994 lag die mittlere Verweildauer bei 5,5 Monaten.
Als Erfahrung aus dem BuMo haben sich in der BRD 16 Spezialpflegedienste in AIDS-Hilfe-Organisationen oder in Kooperationsmodellen mit AIDS-Hilfen gegründet, da offensichtlich die Sozialstationen zu der damaligen Zeit weder personell, institutionell noch finanziell in der Lage waren, den erheblichen Erfordernissen der terminalen AIDS-Pflege Rechnung zu tragen. [Zur ausführlichen Bewertung des Bundesmodellprogramms „Ausbau ambulanter Hilfen für an AIDS-Erkrankte im Rahmen von Sozialstationen" siehe auch den Abschlußbericht des Modellprogramms vorgelegt von der wissenschaftlichen Begleitforschung, dem Institut für Entwicklungsforschung und Strukturplanung in Hannover, herausgegeben vom (damaligen) BMJFFG.]
So stellt der kaum vorhersehbare wellenförmige Verlauf der Erkrankung erhebliche Anforderungen an die Flexibilität von Einsatzplänen. Mitarbeiter der Spezialpflegedienste haben keine geregelte Arbeitszeit. Erreichbarkeit sieben Tage die Woche, 24 Stunden täglich ist unabdingbare Voraussetzungen für diese Arbeit. Die Kosten für eine 24-Stunden-Rund-um-die-Uhr-Betreuung können – bei unter Umständen notwendig werdendem Einsatz ausschließlich dreijährig examinierter Pflegefachkräfte – 1.400 DM und mehr pro Tag betragen. Summen, die die Mischkalkulationen von herkömmlichen Sozialstationen betriebswirtschaftlich schlechterdings nicht zulassen.
Darüber hinaus stellte sich schnell heraus, daß im Rahmen der terminalen AIDS-Pflege die Durchführung von Infusionstherapie notwendig ist. Als Begründung seien hier nur zwei von mehreren Indikationen genannt.
Erstens: die CMV-Retinitis, die unbehandelt zur völligen Erblindung führt – leider sind die beiden Medikamente, die zu Behandlung dienen, nur per infusionem verabreichbar.
Zweitens: TPN – viele AIDS-Patienten haben schon sehr frühzeitig erhebliche Störungen ihrer Stoffwechselfunktionen, so daß der Körper körpereigenes Eiweiß (sprich Muskelmasse) anstatt Fettgewebe verbrennt. Es kommt gerade im Finalstadium zu behandlungsbedürftigen Marasmen.
Sowohl für die Mitarbeiterinnen von Sozialstationen, als auch für die Berufsverbände der Krankenpflegekräfte und die Bundesärztekammer stellte diese Notwendigkeit ein erhebliches Problem dar. Erst 1991 konnte hier eine befriedigende Lösung gefunden werden. In der Zwischenzeit bewegten sich alle infundierenden Pflegefachkräfte und Pflegedienste zumindest in einer rechtlichen Grauzone, die längst nicht alle Träger oder Mitarbeiter dulden konnten und wollten.
Da es sich bei AIDS-Kranken in der Regel um relativ junge, virile Männer handelt, die ausgesprochen gut – gelegentlich besser als ihre eigenen Ärzte – über ihre Erkrankung informiert sind und es gelernt haben, sich zu artikulieren und durchzusetzen, strukturiert sich eine adäquate AIDS-Pflege nach anderen Kriterien, als „herkömmliche" Pflegen strukturiert sind. Themen wie Sexualität, Drogenkonsum, Rausch und Suizid sind Themen, die eigentlich in jeder AIDS-Pflege einen großen Stellenwert innehaben.
Um Ihnen ein Beispiel aus der Praxis zu bringen:
26jähriger schwuler Patient im AIDS-Finalstadium, Polyneuropathie der unteren Extremitäten mit schmerzmittelresistenten Parästesien und aufsteigender Paralye bei paralytischen Kontrakturen und paralytischen epileptiformen Anfällen. Zu Beginn der Paralye war der Patient noch in der Lage, ohne Hilfestellung zu masturbieren. Bei fortschreitenden Kontrakturen konnte er dies jedoch nicht mehr ohne fremde Hilfe bewerkstelligen. Wenn die Beziehung zwischen dem Krankenpfleger und dem Patienten nicht so gewesen wäre, wie sie war, hätte der Patient mit großer Sicherheit seine Probleme nicht offenbart, mit der Konsequenz, das keinerlei Hilfestellung (auch in Form psychosozialer Betreuung und therapeutischer Gespräche) möglich gewesen wäre. Der Patient konnte jedoch sein Problem mit dem Pfleger besprechen. So konnten anfänglich die Probleme des Patienten mit Lagerungshilfen behoben werden (z.B. Sandsäcke auf die Beine usw.). Bei fortschreitenden Kontrakturen mußte sich allerdings der Krankenpfleger mit seinem Oberkörper auf die Beine des Patienten legen, damit dieser noch onanieren konnte. Zu der Zeit wurde im Dienst heftig darüber diskutiert, wie weit die Hilfestellung gehen könne, ob man nicht auch „Hand anlegen" müsse, wenn der Patient darum bitte. Der Dienst einigte sich darauf, für den Fall, das der Patient weitergehende Hilfen bei der Masturbation benötige, man einen professionellen Call-Boy engagieren würde.
Möglicherweise schockiert Sie dieses Beispiel aus der Praxis der Sterbebegleitung von AIDS-Patienten. Es macht jedoch in vielfältiger Weise die Anforderungen deutlich, die eine AIDS-Pflege stellt oder stellen kann.
2.4. Bedingungen einer stationären Versorgung
Auch im Bereich der stationären Versorgung sind die Grenzen herkömmlicher Krankenhausstrukturen schnell erreicht worden. Der bereits oben erwähnte hohe Kenntnisstand der Patienten über die eigene Erkrankung, ebenso wie die spezifischen Verhaltensmuster der Hauptbetroffenengruppen erforderten einen veränderten Umgang, ermöglichte ihn gleichzeitig aber auch erst.
Ich will hier nur zwei Bereiche herausgreifen:
1. Die Integration von Selbsthilfegruppen in die stationäre Versorgung:
Relativ schnell haben Selbsthilfegruppen und AIDS-Hilfen die Krankenhäuser in ihr Betätigungsfeld zu integrieren versucht. Dies hat erhebliche Irritationen bei allen Beteiligten hervorgerufen. Einerseits war das System Krankenhaus nicht so ohne weiteres bereit, diese systemfremde Lebens-Dynamik zu integrieren, andererseits waren die AIDS-Hilfen überhaupt nicht bereit, die vorgefundenen Krankenhausstrukturen als unveränderlich – quasi „Gott-gegeben" – zu akzeptieren. Bis heute sind keine befriedigenden – geschweige denn optimale – Lösungen für viele Probleme gefunden – hier seien nur die Differenzen Ruhe, Isolationsbedürfnis der Patienten und Integrationsbestrebungen der Selbsthilfe oder auch Anonymität und Klatsch genannt.
Andererseits mußten sich plötzlich Ärzte – bis hin zu Ober- und Chefärzten – mit ausgesprochen gut informierten und selbstbewußten Patientenfürsprechern auseinandersetzen und im Einzelfall diesen gegenüber Entscheidungen rechtfertigen oder zumindest doch nachvollziehbar erläutern. Häufig haben Ärzte von Behandlungsaktivisten in der Vergangenheit gelernt, welche Behandlungsstrategien, Medikamente und adjuvanten (holistischen) Therapieformen in anderen Ländern (speziell USA und Großbritannien) zur Anwendung kommen.
Patienten, Selbsthilfegruppen und Ärzte mußten darüber hinaus lernen, daß es trotz immer besser werdenden Behandlungsmöglichkeiten, keine Heilungschance gibt, ja noch nicht einmal Schmerzfreiheit garantiert werden kann.
2. Das Rooming-In:
Eigentlich eine eher aus der Geburtshilfe oder Kinderheilkunde bekannte Methode, Mutter und Kind zusammen unterzubringen, um psychisch negative Auswirkungen für das Kind zu vermeiden. Deutlich geworden ist, daß Rooming-In für viele AIDS-Patienten eine wichtige Entlastung darstellt. Etliche Krankenhäuser haben deshalb die gemeinsame Unterbringung von AIDS-Patienten und Lebenspartnern mittlerweile ermöglicht. Aber auch hier galt es zu lernen. Ich kann mich noch gut an die ersten Berichte von Patienten/Lebenspartnern auf der einen Seite und befreundeten Pflegekräften auf der anderen Seite erinnern, die aus ihrer jeweiligen Sicht berichteten, wie unsensibel und naiv die Pflegekräfte mit dem Rooming-In umgegangen sind. So haben in der Anfangsphase viele Nachtschwestern – wie im allgemeinen üblich – ihre Rundgänge gemacht, ohne zu berücksichtigen, daß ja der Lebenspartner mit im Zimmer liegt. Mehr als einmal haben sie die Patienten und deren Lebenspartner beim Sex gestört. Es hat einige intellektuelle und emotionale Anstrengungen gekostet, um sich von Bildern und Mythen über Tod und Sterben, darüber, wie Schwerstkranke und Sterbende sich zu verhalten haben oder wie sie sind, zu verabschieden und zu lernen, die Individualität jedes einzelnen und seine höchstindividuelle Form, seine Krankheit und sein Sterben zu gestalten, zu erkennen und zu respektieren.
2.5. Psycho-soziale Implikationen von AIDS
Aufgrund der oben dargestellten Zahlen ist deutlich geworden, daß es sich bei AIDS nach wie vor um eine Erkrankung handelt, die sich in den sogenannten „Hauptbetroffenengruppen" der schwulen Männer und DrogengebraucherInnen bewegt.
Wie bislang jede Seuche in der Medizingeschichte, hat AIDS auch bei uns den Drift in die sozial benachteiligten Randgruppen der Gesellschaft angetreten. Als warnendes „Vorbild" mag hier die USA gelten, die in ihrer epidemiologischen Entwicklung Europa noch um einige Jahre voraus ist. Hier ist AIDS am weitesten in den Slums der amerikanischen Großstädte verbreitet. Wie kann man auch Bevölkerungsschichten mit Präventionsbotschaften erreichen, die nicht wissen, wo sie die nächste Nacht schlafen und was sie den nächsten Tag essen werden?
Nun ist die Situation in der BRD (noch) lange nicht so dramatisch, wie z.B. in New York. Feststellen können wir aber, daß im Laufe der letzten 12 Jahre durchaus eine Veränderung der sozialen Situation von Menschen mit HIV und AIDS eingetreten ist, die Anlaß zu Besorgnis gibt. Ausschlaggebend sind hier nicht nur die „Gewöhnungseffekte" von z.B. Kranken- und Rentenversicherung, die zu Beginn der Pandemie weitaus großzügiger als heute Leistungen bewilligt haben. Die Ausgaben der Kommunen für Sozialhilfeleistungen sind in den letzten 15 Jahren um 30% gestiegen. Ein sicheres Indiz dafür, daß ein immer größerer Anteil der Bevölkerung an der Armutsgrenze lebt. Junge AIDS-Kranke haben in der Regel (noch) keine Rentenanwartschaften erworben, sie sind bei Ausbruch der AIDS-Erkrankung zum überwiegenden Teil auf Sozialhilfe angewiesen.
Dessen ungeachtet ist AIDS – nach wie vor – eine sozial ausgesprochen stark stigmatisierte Erkrankung. AIDS-Kranke erleiden häufig in doppelter Weise die Stigmatisierung. Einerseits als Diskriminierung durch die Gesellschaft, die bis hin zu Verlust von Arbeitsplatz, Wohnung und Freundeskreis und Beziehung zur Herkunftsfamilie führt. Andererseits aber auch intrapsychisch durch die Übernahme des gesellschaftlichen Schuldpostulates. Der, der AIDS hat – mit Ausnahme der Bluter, Transfundierten und Kinder, versteht sich – ist an seiner Erkrankung selbst Schuld. Schließlich hat er sich ja hedonistischen Lüsten hingegeben. Rausch. Sex. Etwas, mit dem die ach so aufgeklärte bundesrepublikanische Gesellschaft durchaus (noch) nicht umgehen kann, was auch in gewisser Weise an die Grundfesten einer christlichen – auf das Jenseits ausgerichteten – Gesellschaftsform rührt.
Darüber hinaus begegnete die Gesellschaft den Schwulen bislang – unter anderem – mit einem gewissen versteckten Neid. Neid auf Sex ohne Reue (ohne das Risiko der Schwangerschaft), Neid auf die scheinbar zum Lebensinhalt erhobene Promiskuität und die wunderlichen Sexualpraktiken, von denen Otto und Ottilie Normalbürger selbst in ihren kühnsten Träumen nicht zu träumen wagten – zumindest gaben sie dies vor. Dieser Sexualneid ist nun einer gewissen Schadenfreude gewichen. So risikolos war er offensichtlich dann doch nicht, der ach so gehaßte und – gerade von heterosexuellen Männern – gefürchtete schwule Sex.
Die narzißtische Kränkung des Schwulseins – nein, nicht des Schwulseins, aber der Konsequenzen des Schwulseins – das Ausgestoßensein aus der Gesellschaft, die Unmöglichkeit, der gesamtgesellschaftlichen Lebensprojektion von Familie und Kindern genügen zu können, die Verletzungen durch den Umgang der eigenen Herkunftsfamilie mit dem eigenen Schwulsein, usw., all diese Kränkungen wollen bearbeitet sein. Hier drängt sich AIDS nachgerade als eine Reaktivierung und Aktualisierung verdrängter Schuldkomplexe auf.
2.6. Herkunftsfamilie und Wahlfamilie
AIDS-Kranke können in der Regel – selbst, wenn sie wollten – nicht mehr zurück in ihre Herkunftsfamilien. Diese haben sie häufig früh verlassen, sind in urbane Ballungsräume gezogen, die ihnen mit der typischen urbanen Anonymität und Toleranz (oder auch Ignoranz) ein weitestgehend repressionsfreies Leben als Homosexuelle oder Drogengebraucher ermöglichen. Die Kontakte zur Herkunftsfamilie sind abgerissen oder aber deutlich reduziert. Aus unseren Erfahrungen in der ambulanten pflegerischen Versorgung und der Beratungsstellentätigkeit wissen wir, daß Eltern, Geschwister und andere familiale Angehörige häufig erst sehr spät oder aber gar nicht über die HIV-Infektion unterrichtet werden. Andererseits führt in vielen Fällen die Unterrichtung der Familie zu Überforderungsreaktionen, die sich so hochkomplex darstellen, daß häufig nur noch therapeutisch interveniert werden kann.
Im Gegensatz zu Krebskranken oder gar Mukoviszidose-Kranken fällt also bei AIDS die Herkunftsfamilie weitestgehend als unterstützendes und laien-pflegendes Element aus. Schwerstkrankenpflege und Sterbebegleitung können hier nicht sinnvoll – sprich ohne die Lebenswelten und Bedürfnisse der homosexuellen und drogengebrauchenden AIDS-Kranken auf schärfste zu mißachten – re-integriert werden.
Nach mittlerweile 12 Jahren AIDS-Pandemie ist zu konstatieren, daß sich die sozialen Familien, die sich Homosexuelle in den urbanen Ballungsräumen geschaffen haben, weit über die Grenze der Leistungsfähigkeit hinaus belastet sind. In den letzten Jahren hat die Bereitschaft im eigenen Freundeskreis ehrenamtlich den Freund zu Tode zu pflegen drastisch abgenommen. Dies drückt sich nicht nur in der Schwierigkeit aus, die AIDS-Hilfe-Organisationen haben, neue ehrenamtliche Helfer zu rekrutieren. Aus den Erfahrungen in der ambulante Pflege wissen wir nur zu genau, daß die Pflegekräfte häufig zum einzigen Bezugspunkt der AIDS-Kranken und Sterbenden werden, da der Freundeskreis – die soziale Familie – nach zwei, drei oder noch mehr Sterbebegleitungen und den damit verbunden Verlusten nicht mehr in der Lage dazu ist, einen weiteren Freund zu begleiten.
So fällt ein weiteres Konstitutivum des klassischen Hospizes – die unbedingte Einbindung von ehrenamtlichen HelferInnen weitgehend unter den Tisch – und muß dies aus oben geschilderten Gründen auch.
W. Bredemeyer und A. Weber [Bredemeyer, W. und Weber, A.: Verlusterfahrung pflegender Angehöriger von schwulen Männern mit AIDS, Diplom-Arbeit (vorgelegt an der FU Berlin zur Erlangung des Grades des Dipl.-Psych.), Berlin 1994, zitiert nach: Aktuell, Nr. 9, Februar 1995.] beschreiben: „Diese psychische Überlagerung, die in der Regel nicht aufgehoben werden kann, läßt eine vorausschauende, längerfristige Planung oder eine Kalkulation von Ressourcen nicht zu. Die Pflege gleicht eher einem Krisenmanagement mit einem oft relativ chaotischen, spontanen oder blinden Reagieren auf Notfallsituationen. Der Pflegeverlauf wird kaum in den Kategorien ‘Antizipation’, ‘Prävention’ oder ‘Prophylaxe’ reflektiert. Mit dem Voranschreiten der Krankheit und zunehmender Dauer der Pflege beginnt bei den Angehörigen ein Prozeß der Überlastung und Dekompensation." Weiter: „Angehörige, die die Pflege schwuler Männer übernehmen, kommen meistens nicht aus der Herkunftsfamilie, sondern gehören zur schwulen Wahlfamilie. … Die Pflege läßt sich aus der Sicht der Angehörigen als die Abfolge von einer Vielzahl ‘kleiner’ Verluste charakterisieren. Wie sich in den Interviews immer wieder zeigte, verlieren die Angehörigen den Patienten durch den Krankheitsverlauf sukzessiv. Von bestimmten Eigenschaften, die den Partner und die Beziehung kennzeichnen, muß er schon einige Zeit vor dem Tod Abschied nehmen. Die Alltagswelt des Erkrankten wird immer stärker von der Krankheit bestimmt und zieht den Angehörigen mit. So verliert er den Erkrankten oftmals als Sexualpartner und im weiteren Krankheitsverlauf auch als Gesprächspartner. … Gerade der Verlust des gleichgestellten Partners wird von den Angehörigen als besonderes schwerwiegend beschrieben. … Dieses geschilderte prozessuale Verlustgeschehen, seine gegenseitige Überlagerung, Verstärkung und sukzessive Kumulation führt bei den pflegenden Angehörigen zur psychischen Überforderung, in deren Folge psychische uns psychosomatische Störungen, Suchtprobleme oder präsuizidale Symptome festzustellen sind."
Die oben beschriebene Situation deckt sich mit der Erfahrung, die alle auf AIDS spezialisierten Schwerstpflegedienste der BRD, ebenso wie die AIDS-Hilfe-Organisationen gemacht haben, die Angehörigenarbeit durchführen.
Erfahrung ist ebenfalls, daß das notwendige Maß an Angehörigenarbeit keinesfalls von ehrenamtlichen Betreuungskräften geleistet werden kann. Dies mag im Zusammenhang mit Angehörigen Krebs-Erkrankter funktionieren, bei AIDS sind die Erfahrungen jedoch andere.
2.7. Der Mythos vom würdigen/selbstbestimmten Sterben
Nachdem jahrelang das Sterben unter der Perspektive der Unmenschlichkeit, des kalten, abgeschobenen isolierenden Verendens in den Badezimmern und Abstellkammern von anonymen Großkliniken kritisiert worden ist, scheint sich derzeit ein dazu gegenläufiges Leitbild auszuprägen. Sterben wird ideologisiert, mythologisiert, relativiert und eingeebnet. Das Sterben verliert seinen Schrecken, der Tod seinen Stachel. Sterben und Tod werden verharmlost und verniedlicht. Vor allem hat E. Kübler-Ross mit dazu beigetragen, diese Mythologisierung des Sterbens zu verbreiten. In einem 1984 erschienen Buch „Über den Tod und das Leben danach" finden sich in farbigen Lettern folgende Kernsätze auf der Umschlagseite des Buches:
„Ich glaube, es ist jetzt Zeit, daß die Leute wissen, daß der Tod gar nicht existiert, wenigstens nicht so, wie wir uns das vorstellen."
„Der Tod ist ganz einfach ein Heraustreten aus dem physischen Körper, und zwar in gleicher Weise, wie ein Schmetterling aus seinem Kokon heraustritt."
„Sterben ist nur ein Umziehen in ein schöneres Haus."
Das Sterben wird als eine ganz und gar außerordentliche Erfahrung geschildert, als das wirkliche und authentische Leben schlechthin. Das Leitbild des sanften und friedlichen Todes, des Hinübergleitens in die leuchtende Wirklichkeit, will dem Tod jede Zwiespältigkeit und Doppelgesichtigkeit nehmen, die er im Laufe einer langen Menschheitsgeschichte immer besessen hat.
Das Gesicht des Todes, wie es jahrhundertelang von unseren Vorfahren erlebt wurde als grausamer Sensenmann, als mehrschwänziges Ungeheuer, das in Seuchenzeiten die Straßen durchfegt, als knöchernes Gestell, das ganz in der Bewegung der Totentanztradition Kaiser und Bauer, Edelmann und Mädchen heimholt, wird ignoriert und tritt gänzlich in den Hintergrund gegenüber verklärenden und beschönigenden Bildern des Sterbens. Damit verbunden ist eine Relativierung des Todes. [Heller, A. (Hrsg.): Kultur des Sterbens – Bedingungen für ein Lebensende gestalten, Freiburg 1994, S. 27f.]
Sterben im AIDS-Bereich hat aber auch gar nichts von diesem Bild. Es ist grausam und entmenschlichend, bar jeder Würde. Der Sterbende löst sich nach und nach auf: Er verliert diejenigen seiner menschlichen Fähigkeiten, die ihn ausgemacht haben, seine Person konstituiert haben. Nur in der Anfangsphase der Erkrankung können noch Verluste von Fähigkeiten durch das Erlernen neuer, anderer Tätigkeiten ersetzt werden.
In Berlin sterben mittlerweile jedes Jahr etwa 0,5% der (rechnerischen) Gesamtpopulation der schwulen Männer (die etwa 5% der männlichen Bevölkerung ausmacht). Rechnet man diese Zahl auf die Gesamtbevölkerung der BRD um, so würden jedes Jahr etwa 410.000 Bundesbürger an AIDS versterben, das sind etwa 43% aller Todesfälle in der BRD. Das wäre die Gesamteinwohnerzahl der Städte Bonn und Koblenz plus zweier oder dreier kleiner Dörfer zusammen. (Die Zahlen beziehen sich auf den Stand zum 31.12.1993 und stammen vom Statistischen Bundesamt, vom Statistischen Landesamt Berlin bzw. vom AIDS-Zentrum des Robert-Koch-Institutes.)
Ich glaube, an dieser Zahlenspielerei wird deutlich, was für Dimensionen AIDS für die Hauptbetroffenengruppen hat. Es handelt sich mehr als bloß um eine Infektionskrankheit. Es ist eine – für Nicht-Betroffene – schwer nachvollziehbare kollektive Traumatisierung, die ich mittlerweile nur noch organisiertes Massensterben nennen kann, und die nichts – aber auch gar nichts – mit dem von E. Kübler-Ross gezeichneten Bildern und Mythen von Tod und Sterben zu tun hat.
2.8. Bilanz-Suizid im AIDS-Bereich
Aus der empirischen Suizidforschung wissen wir, daß die Suizidrate bei HIV- Infizierten und AIDS-Kranken um etwa 30% über der ihrer vergleichbaren Altersgruppe liegt. Hier unterscheidet sich AIDS wesentlich von allen anderen lebensbeendenden Erkrankungen. So liegt die Suizidrate bei Krebspatienten (je nach Geschlechter) nur etwa 2 – 5% über der ihrer vergleichbaren Altersgruppe.
So hat ein großer Anteil der AIDS-Patienten eine Sammlung von Medikamenten angelegt, die einen Suizid ermöglichen würde. Diese Sammlung liegt im Regal und wird in gewisser Weise als Notausgang betrachtet, der für den Fall benutzt werden kann, daß die Krankheit völlig unerträglich wird. Diese Medikamentensammlung wird nur in den wenigsten Fällen wirklich auch benutzt. Sie hat eine wichtige psychische Ventilfunktion, die es überhaupt erst ermöglicht, das Leiden der Krankheit zu ertragen, denn man weiß, daß, wenn man es nicht mehr ertragen kann oder will, man auch gehen kann.
Hierbei spielen Faktoren, wie ein mehr oder weniger intaktes oder vorhandenes soziales Umfeld, Qualität der Beziehungen zu anderen Menschen oder Qualität der Betreuung eine nur untergeordnete Rolle. Hauptursächlich bei der Entscheidung über die Durchführung eines Suizides ist das, was Lebensqualität genannt wird.
Die meisten Patienten haben für sich eine ausgesprochen konkrete Vorstellung über den Punkt, an dem sie von sich selber sagen, daß sie keine Lebensqualität mehr haben. So ist z.B. für viele Patienten die Erblindung durch eine nicht mehr behandelbare CMV-Retinitis ein Punkt, an dem sie im vorhinein sagen, daß, wenn er erreicht sei, sie sich suizidieren würden. Es gibt andere Punkte. Sie sind individuell ausgesprochen verschieden und entziehen sich auch der emotionalen Nachvollziehbarkeit durch den Betrachter – müssen sie auch, denn wie soll ich emotional das nachvollziehen können, was ein anderer Mensch für sich selbst als Lebensqualität definiert. Es handelt sich hier – zum überwiegenden Teil – um klassische Bilanz-Suizide. [Ich habe mich hier auf Suizide von schwerkranken AIDS-Patienten bezogen. Dies gilt nicht für den gesamten AIDS-Bereich. So kann und will ich nicht verschweigen, daß die erste (statistische) „Suizidwelle" mit dem positiven Testergebnis kommt. Diese Suizide sind durch behandlungsbedürftige und behandelbare Depressionen geprägt und sollten verhindert werden.]
Für eigentlich alle Patienten gilt, daß sie im Laufe ihrer Auseinandersetzung mit ihrer Erkrankung sich mit dem Thema Suizid auseinandersetzen. Sie reagieren ausgesprochen sensibel auf den Umgang mit diesem Thema und öffnen sich nur, wenn sie das Gefühl haben, in einem nicht-normativen Kontext reden zu können. Aus der Suizidprophylaxe wissen wir, welch immense Bedeutung der Artikulation von Suizidphantasien zukommt.
In diesem Sinne kann hier Suizidprophylaxe nur erfolgen, wenn die Betreuungskräfte in der Lage sind, eine nicht-normative, offene Beziehung zu dem Betreuten aufzubauen. Dies gilt gleichermaßen für alle am Prozeß Beteiligten – Ärzte wie Lebenspartner, Krankenpflegekräfte wie ehrenamtliche Betreuer.
3. Fazit
Wie unschwer nachvollziehbar ist, ist das psychodynamische, soziale und medizinische Geschehen bei AIDS hochkomplex.
Die jahrhundertelange Erfahrung lehrt, daß weder die Gesellschaft, noch viel weniger die Kirchen und Glaubensgemeinschaften, mit den Lebensstilen Homosexualität und Drogengebrauch angemessen umgehen können. (Die hervorragende Arbeit, die nicht wenige Mitarbeiter von kirchlichen Institutionen im AIDS-Bereich leisten, ändert die Institution jedoch nicht.)
Ideologien – besonders, wenn sie mit missionarischem Eifer und dem Anspruch auf alleinige Wahrheit gepredigt werden, sind in jedem Bereich zwischenmenschlichen Umgangs unerträglich. Viel mehr jedoch, wenn dadurch individuelles Leben und Sterben verunmöglicht wird.
Die gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen sind wesentlich an den Bedingungen zur Gestaltung eines Lebensendes beteiligt. Viel mehr, als die Person eines Begleiters, denn die Institution (die AIDS-Hilfe, der Hausbetreuungsdienst, der Hospizbetreiber, die Caritas etc.) setzt den Rahmen – die Grenzen – des Möglichen, stellt bestimmtes Personal ein, sorgt für bestimmte Aus- und Weiterbildungen und ist somit schlußendlich verantwortlich dafür, was in der Beziehung zwischen Sterbenden und Sterbebegleiter geschieht. Die Gesellschaft setzt den Rahmen in Form von Bildern und Mythen über Tod und Sterben, die den gesellschaftlichen, wie den individuellen Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden bestimmen ebenso, wie über die Schaffung und Finanzierung von Institutionen.
Organisationen, die mit Sterbenden arbeiten, benötigen eine Organisationskultur des Todes, [Diese Liste läßt sich fortführen, sie ist keinesfalls vollständig. Ich habe sie nur hineingenommen, um den Begriff „Organisationskultur des Todes" klarer zu machen. Es ist im Grunde nichts anderes, als eine Organisationsstruktur und - kultur, die auf die spezifischen Anforderungen der Arbeit mit Schwerstkranken und Sterbenden maßgeschneidert ist.] heißt:
- ein klar vereinbartes Leit- und Menschenbild, daß sowohl nach Innen und nach Außen deutlich kommuniziert wird, denn nur so können sich Patienten aber auch Mitarbeiter entscheiden, ob es die für sie und ihre Bedürfnisse passende Organisation ist;
- gemeinsam vereinbartes Dienstleistungsspektrum, das ebenfalls nach Innen und Außen kommuniziert werden muß, nur so können Sie sich vor Unerfüllbarem schützen;
- gemeinsam erarbeitete Qualitätsstandards, die regelmäßig überprüft werden müssen;
- Raum und Zeit innerhalb der Organisation zur Bearbeitung der Bilder von Tod und Sterben der Mitarbeiter und der Patienten;
- ausformulierte Rechte und Pflichten der Mitarbeiter;
- Raum und Zeit innerhalb der Organisation, um die Pflege von Mitarbeitern bewerkstelligen zu können, denn auch pflegende Hände brauchen Pflege.
Jeder kann AIDS-Patienten pflegen und begleiten, wenn Spielregeln eingehalten werden. Diese gilt es mit dem einzelnen Patienten, seinen Ärzten, Betreuern, Freunden, Angehörigen, den beteiligten Institutionen und Mitarbeitern zu vereinbaren – wie im übrigen bei jedem Nicht-AIDS-Patienten auch. Haben Sie – oder Ihre Institution – Probleme mit Homosexualität und Drogenkonsum oder glauben Sie unbedingt missionieren zu müssen, lassen Sie besser die Finger von AIDS. Sie tun niemandem einen Gefallen damit. Sich selbst nicht und – vor allem – den Patienten nicht.
Nehmen Sie Abschied von Ihren Omipotenzphantasien und Ihrer Opferrolle. Ihre Institution bestimmt maßgeblich mit, was in der Beziehung zwischen Ihnen und dem Begleiteten geschieht – ohne daß Sie jedoch das „Opfer der Umstände" werden. Sie haben einen Einfluß auf Ihre Organisation – sie kann lernen.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | März 1999