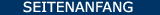![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)

TEILDOKUMENT:
[Seite der Druckausg.: 43 ]
Jörg Ueltzhöffe
Bürgerschaftliches Engagement und Gemeinsinn
Anmerkungen zur Theorie und Praxis der nachmodernen Bürgergesellschaft
Hinsichtlich der Diagnose des gegenwärtigen Zustands und der Entwicklungsrichtung westlicher Gesellschaften hat die transatlantische Kommunitarismusdebatte eine Fülle wichtiger Einsichten geliefert.
Anlaß, über die innere Verfassung der westlichen (inzwischen wohl auch der östlichen) Demokratien nachzudenken, haben wir in der Tat genug. Das Zusammentreffen der gegenwärtigen Verwerfungen und Spannungen im inneren Gefüge der EU-Länder mit dem Ende des Kalten Krieges halte ich dabei für eher zufällig. Die heutigen Schwierigkeiten sind im wesentlichen das Ergebnis langfristiger Prozesse des gesellschaftlichen Werte- und Strukturwandels. Dies gilt auch für Deutschland, wo man gerne dazu neigt, die Einheit für alle gegenwärtigen Probleme in gesamtschuldnerische Haftung zu nehmen.
So kann es kaum überraschen, daß die Indikatoren zum Zustand von Gesellschaft und Politik in den Kernländern der Europäischen Union und darüber hinaus auf ähnliche Problemlagen verweisen:
- Wachsende Entfremdung zwischen Bürgern, Parteien und politischen Institutionen (Deutschland hat dem internationalen Sprachgebrauch dafür den Begriff „Verdrossenheit" hinzugefügt).
- Abschwächung der tradierten sozialen Bindungskräfte und damit verbunden eine offensichtlich tiefgreifende Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts, und
- Unmöglichkeit, die dadurch bewirkten und täglich neu entstehenden Problemlagen durch staatliche Maßnahmen - im Sozialsektor, in der
[Seite der Druckausg.: 44 ]
Kommunalpolitik, im Bereich der inneren Sicherheit usw.- zu substituieren.
Für Deutschland (West) belegen beispielsweise bevölkerungsrepräsentative Zeitreihenmessungen der „Forschungsgruppe Wahlen" seit Mitte der achtziger Jahre einen kontinuierlichen Vertrauensverlust der Bürger in die wichtigsten öffentlichen Institutionen, die Verfassungsorgane nicht ausgenommen. Auf einer von -5 bis +5 reichenden Vertrauensskala erreichte der Bundestag 1984 bei den Wahlberechtigten einen Durchschnittswert von 2.0, 1995 lediglich noch 1.1. Die Bundesregierung sank im gleichen Zeitraum von 1.6 auf 0.8. Gewerkschaften, Kirchen, Fernsehen, Bundeswehr und Polizei ging es nicht wesentlich besser. Selbst das Bundesverfassungsgericht verlor im Zehnjahreszeitraum deutlich an Ansehen, 1984 lag sein „Vertrauenswert" bei 2.8, 1995 nur noch bei 2.1. (Für Ostdeutschland zeigen sich, zusammengedrängt auf einen Fünfjahreszeitraum, übrigens ähnliche Effekte).
Parallel zu diesem offensichtlich säkularen Prozeß des Vertrauensverlustes in das politische System des Landes sank auch die Bereitschaft der Bürger, bei Wahlen ihre Stimme abzugeben. Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 02. Dezember 1990 sackte die Wahlbeteiligung in den alten Bundesländern gegenüber 1983 um mehr als 10 Prozent ab. (Ein Trend, der 1994 nur unwesentlich korrigiert wurde). Rund 70 Prozent der Nichtwähler, die wir damals in einem repräsentativen Survey befragten, stimmten dem Statement zu: „An Wahlen teilzunehmen macht für mich immer weniger Sinn", ebensoviele dem Statement: „Es bringt mir persönlich nichts, wählen zu gehen". Auf Beobachter der Szenerie in anderen europäischen Ländern wie auch in den Vereinigten Staaten wirken diese Befunde zweifellos vertraut. Sie sind keine deutsche Besonderheit.
Auch die Bereitschaft, sich sozial zu engagieren, also für andere oder für das Gemeinwesen insgesamt, nimmt - so scheint es - dramatisch ab, ganz besonders unter der jungen Generation. Auf der Grundlage einer vor wenigen Monaten veröffentlichten empirischen Längsschnittanalyse konstatierte der Hamburger Soziologe Horst W. Opaschowski eine wachsende „soziale Unlust" - wie er es nennt - der Jugend in Deutschland der neun-
[Seite der Druckausg.: 45 ]

ziger Jahre. „Mit der wachsenden Kommerzialisierung der Freizeit", so schlußfolgert er, „nimmt auch die Entsolidarisierung im Alltag zu. Freizeit wird zur Egozeit, in der Ich alles tun ‘kann’, aber nichts tun ‘muß’. Damit sinkt auch die Bereitschaft, anderen zu helfen."
Robert Putnam hat für Amerika einen unmittelbaren Zusammenhang diagnostiziert zwischen der Krise seines politischen Systems, wie sie beispielsweise im Rückgang bürgerschaftlichen Engagements („civic engagement") zum Ausdruck kommt, und der Schwächung seiner traditionellen sozialen Netzwerke, deren negative Folgewirkungen auf alle Bereiche des sozialen Zusammenlebens der Menschen - von den familiären Beziehungen über die Vereinsamung älterer Menschen bis hin zur Drogenkriminalität - die Kommunitarier beschrieben und beklagt haben.
Unbeschadet andersartiger historischer Ausgangsbedingungen und politischer Strukturmerkmale trifft Putnams Analyse zweifellos auch auf die Entwicklung in Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern
[Seite der Druckausg.: 46 ]
zu. Die partizipatorische Krise vollzieht sich auf dem Hintergrund von Gesellschaften, deren innerer Zusammenhalt von einer eigentümlichen soziokulturellen Segregationsdynamik aufgezehrt zu werden droht.
Entscheidend für die skizzierte Problemlage ist nun weniger die Vielfalt unterschiedlicher Lebensweisen und Lebensstile an sich. Die Freiheitsgrade der Selbstbestimmung, die sie dem Individuum bringen, sind ein Vorzug demokratisch verfaßter Gesellschaften, um die uns die meisten jener beneiden, denen sie nicht zur Verfügung steht. Entscheidend ist vielmehr die wachsende Beziehungslosigkeit der Individuen und Gruppen untereinander, d.h. das Auseinanderdriften der Lebens- und Wertewelten, die zunehmende kommunikative Abschottung von Individuen, Gruppen und sozialen Milieus gegeneinander, verbunden mit einer Radikalisierung individueller wie auch milieu- bzw. gruppenspezifischer Einstellungs- und Verhaltensmuster.
Gemeinsinn und bürgerschaftliches Engagement können unter derartigen gesellschaftlichen Bedingungen, so scheint es, jedenfalls nicht mehr so recht gedeihen. Daniel Yankelovich spricht in diesem Zusammenhang - nicht nur mit Blick auf Amerika - von der Dominanz einer Ethik des „unaufgeklärten Eigeninteresses". Es besteht, so seine Definition, „in der Verfolgung selbstsüchtiger Ziele, die außer den eigenen keine anderen Interessen nützen". Seine Wurzeln vermutet er in den heute praktizierten Formen des expressiven Individualismus, die statt der altruistischen die egoistischen und narzistischen Aspekte des Selbst betonen.
Robert Bellahs u.a. Charakterisierung der amerikanischen Gegenwartsgesellschaft als einer „culture of separation" wie auch Daniel Yankelovichs Deutung ihrer psychischen Innenausstattung treffen zweifellos auch auf die Verhältnisse in Europa zu. Die großen westeuropäischen Nationen erscheinen heute in vielerlei Hinsicht als hochfragmentierte „Patchwork"-Gesellschaften, deren soziale Milieus und Gruppen hinsichtlich Wertorientierung und Interessenlagen zusehends auseinanderstreben. Dies korreliert einerseits mit einer wachsenden Schwächung der sozialen Bindungskräfte zwischen Individuen und gesellschaftlichen Gruppen untereinander und führt andererseits zu immer umfassenderen Erwartungshaltungen gegenüber staatlicher Politik, deren Regelungs-
[Seite der Druckausg.: 47 ]
fähigkeit und Finanzierbarkeit in umgekehrtem Verhältnis zur Heterogenität der an sie herangetragenen Ansprüche steht. Zum einen versteht sich der Einzelne in einem Klima der sozialen Entpflichtung immer weniger als seines Bruders oder seiner Schwester Hüter, zum anderen haften in seinen Augen Staat und Kommunen für alle entstandenen sozialen und politischen Defizite. Selbst der hochentwickelte kontinentaleuropäische Wohlfahrtsstaat kann nicht mehr mithalten, wie die jüngsten sozialpolitischen Konflikte in Frankreich, Schweden, in den Niederlanden, aber auch in Deutschland nachdrücklich belegen.
Wenn somit die Diagnosen der amerikanischen Kommunitarismusdebatte richtig sind (und vieles spricht dafür) und unsere Einschätzung der europäischen Entwicklung einigermaßen zutrifft, dann stehen Amerikaner und Europäer vor recht ähnlichen gesellschaftlichen Problemlagen. Die Krise der westlichen Demokratien erscheint nicht allein als eine der Parteien- und Institutionssysteme sondern auch als eine der Bürger selbst.
Rätselhaft bleibt dann allerdings die Tatsache, daß es mit ebenso großer theoretischer Plausibilität gelingt, empirisch das Gegenteil zu beweisen, nämlich gut funktionierende Strukturen der Gemeinschaftlichkeit und eine wachsende Bereitschaft der Menschen, sich freiwillig in vielfältigen sozialen Aufgabenbereichen zu engagieren. Bezogen auf die Vereinigten Staaten hat Seymour Lipset dafür zahlreiche empirische Befunde vorgelegt. Auch für Europa gibt es Daten aus jüngster Zeit, die die Annahme eines allumfassenden Prozesses des Gemeinschaftsverlusts zu widerlegen scheinen. Dazu gehören zweifellos die Studien von Olot und Geislingen, aber auch die Eurovol-Studie.
Sie kam zu dem Ergebnis, daß bei einer Gesamtbevölkerung von nahezu 200 Millionen Menschen in diesen neun Ländern sich rund 40 Millionen Europäer ab dem 15. Lebensjahr freiwillig engagieren. Weitere 25 Millionen würden sich möglicherweise engagieren, wenn sie gefragt würden. Nur eine Minderheit zeigte sich dem Anliegen des volunteerings gegenüber völlig desinteressiert. Fast zwei Drittel aller in den neun Ländern befragten Europäer stimmten darüber hinaus der Ansicht zu, daß freiwilliges Bürgerengagement den Bürgern zu „einer aktiven Rolle in einer demokratisch verfaßten Gesellschaft" verhilft.
[Seite der Druckausg.: 48 ]
Bemerkenswert erscheint mir in diesem Zusammenhang, daß zwei Länder mit so unterschiedlichen Wohlfahrtstraditionen wie Großbritannien und Schweden ähnlich hohe Prozentsätze des freiwilligen Bürgerengagements aufweisen. Sie liegen beide in der Spitzengruppe der untersuchten Länder.
Jedenfalls gibt es keinen empirischen Nachweis für die Annahme, daß Wohlfahrtssysteme des skandinavischen Typs die Engagementbereitschaft ihrer Bürger hemmten. Im Gegenteil, die schwedische Tradition der wechselseitigen Ergänzung von staatlichen Maßnahmen und freiwilliger Bürgerleistung scheint die gegenwärtige Umsteuerung des welfare mix zugunsten letzterer eher zu begünstigen. So zumindest der Eindruck der beiden britischen Autoren.
Noch ist allerdings unklar, auf welchen ethischen Grundlagen sich dieser Wandel vollziehen wird. Die Möglichkeit einer bloßen Rekonstruktion der alten, pflichtethisch begründeten demokratischen Bürgertugenden, wie verschiedentlich gefordert, erscheint im Licht der empirischen Befunde wenig wahrscheinlich. Zu unterschiedlich sind persönliche Lebenslagen, Wertorientierungen, Lebensweisen und Überzeugungen der Menschen. Lediglich 14 Prozent der Bürger in Geislingen wollen sich bürgerschaftlich engagieren, weil dies „Bürgerpflicht" sei. In Olot: höher, aber Erosion bei Jugendlichen.
Die - wie auch immer begründete - moralische Pflicht zu Gemeinschaftlichkeit und Solidarität stiftet in postmodernen Gesellschaften offensichtlich kein einigendes Band mehr, weder zwischen den Bürgern selbst noch zwischen Bürgern und Staat. Gemeinsinn in der zukünftigen civil society wird sich, zumindest aus europäischer Sicht, wahrscheinlich weniger als abstrakte Tugend konstituieren, der man folgt oder auch nicht, sondern als Ergebnis empathisch aufeinander bezogener Verstehens- und Verständigungsprozesse sehr unterschiedlicher Individuen und bürgerschaftlicher Gruppen untereinander. Eine Einsicht, die, soweit ich sehe, den Thesen Benjamin Barbers, Amitai Etzionis und anderer amerikanischer Autoren nicht widerspricht. Der Frankfurter Soziologe Helmut Dubiel vermutet hinter funktionsfähigen Konsensformen in hochdifferen-
[Seite der Druckausg.: 49 ]
zierten Gesellschaften gar „einzig das historische Kapital ertragener Verschiedenheit".
Altruistisch motivierte Bürgertugend, zu dieser Schlußfolgerung kommt auch Robert Dahl in einem Aufsatz zu den Entwicklungsbedingungen bürgerschaftlicher Kompetenz, wird ohne Empathie für Lebensverhältnisse und Lebensformen des Nächsten nur wenig ausrichten können. Nur die durch derartige bürgerschafltiche Verständigungsprozesse, durch gemeinsame Beratung und überstandene Konflikte herstellbare Verbundenheit der Menschen untereinander wird letztendlich zur Verantwortung füreinander führen, also zu einer Form von Gemeinsamkeit, in der das „Ich" und das „Wir" keine unüberbrückbaren Gegensätze bilden. Ich glaube weniger an eine Umkehrung der die Moderne prägenden Individualisierungsprozesse, auch wenn man dies für wünschenswert hält, als an deren Einschmelzung in eine kommunitäre Verantwortungsethik. Möglicherweise ist dies der inhaltliche Kern der Metamorphose zur civil society.
Soweit wir sehen, lassen sich im Licht der gegenwärtig zur Verfügung stehenden Befunde die folgenden Prinzipien formulieren und empirisch belegen, die für nachmoderne demokratische Bürgergesellschaften konstitutiv sind, bzw. sein sollen:
1. Soziale Selbstorganisation
Die Geislingen-Studie konnte aufzeigen, daß für einen erheblichen Teil der Menschen die traditionellen selbstorganisierten sozialen Bindungsformen auf Gemeindeebene, wie zum Beispiel Nachbarschaftshilfe und das Vereinsleben, aus ihrer subjektiven Sicht heraus noch zufriedenstellend funktionieren. (Insofern erscheinen Korrekturen an der Vermutung eines alle sozialen Lebensformen durchdringenden Gemeinschaftsverlusts geboten).
Dies gilt auch für die in Olot durchgeführte Studie.
Allerdings zeigten sich in den überkommenen sozialen Netzwerken auch
[Seite der Druckausg.: 50 ]
massive Risse. Von den unter 40jährigen berichtete beispielsweise nur rund jeder Vierte über funktionierende Nachbarschaftsbeziehungen in seiner Gegend. Fehlende gutnachbarliche Beziehungen werden bei den Jüngeren offensichtlich durch andere, offenere Netzwerke ersetzt. Freundes- und Bekanntenkreis bilden - je nach persönlichen Neigungen und Lebensstil - gleichsam „virtuelle Dörfer", die die verlorengegangene Geborgenheit der örtlichen Nachbarschaft in neue, postmoderne Bindungsstrukturen von höherer Flexibilität umformen. Viele Ältere bleiben dagegen, wie sich zeigte, aus den tradierten wie auch aus den neuen Netzwerken ausgeschlossen. Sie sind auf neue bürgerschaftliche Gruppen und Initiativen angewiesen.
Um eine demokratische und freiheitsgarantierende Bürgergesellschaft zur Entfaltung zu bringen, bedarf es somit über die traditionellen Netzwerkstrukturen (soweit sie noch funktionieren) hinaus einer Vielfalt kleiner Vereinigungen, Initiativen und Gruppen, die die pluralen Identitäten der Menschen zur Geltung bringt und die Unterschiedlichkeit ihrer Lebenswelten und Lebensweisen widerspiegelt - und damit gleichsam die lebensweltliche Repräsentativität der Gesellschaft auf der Ebene der Vereinigung herstellt. Der Bestand der Bürgergesellschaft wird dabei nicht so sehr durch die Stabiltität des Gefüges aus Vereinigungen, Gruppen und Initiativen garantiert als vielmehr durch dessen selbstgesteuerte Veränderung.
2. Gemeinschaftssinn
Das Prinzip sozialer Selbstorganisation garantiert nun aber, wie beispielsweise Walzer überzeugend dargelegt hat, nicht nur die bürgerlichen Freiheiten, die wir alle schätzen, sondern sorgt auch durch das ihm immanente (im besten Sinne liberale) Recht, Zugehörigkeiten aufzukündigen, sich eben nicht (oder nicht mehr) zu binden, für eine „stetige Schwächung all der primären Bindungen, die soziale Zusammenschlüsse erst möglich machen". So formuliert er über die Voraussetzung der Vielfalt, und wir fügen an: der lebensweltlichen Repräsentativität des Gefüges freier Vereinigungen hinaus drei weitere, für Bürgergesellschaften konstitutive Bedingungen:
[Seite der Druckausg.: 51 ]
1. die Verbundenheit von Individuen und Gruppen untereinander,
2. die Bereitschaft, Verantwortung füreinander zu tragen und
3. staatliche Institutionen und Gesetze, die diese beiden Bedingungen fördern, d.h. eine Politik, die sich gegenüber Gemeinschaftsbildung und -zerstörung nicht neutral, sondern parteilich verhält - im Sinne des ersteren.
Wie läßt sich nun aber demokratischer Bürger- bzw. Gemeinsinn herstellen, oder - um mit Etzioni zu sprechen - wie schafft man die von allen Kommunitariern beschworene Hinwendung des Einzelnen vom „Ich" zum „Wir", also zu neuen wie auch tradierten Formen der Gemeinschaftlichkeit ?
Gemeinsinn in der Bürgergesellschaft konstituiert sich, so meine Schlußfolgerung, immer weniger als abstrakte Tugend, der man folgt oder auch nicht, sondern immer mehr als Ergebnis empathisch aufeinander bezogener Verstehens- und Verständigungsprozesse der Bürger und bürgerschaftlichen Gruppen untereinander, die - idealiter - schließlich in unterschiedliche Formen gemeinschaftlichen Handelns münden. Gegenseitige Achtung und Toleranz der Vielfalt sind somit definitorische Elemente eines postmodernen Verständnisses von Gemeinsinn. Dies muß allerdings moralisch auch gewollt und akzeptiert sein. Insofern setzt auch dieses Verständnis von Gemeinsinn einen - allerdings jederzeit intersubjektiv begründungspflichtigen - Wertekonsens voraus.
Die Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit der modernen Gesellschaft, argumentiert der renommierte amerikanische Demokratietheoretiker Robert A. Dahl, verlange vom einzelnen „empathisches Verständnis für die anonymen Anderen, die ja den Hauptteil seiner Mitbürger bilden". Altruistisch motivierte Bürgertugend könne, so Dahl, ohne Empathie für Lebensverhältnisse und Lebensformen des Nächsten in modernen demokratischen Systemen nur wenig ausrichten.
[Seite der Druckausg.: 52 ]
3. Bürgerschaftliches Engagement
Folgt man dieser Definition von Gemeinsinn, dann ist empirischer Nachweis und Gradmesser für dessen Vorhandensein letztlich die Handlungsbereitschaft der Bürger, miteinander und füreinander. Die definitorisch verfügte Trennung von öffentlicher Angelegenheit („res publica") und sozialem Miteinander der Bürger wird im Vollzug bürgerschaftlichen Handelns gleichsam aufgehoben.
Bürgerschaftliches Engagement ist somit ein konstitutives Prinzip der Bürgergesellschaft, vielleicht ihr wichtigstes. Seine Handlungsfelder, Handlungsziele und -notwendigkeiten werden wiederum nicht verordnet (vom Staat, von den Parteien usw.) sondern vereinbart, zwischen den Bürgern selbst, zwischen staatlichen Institutionen und Bürgern, zwischen Kommunalverwaltungen und Bürgern usw.. Anders kann es wohl auch gar nicht zustandekommen oder wäre zur Wirkungslosigkeit verdammt.
Wenn nun aber Gemeinsinn sich nicht - oder nur noch zu einem geringen Teil - durch pflichtethische Motive begründen und herstellen läßt, welche motivationalen Antriebskräfte können Menschen dann unter den Bedingungen einer sozial und lebensstilistisch hochfragmentierten Gesellschaft zum Engagement in ihrer Gemeinde bringen ? Müssen zunächst neue sozialmoralische Verbindlichkeiten kodifiziert werden, denen die Bürger zu folgen haben ? Und falls ja, welche gesellschaftlichen, politischen oder religiösen Instanzen haben die Autorität, sie festzulegen ? Oder erscheint es nicht sinnvoller, die in unterschiedlichen Formen und Intensitätsgraden möglicherweise bereits vorhandenen, aber bisher vielfach ungenutzt gebliebenen sozialen Bindungsenergien zu mobilisieren ?
Letzteres setzt voraus, die Motive kennenzulernen, die bürgerschaftliches Engagement bewirken und fördern, bei Männern und Frauen, Jugendlichen und alten Menschen, bei deutschen und ausländischen Mitbürgern, bei Angehörigen und Vertretern unterschiedlicher Berufsgruppen, Konfessionen, Wertorientierungen und Lebensstile, kurz: bei allen, die es für bürgerschaftliches Engagement zu gewinnen gilt.
Die Geislingen-Studie hat versucht, dies auf empirischen Wege zu leisten
[Seite der Druckausg.: 53 ]
und konnte aus der Vielfalt der vorfindbaren Motive vier - inhaltlich tatsächlich recht unterschiedliche - Motivkreise identifizieren, die heute bürgerschaftliches Engagement begründen können:
- * Helfen
- * Gestaltungswille
- * Ich-Bezug
- * Pflichtbewußtsein
Während für die einen die Freude am Helfen der entschiedene Auslöser für bürgerschaftliches Engagement ist, lassen sich andere wiederum eher durch die Aussicht motivieren, eigene Fähigkeiten einbringen oder persönliche Probleme in Gemeinschaft mit anderen besser lösen zu können. In ihrem alltäglichen Vollzug greifen diese vier Motivkreise ohnehin ineinander und produzieren somit auf der Ebene des Individuums sehr unterschiedliche subjektive Motivationsmuster und Erwartungen. Nichts spricht dagegen, daß sie ebenso zur Herstellung von Gemeinschaftlichkeit und Gemeinsinn beitragen können wie der bürgerliche Pflichtethos von einst. Was dies für die theoretischen Voraussetzungen und Konsequenzen der Kommunitarismusdebatte bedeutet, sollte in Zukunft intensiver als bisher erörtert werden.
Bürgerschaftliches Engagement ist, wie empirisch belegbar, hinsichtlich seiner Beweggründe und Motivlagen offener und damit auch gestaltbarer als vielfach angenommen. Subjektiv voraussetzungslos ist es dennoch nicht. Es ist auf spezifische Fähigkeiten, Leistungen und Ressourcen der Bürger angewiesen.
4. Bürgerschaftliche Kompetenz
Ein „guter Bürger" zeigt außerordentliches Interesse für Politik und öffentliche Angelegenheiten, ist politisch gewöhnlich gut informiert (was Parteien, Kandidaten und politische Sachfragen anbelangt), diskutiert derlei Themen mit seinen Mitbürgern, beteiligt sich regelmäßig an den Wahlen und erhebt seine Stimme zu Fragen von öffentlicher Bedeutung,
[Seite der Druckausg.: 54 ]
z.B. in politischen Versammlungen. Ihn treibt die Sorge um das Gemeinwohl und der Wunsch, es nach Kräften zu mehren. So zitiert Dahl das in jedem staatsbürgerkundlichen Unterricht vermittelte Idealbild eines demokratischen Bürgers. Kein Wunder, daß ihm nur wenige gerecht werden.
Es fällt zudem auf, daß die Qualitäten dieses Bürgers sich fast ausschließlich gegenüber jenem entfalten, was man als „politisches System" bezeichnet (Parteien, Wahlen, politische Versammlungen usw.), kaum jedoch gegenüber den eigenen Mitbürgern (sieht man einmal von der gemeinsamen Diskussion politischer Themen ab). Die Fähigkeit und Bereitschaft zum sozialen Miteinander, zur Gemeinschaftlichkeit, gehört in repräsentativen Demokratien nicht zur Definition des „Homo politicus". Staatsbürgerliche Kompetenz, wie sie in mustergültiger Weise der von Dahl beschrieben Typus verkörpert, und bürgerschaftliche Kompetenz sind offensichtlich nicht ein und dasselbe. Dies bedeutet nicht, daß der Bürger in der Bürgergesellschaft nicht auch Staatsbürger ist und so handelt bzw. handeln soll. Der Begriff der bürgerschaftlichen Kompetenz ist jedoch wesentlich weiter gefaßt - man könnte auch sagen: flexibler - als seine staatsbürgerliche Komponente. Er integriert dessen Bedeutungsgehalte, ohne sie idealisierend zu isolieren.
Bürgerschaftliche Kompetenz bezieht sich auf alle Eigenschaften, Fähigkeiten und Ressourcen der Bürger, die bürgerschaftliches Engagement ermöglichen, beschränkt sich also nicht auf die Fähigkeit zum politischen Diskurs. Gemeint ist das gesamten Universum an Begabungen, Wissen, Erfahrungen und Fertigkeiten, die Bürger - neben Zeit und Geld - in bürgerschaftliche Projekte einbringen können. Voraussetzung ist aber immer die Fähigkeit und Bereitschaft mit anderen zu reden, zusammenzuarbeiten, sich in ihre Probleme und Lebenslagen hineinzuversetzen, den Ausgleich zu suchen.
Zunächst kommt es aber darauf an - auch dies gehört zum Begriff der bürgerschaftlichen Kompetenz -, daß man davon überzeugt ist, überhaupt etwas zur Gestaltung des Gemeinwesens, des sozialen Miteinanders beitragen zu können, sich also nicht von vornherein selbst aus der Möglichkeit zu bürgerschaftlichem Engagement ausschließt. „Schwellen-
[Seite der Druckausg.: 55 ]
angst" (Tenor: „Ich wüßte nicht, was ich beizusteuern hätte") stellte sich bei der Geislingen-Umfrage für einen gewichtigen Teil der Bevölkerung als subjektiv bedeutsame Barriere heraus. Die gilt insbesondere für Frauen, Jugendlich, Ältere und Menschen mit unteren formalen Bildungsabschlüssen. Eine Theorie der Bürgergesellschaft, die sich diesem offensichtlichen Webfehler der modernen Repräsentativdemokratie nicht stellt, bliebe immer angreifbar.
Honneth, der sich um den Entwurf einer Ethik posttraditionaler Gemeinschaften bemüht, sieht deren normative Besonderheit gerade darin, „daß jedes Subjekt ohne kollektive Abstufung die Chance erhält, sich in seinen eigenen Leistungen und Fähigkeiten als wertvoll für die Gesellschaft zu erfahren". Er hat damit aus unserer Sicht ein wichtiges Merkmal der nachmodernen Bürgergesellschaft herausgearbeitet, zumindest wie wir sie verstehen.
5. Dialogkultur
Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit, Empathie, sich in andere hineindenken und hineinversetzen, welchselseitiges Verständnis und Verstehen, die Bereitschaft, zuzuhören, die gemeinsame Beratung, der Austausch von Argumenten gehören somit zum Definiens der Bürgergesellschaft. Es handelt sich um Merkmale eines sozialen und politischen Klimas, das wir Dialogkultur nennen wollen. Diese beschränkt sich allerdings nicht auf das Verhältnis der Bürger untereinander, sondern markiert auch die Formen der Kommunikation und der Entscheidungsfindung zwischen Bürgern und staatlichen wie auch kommunalen Institutionen.
Jene 38 % aller Geislinger Bürger, die sich für neue Formen bürgerschaftlichen Engagements interessieren, erwarten weit eher koopera-tions-, konsens- und beratungsorientierte Anstrengungen der politischen Institutionen als klassische policy-output-Leistungen. Jedenfalls setzen sie die Forderungen nach hauptamtlichem Personal, das in engem Kontakt mit den aktiven Bürgern arbeitet, wie auch nach Schulungsangeboten für die Engagementbereiten an die Spitze eines Forderungs-
[Seite der Druckausg.: 56 ]
kataloges an Stadt und Land, die Forderungen nach Geld und Sachleistungen dagegen ans Ende.
Das Verhältnis zwischen Bürger und politischem System insgesamt muß unter den Bedingungen der Bürgergesellschaft somit neu bestimmt und gestaltet werden. Schmalz-Bruns nennt dies die Aufgabe, „dem politischen Prozeß und den politischen Institutionen insgesamt eine reflexivere Struktur einzuschreiben" (die Autoren am Frankfurter Institut für Sozialforschung verbinden das Konzept der Bürgergesellschaft auf diese Weise mit dem Konzept der „reflexiven Demokratie", das sie als Anwendung der Demokratie auf sich selbst verstehen, letztendlich als tiefgreifende partizipatorische Reform des gesamten politischen Systems und aller darauf bezogenen Willensbildungsprozesse).
Die Bürgergesellschaft als konfliktfreier Hort alles Schönen, Wahren, Guten ? Man würde ihr mit dieser Vermutung wohl Unrecht tun, sei sie ernst gemeint oder - wie verschiedentlich vorgetragen - als mehr oder minder boshafte Karikatur. Soziale, politische und kulturelle Konflikte auf allen Handlungsebenen sind integraler Bestandteil jener Vielfalt, die die Bürgergesellschaft nicht nur fordert, sondern zur Voraussetzung hat. Dubiel vermutet hinter funktionsfähigen Konsensformen in hochdifferenzierten Gesellschaften gar „einzig das historische Kapital ertragener Verschiedenheit".
Gesellschaftliche und persönliche Konflikte sollen in der Bürgergesellschaft jedenfalls nicht von einem alles umhüllenden Mantel der Sanftmütigkeit zugedeckt werden. Sie gehören zum Selbstverständnis der Bürgergesellschaft ebenso wie die Bereitschaft, diese im Rahmen einer spezifischen Dialogkultur auszutragen.
6. Handlungsfeld Gemeinde
Bürgerschaftliches Engagement bezieht sich somit zwar keinesfalls ausschließlich, aber doch in hohem Maße auf das Handlungsfeld Gemeinde. Die Formen, in denen es sich vollzieht - Nachbarschaftshilfe, Stadtteilinitiative, Elterngruppe usw. - sind ebenso vielfältig und offen wie die
[Seite der Druckausg.: 57 ]
Aufgaben, die es sich stellt (kommunale Altenarbeit, Jugendarbeit, Stadtgestaltung, kulturelles Leen usw.). Entscheidend, so sein Selbstverständnis, sind weniger formale Strukturen und spezifische Aufgabenstellungen (sie variieren und sollen es auch) als die Bereitschaft der Bürger, gemeinsam mit anderen - seien es Einzelne, Familien, Gruppen oder Institutionen - in ihrer Gemeinde wirkungsvolle gemeinschaftsbildende Netzwerkstrukturen auf der Grundlage gegenseitiger Achtung und Hilfe zu bilden. Gemeinschaft und Teilhabe sind in der Idee der Bürgergesellschaft auf unzertrennliche Weise miteinander verbunden.
Empathie, Gegenseitigkeit, Verständigung mit -, und Verantwortung füreinander sind somit vier konstitutive Prinzipien einer kommunitären Ethik der civil society. Ich denke, es ist kein Zufall, daß wir damit auch einige der wesentlichen Elemente gemeinschaftsbildender internationaler Beziehungen formuliert haben. Prinzipien, die auf dem Weg zu einer Europäischen Gemeinschaft der Bürger von Nutzen sein können.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Januar 2001